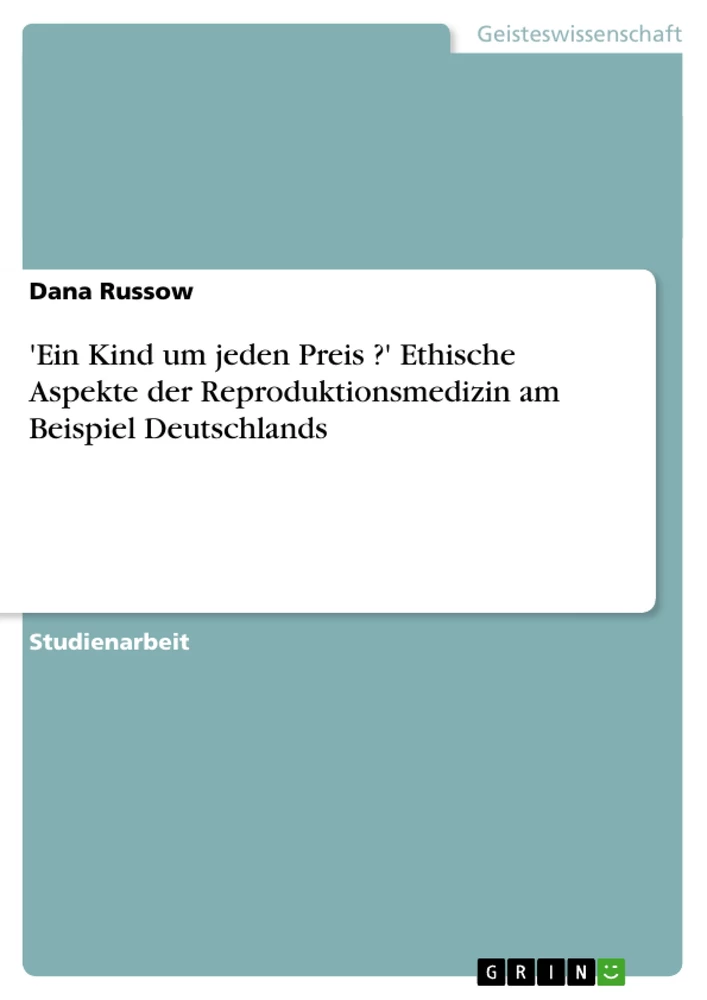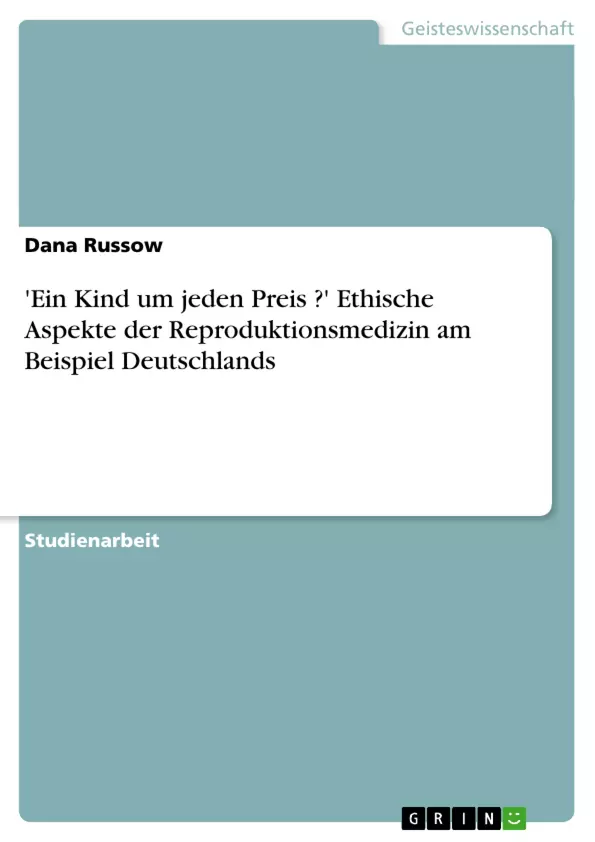Nachdem im Jahr 1964 durch die Legalisierung des Antikontrazeptivums
„Pille“ als Verhütungsmittel bei Menschen im fortpflanzungsfähigen Alter
eine neue Art der Lebensplanung ermöglicht wurde, entschieden sich immer
mehr Frauen im gebärfähigen Alter, die berufliche Karriere an die erste
Stelle ihrer Lebensziele zu stellen. 1
Das Bild von Elternschaft und der Rolle der Frau in der Gesellschaft wurde
dadurch erstmals erheblich verändert.
In der Bundesrepublik Deutschland nutzten zum damaligen Zeitpunkt viele
Frauen diese Möglichkeit der Familienplanung, ohne sich darüber im Klaren
zu sein, dass die Chance, ab einem Alter von 35 Jahren und darüber hinaus
schwanger zu werden, erheblich abnimmt, da ihrem Körper - und damit
ihrem Kinderwunsch - Grenzen gesetzt sind.2
In der damaligen DDR waren aufgrund der Doppelbelastungen der Mütter
durch Arbeit und Kindererziehung ein Geburtenrückgang zu verzeichnen, der
1975 sein Tief von 52,3 Geburten je 1000 Frauen erreichte.3 Auf Beschluss
des IX. Parteitages der SED im Jahre 1976 wurden weitgreifende soziale
Maßnahmen wirksam.
Diese beinhalteten beispielsweise die Erhöhung der Geburtenbeihilfe,
zinslose Ehekredite für Familien, Erweiterung des Wohnungsbaues,
Förderung der staatlichen Kinderbetreuung sowie bei der Geburt des zweiten
Kindes ein Jahr Freistellung von der Arbeit bei voller Lohnfortzahlung.
Danach war ein Geburtenanstieg zu verzeichnen, der im Jahre 1980 bereits
bei 67,4 /1000 Frauen lag. 4
Durch die Wiedervereinigung beider deutschen Staaten im Jahre 1990
änderte sich besonders in den neuen Bundesländern die Lage. Ausgelöst durch tiefgreifende soziale und politische Umstrukturierungen und
damit ausgelöste Existenzängste dürfte Deutschland in den Jahren 1990 –
1995 die niedrigste Geburtenrate der Welt gehabt haben. 5
Inzwischen ist die Anzahl der geborenen Kinder in den neuen Bundesländern
wieder angestiegen, hat jedoch noch nicht wieder den Stand von 1989
erreicht. [...]
1 Vgl. Österreichische Hebammenzeitung, 7.Jg, Ausg. 5/01, Oktober 2001
2 ebd.
3 Vgl. Peter Borowsky „Zeiten des Wandels“
4 Vgl. Österreichische Hebammenzeitung, 7.Jg, Ausg. 5/01, Oktober 2001
5 Vgl. Österreichische Hebammenzeitung, 7.Jg, Ausg. 5/01, Oktober 2001
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wozu brauchen wir die Reproduktionsmedizin?
- Verfahren der Reproduktionsmedizin
- Statistische Erhebungen
- Fallbeispiele
- Optionen und Alternativen
- Adoption
- Verzicht
- Fehlhandlungen
- Rechtliche Grundlagen
- Grundgesetz
- Embryonenschutzgesetz
- Strafgesetz
- Richtlinien der Bundesärztekammer
- Sozialgesetz
- Christliche Dogmen
- Pro und Contra zur Reproduktionsmedizin
- Die ethische Diskussion
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den ethischen Aspekten der Reproduktionsmedizin am Beispiel Deutschlands. Sie beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die zum Aufkommen der Reproduktionsmedizin geführt haben, und stellt die wichtigsten Verfahren der Reproduktionsmedizin vor. Die Arbeit analysiert auch die Optionen und Alternativen zur Reproduktionsmedizin und untersucht die rechtlichen und ethischen Aspekte der verschiedenen Verfahren.
- Entwicklung der Reproduktionsmedizin in Deutschland
- Ethische Aspekte der Reproduktionsmedizin
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Reproduktionsmedizin
- Optionen und Alternativen zur Reproduktionsmedizin
- Soziale und gesellschaftliche Folgen der Reproduktionsmedizin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Reproduktionsmedizin ein und beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die zum Aufkommen der Reproduktionsmedizin geführt haben. Sie stellt die wichtigsten Verfahren der Reproduktionsmedizin vor und beleuchtet die Bedeutung der Reproduktionsmedizin für die heutige Gesellschaft. Das Kapitel „Optionen und Alternativen“ befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten, die Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zur Verfügung stehen. Es werden Adoption, Verzicht und Fehlhandlungen als Optionen diskutiert. Das Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen der Reproduktionsmedizin in Deutschland. Es werden die wichtigsten Gesetze und Richtlinien im Zusammenhang mit der Reproduktionsmedizin analysiert.
Schlüsselwörter
Reproduktionsmedizin, Kinderwunsch, Ethik, Recht, Adoption, Verzicht, Embryonenschutzgesetz, In-vitro-Fertilisation (IVF).
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Reproduktionsmedizin heute so bedeutsam?
Durch veränderte Lebensplanungen und den Wunsch nach Karriere schieben viele Paare den Kinderwunsch nach hinten. Da die Fruchtbarkeit ab 35 Jahren sinkt, suchen viele Hilfe in der Reproduktionsmedizin.
Was regelt das Embryonenschutzgesetz in Deutschland?
Es bildet den rechtlichen Rahmen für Verfahren wie die In-vitro-Fertilisation (IVF) und setzt Grenzen, um den Schutz des ungeborenen Lebens und ethische Standards zu wahren.
Welche ethischen Fragen werden in der Arbeit diskutiert?
Zentrale Fragen sind das Recht auf ein Kind „um jeden Preis“, der Status des Embryos sowie die moralische Bewertung von Eingriffen in die natürliche Fortpflanzung.
Welche Alternativen gibt es zur Reproduktionsmedizin?
Paare können sich für eine Adoption entscheiden, den bewussten Verzicht auf eigene Kinder wählen oder alternative Lebensmodelle ohne Nachkommen verfolgen.
Wie beeinflusste die „Pille“ die gesellschaftliche Entwicklung?
Die Legalisierung der Pille 1964 ermöglichte erstmals eine präzise Lebensplanung, was das Bild der Elternschaft und die Rolle der Frau in der Gesellschaft nachhaltig veränderte.
- Citation du texte
- Dana Russow (Auteur), 2002, 'Ein Kind um jeden Preis ?' Ethische Aspekte der Reproduktionsmedizin am Beispiel Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23799