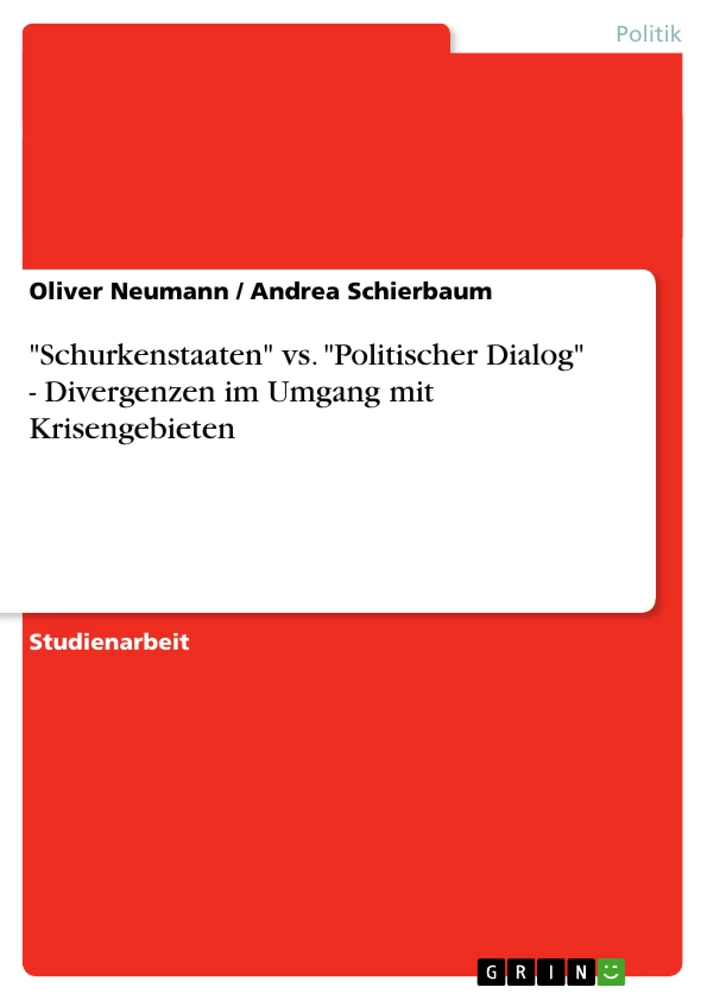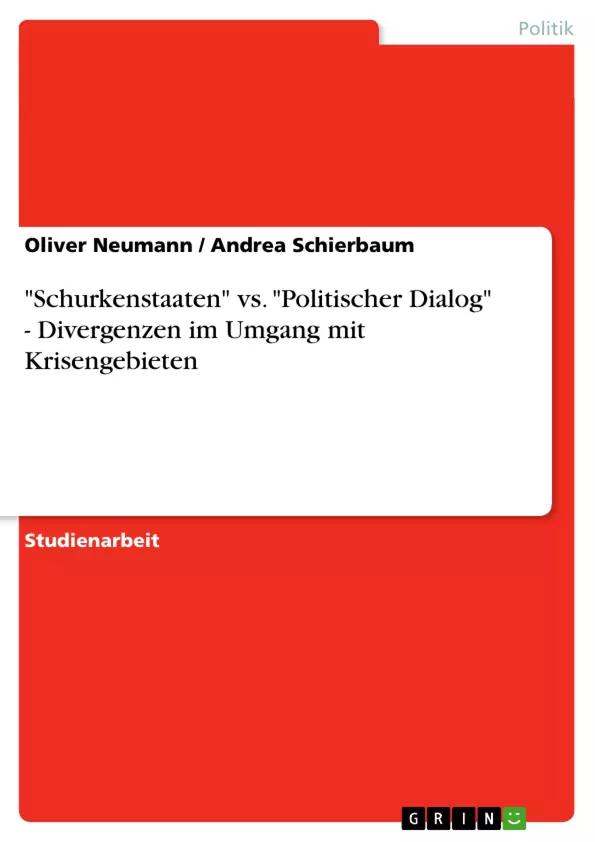„It is a partnership of democracies, for democracy” (Solana, Javier: “Europe and America: Partners of Choice. In: Speech to the annual dinner of the foreign policy association on 7 May 2003 in New York/USA).
Mit diesen Worten beschrieb der hohe Vertreter der europäischen ‚Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik’ (GASP), Javier Solana, erst kürzlich den Wert der transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den USA.
Und tatsächlich verbindet diese Brücke über dem Atlantik zwei Verbündete, die zahl-reiche Wertvorstellungen teilen, im Kalten Krieg Seite an Seite standen und deren wechselseitige Handelsbeziehungen alle anderen übertreffen.
Doch spätestens der Irak-Konflikt zu Beginn des Jahres 2003 hat bei allen nicht zu bestreitenden Gemeinsamkeiten auch die erheblichen Unterschiede zwischen den Verbündeten ans Tageslicht gebracht. Dies wird besonders im divergierenden Um-gang mit Krisengebieten deutlich.
Während die Europäische Union (EU) im Umgang mit Konflikten in Krisengebieten auf einen ‚Politischen Dialog’ baut, ist es für die USA ein probates Mittel Bedrohun-gen von so genannten Schurkenstaaten auch durch militärische Drohungen oder im schlimmsten Fall durch Interventionen abzustrafen.
Diese Entwicklung ist aus dem Zusammenbruch der UdSSR und dem damit verbun-denen Ende des Kalten Krieges hervorgegangen. Folglich ergaben sich sowohl für die Europäische Union, als auch für die USA neue Rollen in der Weltpolitik: die EU gelangte zu mehr Autonomie; die USA wurde die einzig existierende Weltmacht.
Im Verlauf dieser Ausarbeitung sollen, nach einer definitorischen Einführung in die Begriffe ‚Politischer Dialog’ und ‚Schurkenstaaten’, zunächst die in der Geschichte der beiden Außenpolitiken, sowie die in den politischen Strömungen verankerten Ur-sachen für die Divergenzen im Umgang mit Krisengebieten näher herausgearbeitet werden. Im Anschluss folgt eine Anwendung dieser Ergebnisse am Beispiel Syriens.
In einem abschließenden Fazit wird neben einer Zusammenfassung der Ergebnisse noch der Versuch eines Ausblicks auf die Zukunft der transatlantischen Beziehungen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 „Politischer Dialog“
- 2.2 „Schurkenstaat“
- 3. Ursachen für Divergenzen im Umgang mit Krisengebieten
- 3.1 Geschichte der US-Amerikanischen Außenpolitik
- 3.1.1 Verwendung des Begriffs Schurkenstaat unter Präsident Clinton
- 3.1.2 Auswirkungen des 11.09.2001 auf die US-Außenpolitik
- 3.2 Geschichte der europäischen Außenpolitik
- 3.2.1 Geschichte bis zur GASP
- 3.2.2 Funktionsweise und Aufgabenverteilung der GASP
- 3.2.3 Ebenen des Politischen Dialogs
- 3.2.4 Resümee
- 3.3 Auswirkungen der Unterschiede auf den Umgang mit Krisengebieten
- 3.1 Geschichte der US-Amerikanischen Außenpolitik
- 4. Syrien
- 4.1 Syrien: Schurkenstaat?
- 4.2 Staatsformen Syriens
- 4.2.1 Bascher el Assad
- 4.3 Historischer Abriss
- 4.4 Aktuelle Situation
- 4.5 Syrische Außenpolitik
- 4.5.1 Grundlinien der Außenpolitik
- 4.5.2 Die aktuelle Außenpolitik Syriens zur USA
- 4.5.3 Die syrische Außenpolitik zu Präsident Clintons Amtszeit
- 4.6 Das Verhältnis zwischen Syrien und der EU
- 4.7 Ausblick
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die divergierenden Strategien der USA und der EU im Umgang mit Krisengebieten. Die Arbeit analysiert die Ursachen dieser Unterschiede, fokussiert auf die unterschiedlichen historischen Entwicklungen der Außenpolitiken beider Akteure und die damit verbundenen Begriffsdefinitionen wie „Politischer Dialog“ und „Schurkenstaat“. Ein konkreter Fall, Syrien, dient der Veranschaulichung der theoretischen Erkenntnisse.
- Historische Entwicklung der US-amerikanischen und europäischen Außenpolitik
- Definition und Anwendung der Begriffe „Politischer Dialog“ und „Schurkenstaat“
- Analyse der Ursachen für divergierende Strategien im Krisenmanagement
- Fallstudie Syrien: Analyse der syrischen Außenpolitik im Kontext der US-amerikanischen und europäischen Strategien
- Auswirkungen der unterschiedlichen Ansätze auf den Umgang mit Krisengebieten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die transatlantischen Beziehungen zwischen der EU und den USA, hebt die Gemeinsamkeiten und die im Irak-Konflikt deutlich gewordenen Unterschiede hervor, insbesondere im Umgang mit Krisengebieten. Die EU setzt auf den „Politischen Dialog“, während die USA eher militärische Interventionen gegen sogenannte „Schurkenstaaten“ bevorzugen. Der Zusammenbruch der UdSSR und das Ende des Kalten Krieges führten zu neuen Rollen für beide Akteure: mehr Autonomie für die EU und die Position der USA als einzige Weltmacht. Die Arbeit skizziert den Aufbau: Begriffsdefinitionen, historische Analyse der Außenpolitiken und eine Fallstudie zu Syrien.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Politischer Dialog“ und „Schurkenstaat“. „Politischer Dialog“ beschreibt die EU-Strategie regelmäßiger Gespräche mit Drittstaaten zu Menschenrechten, Demokratie und humanitären Maßnahmen, wobei finanzielle Unterstützung vom Erfolg des Dialogs abhängt. „Schurkenstaat“, ursprünglich von Präsident Clinton geprägt, bezeichnet Staaten, die andere unterminieren und unkonventionelle Gewalt anwenden. Der Begriff wurde später von Madeleine Albright durch „states of concern“ ersetzt, um den USA mehr Flexibilität zu ermöglichen.
3. Ursachen für Divergenzen im Umgang mit Krisengebieten: Dieses Kapitel untersucht die historischen Wurzeln der unterschiedlichen Ansätze. Die US-amerikanische Außenpolitik wird von einer realpolitischen Tradition geprägt, die das nationale Interesse in den Vordergrund stellt und militärische Interventionen in Betracht zieht, wenn die Sicherheit der USA bedroht ist. Die europäische Außenpolitik, insbesondere die GASP, verfolgt einen stärker multilateralen und dialogorientierten Ansatz. Die Unterschiede in den historischen Erfahrungen und den jeweiligen politischen Systemen erklären die unterschiedlichen Strategien im Umgang mit Krisengebieten.
4. Syrien: Dieses Kapitel analysiert Syrien als Fallbeispiel. Es untersucht, ob Syrien als „Schurkenstaat“ betrachtet werden kann, beleuchtet die Geschichte und die aktuelle politische Situation, die syrische Außenpolitik gegenüber den USA und der EU und das Verhältnis zwischen Syrien und der EU. Der Fokus liegt auf der Anwendung der in den vorherigen Kapiteln dargestellten theoretischen Konzepte auf den konkreten Fall Syriens.
Schlüsselwörter
Politischer Dialog, Schurkenstaat, US-Außenpolitik, Europäische Außenpolitik, GASP, Krisenmanagement, Syrien, transatlantische Beziehungen, Interventionismus, Multilateralismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Divergierende Strategien der USA und der EU im Umgang mit Krisengebieten - Fallstudie Syrien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die unterschiedlichen Strategien der USA und der EU im Umgang mit Krisengebieten. Sie analysiert die Ursachen dieser Divergenzen, fokussiert auf die historischen Entwicklungen der Außenpolitiken beider Akteure und die damit verbundenen Begriffsdefinitionen wie „Politischer Dialog“ und „Schurkenstaat“. Syrien dient als Fallbeispiel zur Veranschaulichung der theoretischen Erkenntnisse.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert die zentralen Begriffe „Politischer Dialog“ (EU-Strategie regelmäßiger Gespräche mit Drittstaaten zu Menschenrechten, Demokratie und humanitären Maßnahmen) und „Schurkenstaat“ (Staaten, die andere unterminieren und unkonventionelle Gewalt anwenden, ursprünglich von Präsident Clinton geprägt). Der Wandel des Begriffs „Schurkenstaat“ zu „states of concern“ durch Madeleine Albright wird ebenfalls erläutert.
Welche historischen Entwicklungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die historischen Entwicklungen der US-amerikanischen und europäischen Außenpolitik. Die US-amerikanische Außenpolitik wird als realpolitisch und interventionsbereit beschrieben, während die europäische Außenpolitik, insbesondere die GASP (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik), einen multilateralen und dialogorientierten Ansatz verfolgt. Die Unterschiede in den historischen Erfahrungen und politischen Systemen werden als Erklärung für die unterschiedlichen Strategien im Krisenmanagement herangezogen.
Wie wird Syrien in dieser Arbeit behandelt?
Syrien dient als Fallstudie. Die Arbeit untersucht, ob Syrien als „Schurkenstaat“ betrachtet werden kann, beleuchtet die Geschichte und aktuelle politische Situation Syriens, die syrische Außenpolitik gegenüber den USA und der EU, und das Verhältnis zwischen Syrien und der EU. Der Fokus liegt auf der Anwendung der theoretischen Konzepte auf den konkreten Fall Syrien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsdefinitionen, Ursachen für Divergenzen im Umgang mit Krisengebieten, Syrien als Fallstudie und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Politischer Dialog, Schurkenstaat, US-Außenpolitik, Europäische Außenpolitik, GASP, Krisenmanagement, Syrien, transatlantische Beziehungen, Interventionismus, Multilateralismus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die divergierenden Strategien der USA und der EU im Umgang mit Krisengebieten und analysiert die Ursachen dieser Unterschiede. Sie beleuchtet die unterschiedlichen historischen Entwicklungen der Außenpolitiken beider Akteure und die damit verbundenen Begriffsdefinitionen. Die Fallstudie Syrien veranschaulicht die theoretischen Erkenntnisse.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels: Einleitung mit Beschreibung der transatlantischen Beziehungen, Begriffsdefinitionen von „Politischer Dialog“ und „Schurkenstaat“, Ursachen der Divergenzen im Umgang mit Krisengebieten, Analyse Syriens als Fallbeispiel und ein abschließendes Fazit.
- Citar trabajo
- Oliver Neumann (Autor), Andrea Schierbaum (Autor), 2003, "Schurkenstaaten" vs. "Politischer Dialog" - Divergenzen im Umgang mit Krisengebieten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23804