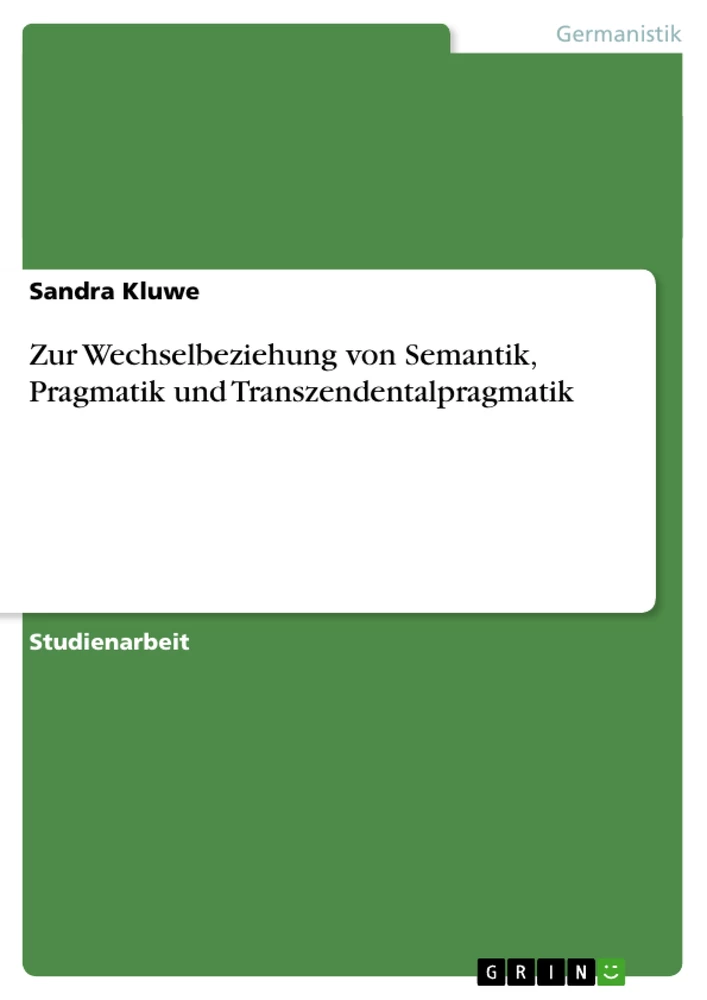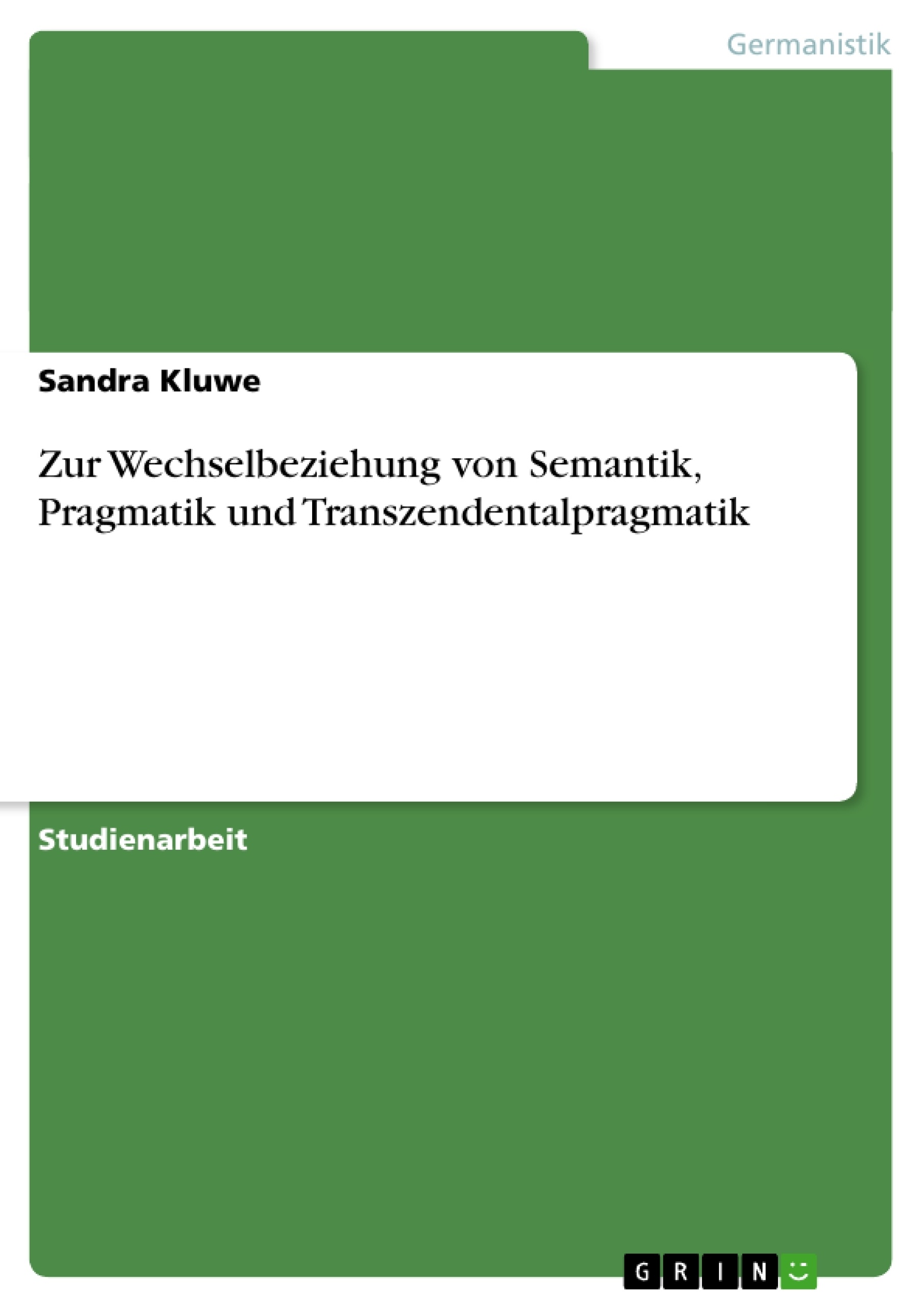Thema das Buches ist die komplementäre Beziehung von Semantik, Pragmatik und Transzendentalpragmatik. Gezeigt wird, dass eine angemessene Beschreibung der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke nur unter Einbeziehung des jeweiligen situativ-kommunikativen Kontextes gelingen kann, dass jedoch die Pluralität der Sprechakte eines transzendentalen Rückhalts bedarf, um, bei aller Polyfunktionalität, der semantischen Konsistenz nicht zu entraten. Auf diese Weise wird ein Weg gebahnt zwischen der Skylla des Essentialismus und der Charybdis des nominalistischen Funktionalismus, jenen Extrempositionen, deren Dissens im Universalienstreit der Scholastik grundiert ist. Da nun die Dualität von Wesenssemantik und Pragmatik in der Bilateralität des sprachilchen Zeichens, seiner sowohl ausdrucks- als auch inhaltsseitigen Funktion, im Keim bereits angelegt ist, wird im zweiten Abschnitt auf die Darstellungsfunktion der Sprache eingegangen, wobei neben dem strukturalistischen Zeichenbegriff der pragmatische Berücksichtigung findet. Auf dieser semiotischen Basis kann dann die Bedeutungsfunktion zur Darstellung kommen. Am Beispiel einer semasiologischen Analyse werden mit der Segmentierung und der Klassifizierung Methoden erprobt, die aus der Tradition des Taxonomischen Strukturalismus und Distributionalismus stammen, von Chomskys Generativer Transformationsgrammatik weiterentwickelt wurden und vornehmlich syntaktisch orientiert sind. Es wird geprüft, ob Semantik auf einen Syntax-Kalkül solcher Prägung reduziert bleiben kann oder aber ob sie sich zur Pragmasemantik zu erweitern hat. Nicht zuletzt die Schwierigkeiten, pragmalinguistische und sozio- sowie psycholinguistische Aspekte voneinander abzugrenzen, mündet in Abschnitt 5 in den Versuch einer transzendentalen Rückversicherung qua 'Apriori der Kommunikationsgesellschaft'. Die im Schlusskapitel angestellten Überlegungen stellen rückblickend die Frage, ob eine transzendentalpragmatische Sozialutopie wie diejenige Karl Otto Apels auch der individuellen Sinngebung den nötigen Spielraum gewährt.
Inhaltsverzeichnis
- Semantik
- I. EINLEITUNG.
- II. HAUPTTEIL: Semantik im Lichte ihrer Kommunikationsfunktion.
- 1. Funktionalismus vs. Essentialismus..
- 1.1 Essentialismus als Onto-Semantik (Weisgerber).
- 1.2 Funktionalismus als Pragmatismus (Peirce, Morris)
- 1.3 Funktionaler Reduktionismus als Behaviorismus und Szientismus
- 1.4 Mathematischer Funktionalismus (Frege)
- 1.5 Grenzen des Fregeschen Modells..
- 2. Darstellungsfunktion..
- 2.1 Strukturalistischer Zeichenbegriff (Saussure)
- 2.2 Pragmatischer Zeichenbegriff.
- 3. Bedeutungsfunktion....
- 3.1 Transformationsgrammatik (Chomsky)
- 3.2 Aspekte der Lexems
in Texten von Thomas Mann.. - 3.2.1 Quellen...
- 3.2.2 Syntagmatische Relationen.
- 3.2.3 Paradigmatische Relationen.
- 3.2.4 Onomasiologische Vernetzung.
- 3.2.5 Semantisierung als Poiesis..
- 3.3 Zur Hierarchie Syntax und semasiologischen Operation. Die Bedeutung des Lexems
. - 4. Gebrauchsfunktion...
- 4.1 (Versuchte) Abgrenzung zur Semantik.
- 4.2 Kompetenz Performanz. Zur Sprechakttheorie.
- 4.2.1 Deixis....
- 4.2.2 Situation/Kontext.
- 4.3 (Versuchte) Abgrenzung zur Psycho- und Soziolinguistik.
- 5. Zu Ansätzen der transzendentalen Sprachpragmatik.
- 5.1 Universalpragmatik (Habermas).
- 5.2 Transzendentalpragmatik (Apel).
- 5.2.1 Letztbegründung vs. Fallibilimus..
- 5.2.2 Von der transzendentalen Apperzeption zum Apriori der Kommunikationsgemeinschaft....
- 5.2.3 Ethischer An-Spruch' und 'naturalistic fallacy'
- III. Transzendentale Pragmasemantik und individueller Sinn: Überlegungen..
- Der Dualismus von Onto-Semantik und Pragmatismus.
- Die Darstellungsfunktion des sprachlichen Zeichens im Kontext des strukturalistischen und pragmatischen Zeichenbegriffs.
- Die Bedeutungsfunktion und ihre Analyse anhand von Methoden aus der taxonomischen Tradition des Distributionalismus und Chomskys Generativer Transformationsgrammatik.
- Die Gebrauchsfunktion und ihre Abgrenzung zur Semantik sowie die Auseinandersetzung mit der Sprechakttheorie.
- Ansätze der transzendentalen Sprachpragmatik und ihre Implikationen für die individuelle Sinngebung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern es sinnvoll ist, Semantik im Kontext ihrer Kommunikationsfunktion zu betrachten. Dabei wird die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke im Hinblick auf ihre wesenhafte oder funktionale Beziehung zum jeweiligen Bedeuteten untersucht. Der Fokus liegt auf dem Dualismus von Onto-Semantik und Pragmatismus, der sich aus dem erkenntnisfunktionalen Konflikt zwischen Idealismus und Materialismus ergibt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Sinnhaftigkeit einer Betrachtung der Semantik unter dem Aspekt ihrer Kommunikationsfunktion. Sie beschreibt den Dualismus zwischen Onto-Semantik und Pragmatismus, der die Grundlage der weiteren Untersuchung bildet.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Funktionalismus und Essentialismus, zwei gegensätzlichen Auffassungen von Bedeutung. Er beleuchtet verschiedene historische und theoretische Ansätze, darunter den Essentialismus Weisgerbers, den Pragmatismus von Peirce und Morris sowie den funktionalen Reduktionismus. Das Kapitel analysiert auch den mathematischen Funktionalismus Freges und dessen Grenzen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Darstellungsfunktion des sprachlichen Zeichens. Es diskutiert den strukturalistischen Zeichenbegriff Saussures und den pragmatischen Zeichenbegriff. Die Rolle des Zeichens in der Kommunikation steht im Mittelpunkt dieses Abschnitts.
Kapitel 4 untersucht die Bedeutungsfunktion und erprobt Methoden der Segmentierung und Klassifizierung. Die Arbeit bezieht sich auf die Taxomische Tradition des Distributionalismus und Chomskys Generativer Transformationsgrammatik. Es wird hinterfragt, ob Semantik auf einen Syntax-Kalkül reduzierbar ist oder ob eine Erweiterung zur Pragmasemantik notwendig ist.
Das fünfte Kapitel fokussiert auf die Gebrauchsfunktion und ihre Abgrenzung zur Semantik. Der Zusammenhang zur Sprechakttheorie wird erörtert. Die Kapitel befasst sich mit der Deixis, der Bedeutung von Situation und Kontext und der Abgrenzung zu psycholinguistischen und soziolinguistischen Aspekten.
Im sechsten Kapitel werden Ansätze der transzendentalen Sprachpragmatik diskutiert. Der Fokus liegt auf der Universalpragmatik Habermas und der Transzendentalpragmatik Apels. Die Kapitel beleuchtet Themen wie Letztbegründung und Fallibilimus sowie das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Das Kapitel analysiert auch die Beziehung zwischen ethischem An-Spruch und der 'naturalistic fallacy'.
Schlüsselwörter
Semantik, Kommunikationsfunktion, Funktionalismus, Essentialismus, Onto-Semantik, Pragmatismus, Strukturalismus, Zeichenbegriff, Bedeutungsfunktion, Gebrauchsfunktion, Sprechakttheorie, Transzendentalpragmatik, Universalpragmatik, Letztbegründung, Fallibilimus, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft.
- Quote paper
- Sandra Kluwe (Author), 1997, Zur Wechselbeziehung von Semantik, Pragmatik und Transzendentalpragmatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23821