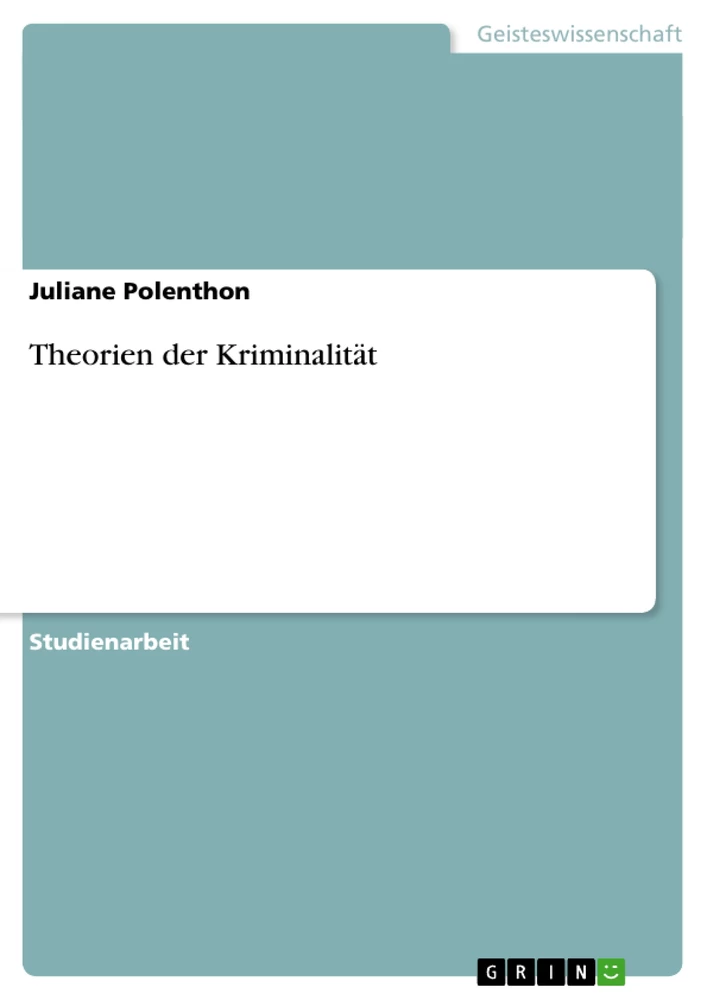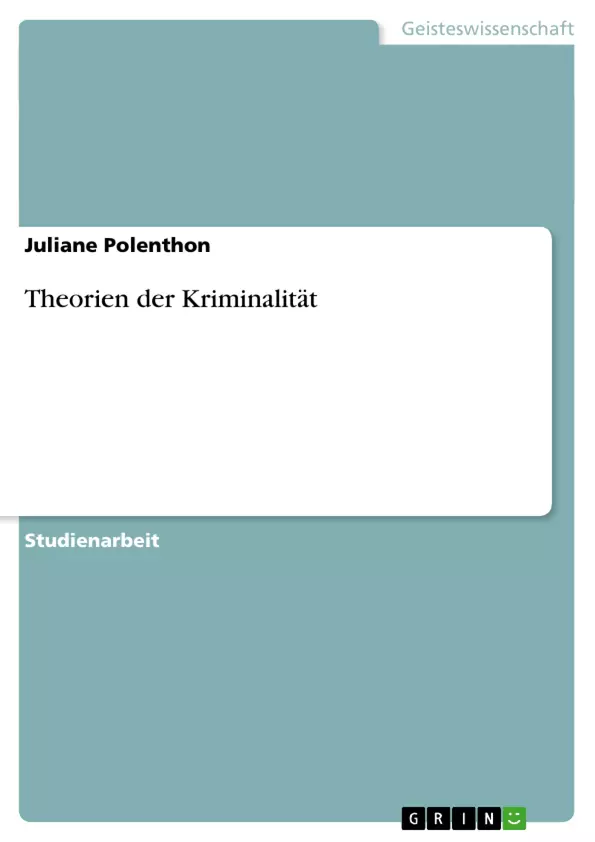Bei Kriminalität handelt es sich um einen Bereich, der eine Spannweite von Ladendiebstahl bis zu Massenmord umfaßt und daher nicht in eine Erklärung gegossen werden kann. Jede Theorie versucht also nur, bestimmte Arten von Devianz zu erklären, und keine vermag selbst das ohne Widersprüche. Kriminelles bzw. delinquentes Verhalten ist jenes abweichende Verhalten, das gegen Gesetze verstößt und mit strafrechtlicher Verfolgung bedroht ist - nicht mehr und nicht weniger. Das verbindet die verschiedenen Arten von Kriminalität und das relativiert sie wiederum, da bestimmte Verhaltensweisen in verschiedenen Gesellschaften, Kulturen und Epochen unterschiedlich bewertet werden (hier als abweichend, dort als normal). Es ist also eine Frage der Zuschreibung, was als delinquent qualifiziert wird und nicht abhängig von einer höheren Moral, Gut und Böse usw. .
Ich möchte in meiner Arbeit einige Theorien herausgreifen, die helfen, das Entstehen von Kriminalität zu erklären. Diese Theorien sind vorwiegend soziologische, obwohl es eine Reihe von biologischen, die hier ausgeklammert werden sollen, und psychologischen Erklärungsansätzen gibt, die, um die Thematik abzurunden, am Anfang der Arbeit besprochen werden. Jene Theorien neigen dazu, kriminelles Verhalten eines Täters als konstante, umweltunabhängige und genetische Merkmale seiner Persönlichkeit zu deuten und fragen nicht oder zu wenig nach den Umweltbedingungen und gesellschaftlichen Einflüssen, denen der einzelne ausgesetzt ist. Sie sind natürlich unerläßlich, z.B. Verhaltensweisen geistig abnormer Rechtsbrecher zu erklären, jedoch interessieren uns weniger einzelne "pathologische" Persönlichkeiten, vielmehr wollen wir das Entstehen von Delinquenz aufgrund gesellschaftlicher Faktoren wie Sozialisation, Schichtzugehörigkeit oder Geschlecht untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriff der Theorie
- III. Psychologische Theorien
- 1. Die Psychoanalyse
- 1.1 Sigmund Freund (um 1900)
- 1.2 Alexander und Staub
- 2. Kontrolltheorien (auch Halt- und Bindungstheorien genannt)
- 2.1 Theorie
- 2.2 Kritik
- 1. Die Psychoanalyse
- IV. Soziologische Theorien zur Erklärung von Kriminalität
- 1. Anomie
- 1.1 Theorie
- 1.2 Kritik
- 2. Lerntheorien
- 2.1 Theorie der differentiellen Assoziation
- 2.2 Theorie der differentiellen Identifikation
- 2.3 Gelegenheit und Kriminalität
- 2.4 Eysencks Kriminalitätstheorie
- 3. Aggressionstheorien
- 3.1 Sündenbocktheorie
- 1. Anomie
- V. Empirische Wirklichkeit und Anwendbarkeit
- 1. Bedeutung von Kriminalitätsstatistiken und deren Verzerrung durch Selektionsprozesse
- 2. Geschlecht und Kriminalität
- VI. Integrationsmodell der Kriminalitätstheorien
- 1. Diskussionsstand
- 2. Einzelne Integrationskonzepte
- 2.1 Albert K. Cohen
- 2.2 Richard Quinney
- 2.3 Edwin M. Schur
- 2.4 Werner Rüther
- 2.5 Theorie der unterschiedlichen Sozialisation
- VII. Wertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Analyse von Kriminalitätstheorien, die verschiedene Ansätze zur Erklärung von abweichendem Verhalten bieten. Ziel ist es, einen Überblick über die wichtigsten psychologischen und soziologischen Theorien zu geben, deren Hauptaussagen zu beleuchten und kritische Punkte zu diskutieren. Darüber hinaus werden die Anwendbarkeit der Theorien in der empirischen Wirklichkeit sowie Ansätze zur Integration verschiedener Theorien betrachtet.
- Psychologische Theorien der Kriminalität (Psychoanalyse, Kontrolltheorien)
- Soziologische Theorien der Kriminalität (Anomie, Lerntheorien, Aggressionstheorien)
- Empirische Anwendbarkeit und Kritik von Kriminalitätstheorien
- Integrationsmodelle der Kriminalitätstheorien
- Bewertung der Relevanz und Grenzen von Kriminalitätstheorien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit erläutert den Fokus auf Kriminalitätstheorien und die Notwendigkeit, das Thema aufgrund seiner Komplexität auf verschiedene Erklärungsansätze zu beschränken. Die Definition des Begriffs "Theorie" im zweiten Kapitel legt die Grundlage für die Analyse verschiedener Theorien. Das dritte Kapitel widmet sich den psychologischen Theorien, angefangen von Freud's Psychoanalyse bis hin zu Kontrolltheorien, die das Individuum als Ausgangspunkt für delinquentes Verhalten sehen.
Das Kernstück der Arbeit liegt im vierten Kapitel, welches verschiedene soziologische Theorien der Kriminalität beleuchtet, darunter die Anomie-Theorie, die Lerntheorien und die Aggressionstheorien. Diese Theorien fokussieren auf gesellschaftliche Faktoren, die zur Entstehung von Delinquenz beitragen. Das fünfte Kapitel diskutiert die empirische Anwendbarkeit und Kritik der Theorien, unter anderem im Hinblick auf die Bedeutung von Kriminalitätsstatistiken.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Frage, wie verschiedene Theorien integriert werden können, um eine umfassende Erklärung für Kriminalität zu finden. Es werden verschiedene Ansätze von Cohen bis Rüther vorgestellt, die jedoch die Schwierigkeit hervorheben, ein allumfassendes Integrationsmodell zu erstellen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die wichtigsten Theorien der Kriminalität, die verschiedene Perspektiven auf abweichendes Verhalten beleuchten. Schlüsselbegriffe sind: Kriminalität, Devianz, Soziale Kontrolle, Psychoanalyse, Kontrolltheorien, Anomie, Lerntheorien, Aggressionstheorien, Integrationsmodelle, empirische Forschung, Kriminalitätsstatistiken.
- Quote paper
- Juliane Polenthon (Author), 2002, Theorien der Kriminalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23867