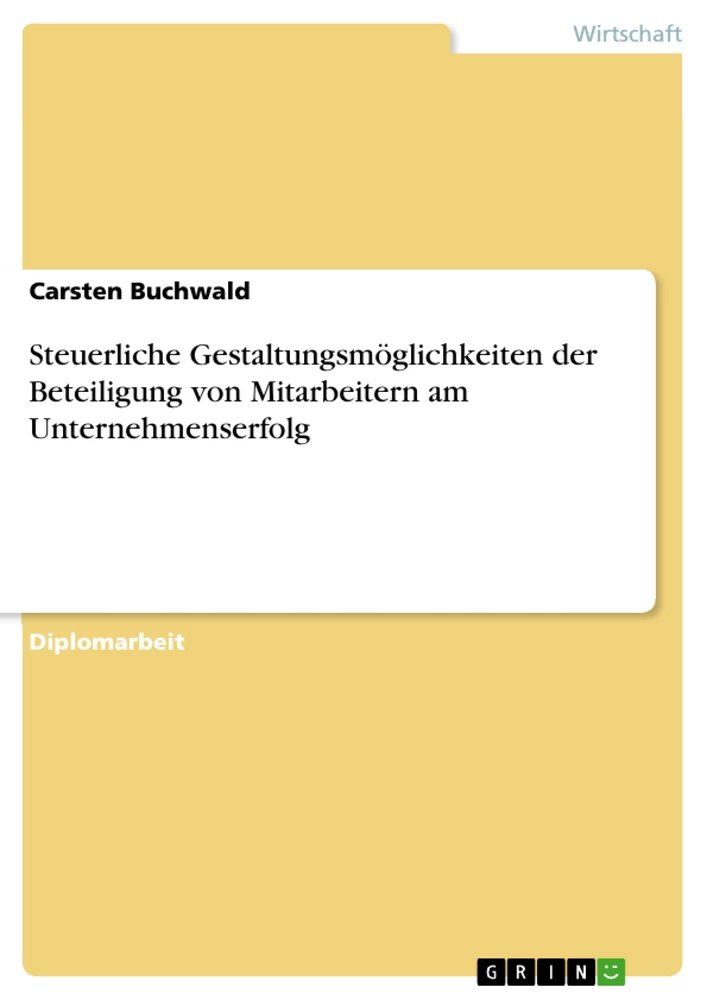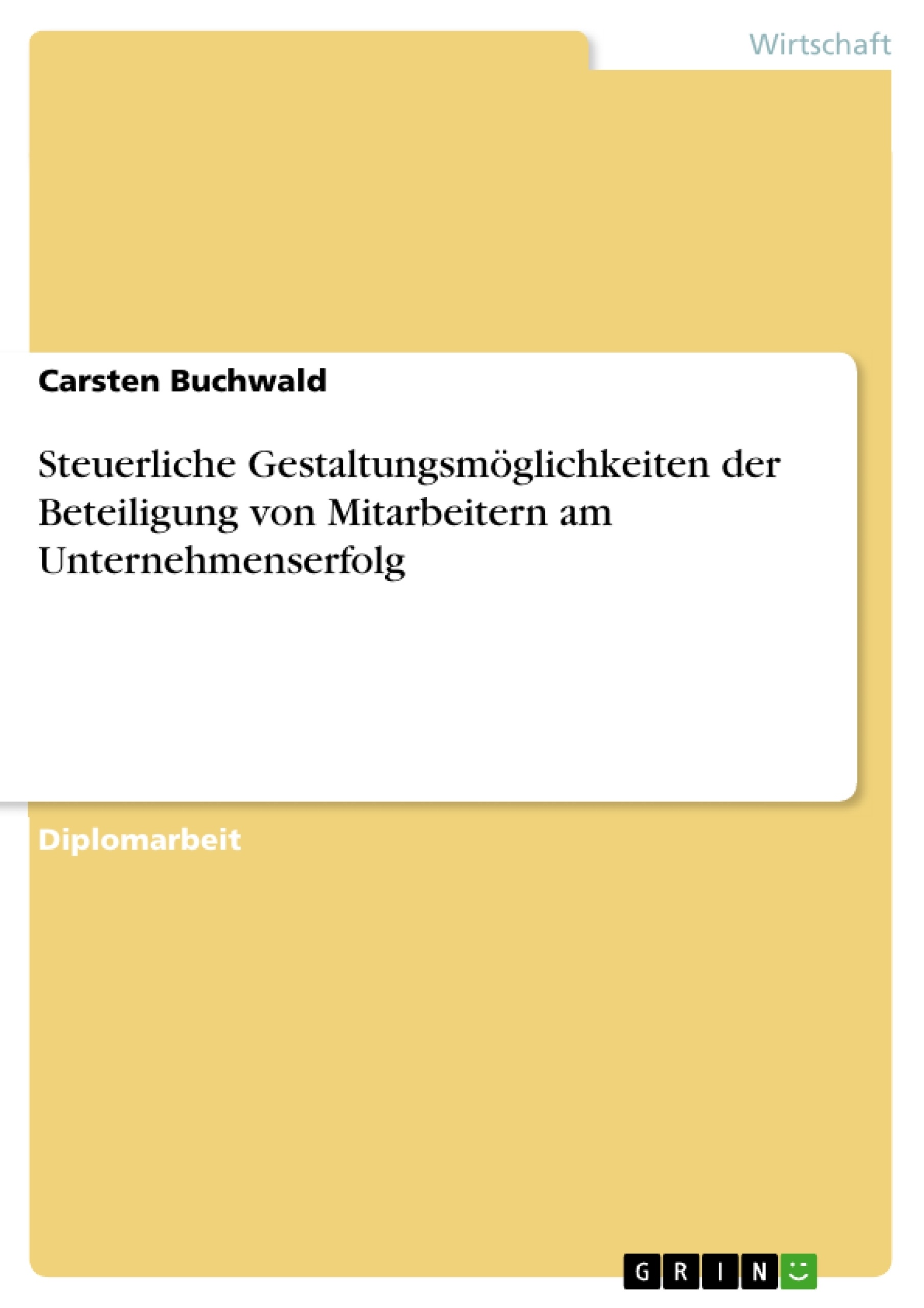Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
Die Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg ihres Arbeitgebers hat in Deutschland seit über 150 Jahren Tradition. 1 Unter den mindestens 70 heute noch namentlich bekannten Firmen, welche bereits im 19. Jahrhundert eine Gewinnbeziehungsweise
Erfolgsbeteiligung in Deutschland eingeführt hatten, haben wenigstens
fünf ihre Beteiligungsmodelle schon vor 1850 eingeführt. Das bekannteste Beispiel einer frühen arbeitnehmerbezogenen Unternehmenspolitik bietet der Unternehmer Ernst Abbe: Mit dem Statut der Carl-Zeiss-Stiftung hat er eine Form gefunden, Arbeitnehmern durch bis dahin außergewöhnliche Sonderleistungen indirekt einen Anteil am Ertrag des Unternehmens zukommen zu lassen. In dem 1896 von Ernst Abbe errichteten Statut der Carl-Zeiss-Stiftung heißt es übersetzt: „Der Prozentsatz dieses Zuschlags auf das Lohn-und Gehaltskonto ist von Jahr zu Jahr so zu bemessen, daß unter tunlichster Ausgleichung der Schwankungen des Geschäftsganges ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Anteil der Geschäfts-angehörigen am wirtschaftlichen Gesamtertrag und dem Anteil der Stiftung [...] sich ergibt.“(2) Bis zum zweiten Weltkrieg gab es etwa 30 Firmen, die ihre Mitarbeiter an Kapital und/ oder Gewinn beteiligten; nach dem Krieg nahm die Zahl rasch zu. Doch noch bis in die siebziger Jahre hinein wurde Mitarbeiterbeteiligung vorwiegend sozial begründet.(3) Mittlerweile ist die Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand durch Beteiligung der Mitarbeiter am
Produktivvermögen nicht nur eine Sozialleistung sondern auch ein Wettbewerbsfaktor für eine moderne Wirtschaft. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, knapper finanzieller Mittel und hartem Wettbewerb durch zunehmende Globalisierung, bringen Vergütungssysteme in Form von Erfolgsbeteiligungen sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern Vorteile.
[...]
______
1 Vgl. o.V.: Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer, Finanztest von November 1999, S. 19.
2 Vgl. Fiedler-Winter, R.: Innovative Mitarbeiterbeteiligung- Der Königsweg für die Wirtschaft, Landsberg/ Lech 1998, S. 9f.
3 Vgl. Wagner, K.-R.: Renaissance der Mitarbeiterbeteiligung, BB 1995, S. 2f.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Neuausrichtung der Vergütungssysteme an internationalen Maßstäben
- 2.1 Umdenken in der Vergütungspolitik
- 2.2 Wandel der Vergütungsstruktur von festen zu variablen Bezügen
- 2.3 Übersicht der Beteiligungsvarianten am Unternehmenserfolg für Mitarbeiter
- 2.4 Empirische Relevanz von Mitarbeiterbeteiligungen
- 2.4.1 Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland
- 2.4.2 Mitarbeiterbeteiligung in den USA
- 2.4.3 Internationale Verbreitung von Aktienoptionsplänen
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Chancen einer Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg
- 3.1 Steigerung der Leistungsmotivation und Produktivität
- 3.1.1 Verminderung des Principal-Agent-Konfliktes
- 3.1.2 Motivationsförderung durch Mitunternehmerschaft
- 3.2 Erhöhung der Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt
- 3.2.1 Erleichterung der Rekrutierung neuer Mitarbeiter
- 3.2.2 Langfristige Bindung der Mitarbeiter
- 3.3 Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation der Gesellschaft
- 3.3.1 Stärkung des Images auf dem Kapitalmarkt i.S.d. Shareholder Value
- 3.3.2 Verminderung des Werteabflusses bei der Gesellschaft
- 3.3.3 Beschaffung von Eigen-/ Fremdkapital
- 3.3.4 Flexibilisierung der Entgeltgestaltung
- 3.4 Übernahme sozialpolitischer Verantwortung für die Mitarbeiter
- 3.4.1 Vermögensbildung in Händen der Arbeitnehmer
- 3.4.2 Erfolgsbeteiligung als Altersvorsorge
- 3.5 Konsequenzen der Vorteile und Risiken
- 3.1 Steigerung der Leistungsmotivation und Produktivität
- 4 Öffentliche Fördermöglichkeiten von Mitarbeiterbeteiligungen
- 4.1 Steuerliche Förderung nach § 19a EStG
- 4.2 Staatliche Förderung durch Sparzuschüsse nach dem Vermögensbildungsgesetz
- 4.3 Bewertung der öffentlichen Förderungen
- 5 Charakterisierung der verschiedenen Varianten der Mitarbeiterbeteiligungen unter dem Gesichtspunkt der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- 5.1 Eigenkapitalbeteiligungen
- 5.1.1 Gewährung von Mitarbeiteraktienoptionen
- 5.1.1.1 Charakterisierung dieser Form der Beteiligung
- 5.1.1.2 Steuerliche Konsequenzen für den Optionsnehmer
- 5.1.1.2.1 Zeitpunkt der Besteuerung
- 5.1.1.2.2 Bewertbarkeit von Stock Options
- 5.1.1.2.3 Bestimmung der Einkunftsart
- 5.1.1.2.4 Problematik der Anschlußbesteuerung nach Optionsausübung
- 5.1.1.2.5 Gestaltungsmöglichkeiten durch Anwendung der Tarifbe- günstigung und Inanspruchnahme des Freibetrags für Abfindungen
- 5.1.1.2.6 Besteuerung bei Dienstverhältnissen in verschiedenen Ländern ..
- 5.1.1.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für den Optionsgeber
- 5.1.1.3.1 Übersicht
- 5.1.1.3.2 Bedienung eines Aktienoptionsprogramms auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage
- 5.1.1.3.3 Bedienung eines Aktienoptionsprogramms auf betrieblicher Grundlage
- 5.1.1.3.4 Kauf eines Optionsprogramms von einem Dritten
- 5.1.1.3.5 Gestaltungsmöglichkeiten für die ausgebende Gesellschaft
- 5.1.1.4 Kapitalverwässerungseffekt als Konsequenz für die Altaktionäre
- 5.1.2 Ausgabe von Belegschaftsaktien
- 5.1.2.1 Charakterisierung dieser Form der Beteiligung
- 5.1.2.2 Steuerliche Konsequenzen für die Arbeitnehmer
- 5.1.2.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für den Arbeitgeber
- 5.1.1 Gewährung von Mitarbeiteraktienoptionen
- 5.2 Eigenkapitalähnliche Beteiligungen
- 5.2.1 Stille Beteiligungen
- 5.2.1.1 Charakterisierung dieser Form der Beteiligung
- 5.2.1.2 Steuerliche Konsequenzen für die neuen Gesellschafter
- 5.2.1.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für die Gesellschaft
- 5.2.2 Vergabe von Genußrechten
- 5.2.2.1 Charakterisierung dieser Form der Beteiligung
- 5.2.2.2 Steuerliche Konsequenzen für die Inhaber
- 5.2.2.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für die ausgebende Gesellschaft
- 5.2.1 Stille Beteiligungen
- 5.3 Fremdkapitalbeteiligungen
- 5.3.1 Gewährung von Mitarbeiterdarlehen
- 5.3.1.1 Charakterisierung dieser Form der Beteiligung
- 5.3.1.2 Steuerliche Konsequenzen für die Mitarbeiter
- 5.3.1.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für den Arbeitgeber
- 5.3.2 Ausgabe von Schuldverschreibungen
- 5.3.2.1 Charakterisierung dieser Beteiligungsform
- 5.3.2.2 Steuerliche Konsequenzen für die Inhaber
- 5.3.2.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für die ausgebende Gesellschaft
- 5.3.1 Gewährung von Mitarbeiterdarlehen
- 5.4 Virtuelle Beteiligungen
- 5.4.1 Begriff der virtuellen Beteiligungen
- 5.4.2 Vergütung durch Stock Appreciation Rights
- 5.4.2.1 Charakterisierung dieser Beteiligungsform
- 5.4.2.2 Steuerliche Konsequenzen für die Arbeitnehmer
- 5.4.2.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für den Arbeitgeber
- 5.4.3 Vergütung durch Phantom Stocks
- 5.4.3.1 Charakterisierung dieser Beteiligungsform
- 5.4.3.2 Steuerliche Konsequenzen für die Arbeitnehmer
- 5.4.3.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für den Arbeitgeber
- 5.5 Tantiemen und ähnliche Bonussysteme
- 5.5.1 Charakterisierung dieser Beteiligungsform
- 5.5.2 Steuerliche Konsequenzen für die Mitarbeiter
- 5.5.3 Bilanzielle und steuerliche Konsequenzen für die Gesellschaft
- 5.6 Ausblick
- 5.1 Eigenkapitalbeteiligungen
- 6 Allgemeine Besteuerungsgrundsätze bei variabler Entlohnung
- 6.1 Lohnsteuer nach §§ 38 ff. EStG bei Einkünften aus Erfolgsbeteiligungen
- 6.2 Verdeckte Gewinnausschüttung bei Gesellschafter-Geschäftsführern/ Vorständen
- 6.3 Abschläge bei Rückstellungsbildung
- 6.4 Finanzierung von Mitarbeiterbeteiligungen über ein Darlehen vom Arbeitgeber
- 7 Vorteilhaftigkeitsvergleich der verschiedenen Beteiligungen von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg
- 7.1 Vor- und Nachteile von Performancemaßen für die Bemessung einer Mitarbeitererfolgsbeteiligung
- 7.2 Personalwirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten von Erfolgsbeteiligungen
- 7.3 Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten von Erfolgsbeteiligungen aus steuerlicher Sicht
- 8 Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg. Ziel ist es, die verschiedenen Formen der Mitarbeiterbeteiligung im Hinblick auf ihre steuerlichen Auswirkungen zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden sowohl die steuerlichen Konsequenzen für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen betrachtet.
- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -produktivität
- Verbesserung der Attraktivität des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt
- Optimierung der finanzwirtschaftlichen Situation des Unternehmens
- Übernahme sozialpolitischer Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern
- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten von Mitarbeiterbeteiligungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und das Ziel der Arbeit erläutert. Anschließend werden die verschiedenen Formen der Mitarbeiterbeteiligung im Hinblick auf ihre steuerlichen Auswirkungen untersucht. Dabei werden sowohl die steuerlichen Konsequenzen für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen betrachtet. Es werden die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Beteiligungsformen aus personalwirtschaftlicher, finanzwirtschaftlicher und steuerlicher Sicht gegenübergestellt. Die Arbeit endet mit einer Schlußbemerkung, die die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Mitarbeiterbeteiligung, Unternehmenserfolg, Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, Aktienoptionen, Belegschaftsaktien, Stille Beteiligungen, Genußrechte, Mitarbeiterdarlehen, Schuldverschreibungen, Virtuelle Beteiligungen, Tantiemen, Bonussysteme, Lohnsteuer, Verdeckte Gewinnausschüttung, Vermögensbildung, Altersvorsorge
Häufig gestellte Fragen
Welche Formen der Mitarbeiterbeteiligung gibt es?
Es wird zwischen Eigenkapitalbeteiligungen (z.B. Aktien), eigenkapitalähnlichen Beteiligungen (stille Beteiligung), Fremdkapitalbeteiligungen (Darlehen) und virtuellen Beteiligungen unterschieden.
Was sind die steuerlichen Vorteile von Aktienoptionen für Arbeitnehmer?
Die Arbeit untersucht Gestaltungsmöglichkeiten wie die Anwendung von Tarifbegünstigungen und die Inanspruchnahme von Freibeträgen bei der Besteuerung.
Was ist der Unterschied zwischen Phantom Stocks und echten Aktien?
Phantom Stocks sind virtuelle Beteiligungen, die den Wertverlauf von Aktien simulieren, ohne dass der Mitarbeiter tatsächliches Eigentum am Unternehmen erwirbt.
Wie fördert der Staat Mitarbeiterbeteiligungen?
Die Förderung erfolgt unter anderem über § 19a EStG sowie durch Arbeitnehmer-Sparzulagen nach dem Vermögensbildungsgesetz.
Warum führen Unternehmen Erfolgsbeteiligungen ein?
Hauptgründe sind die Steigerung der Motivation, die Mitarbeiterbindung, die Verbesserung des Unternehmensimages und die Flexibilisierung der Entgelte.
- Citar trabajo
- Carsten Buchwald (Autor), 2001, Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenserfolg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/239