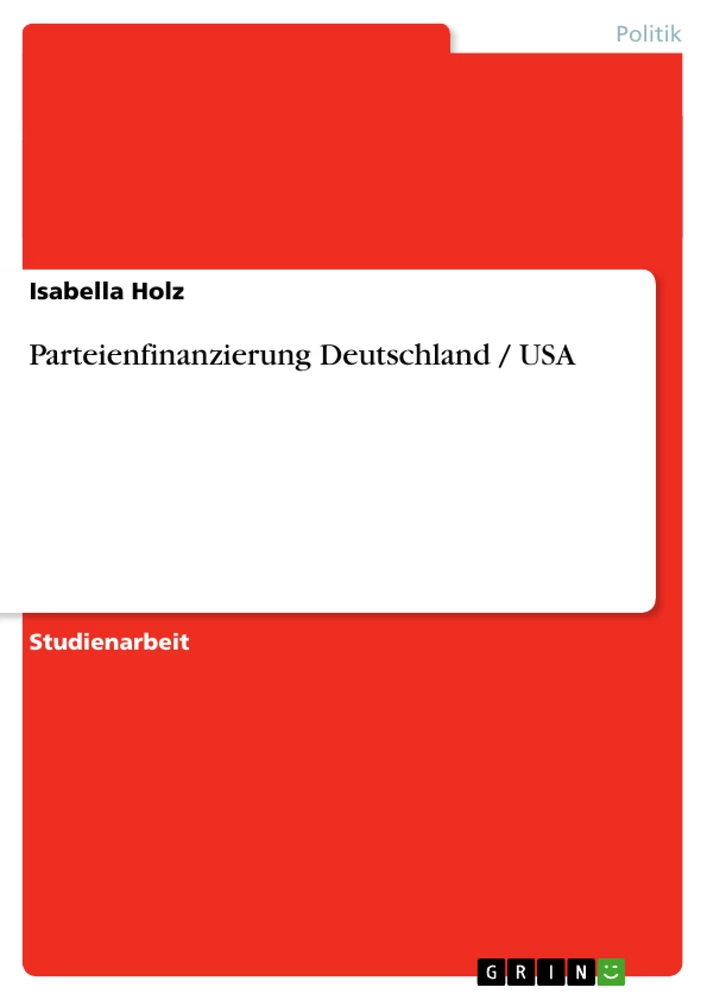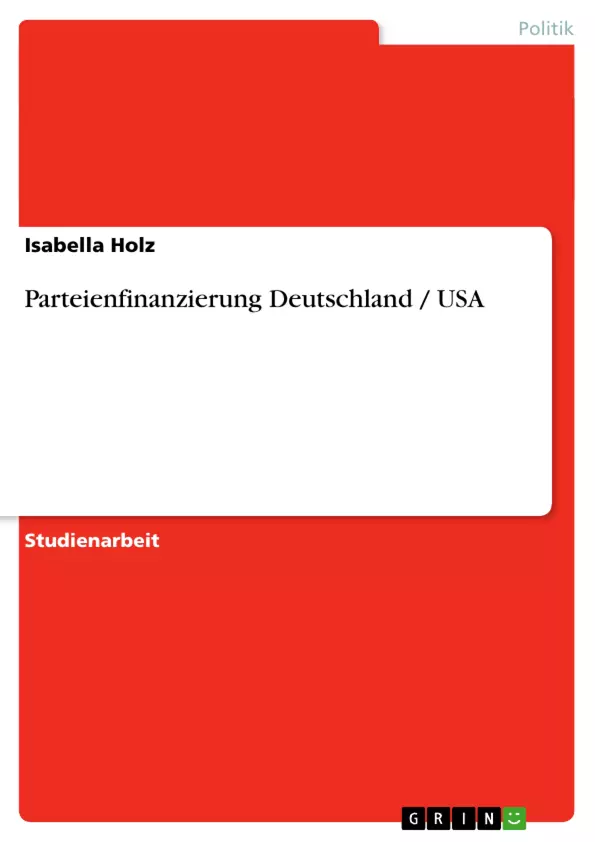Dieser Kommentar zum Ausscheiden Paul Tsongas aus dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 1992 erscheint angesichts der heutigen Kosten demokratischer Wahlen durchaus nachvollziehbar: Im Jahr 2000 kostete dieser Wahlkampf über 3 Milliarden Dollar, für Kongresswahlen wurden schätzungsweise 1,7 Milliarden Do llar ausgegeben. Die Wahl des Deutschen Bundestages erforderte 330 Millionen DM. In Anbetracht solcher enormen Summen drängt sich die Frage auf, wer diese Kosten trägt. Woher stammen die finanziellen Mittel für immer teurer werdende Wahlkämpfe? Wird persönlicher Reichtum zum neuen Auswahlkriterium für die Kandidaten? Benötigt ein Amtsanwärter finanzkräftige Freunde? Wird er von reichen Spendern und deren Interessen abhängig?
In den Vereinigten Staaten sorgten solche Abhängigkeiten in regelmäßigen Abständen für Skandale. Im pluralistischen Finanzierungssystem kommt es trotz strenger Regulierungen immer wieder zu Verflechtungen von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Ein amerikanischer Wahlkampf ohne Spenden wäre undenkbar, da die staatliche Wahlkampffinanzierung nur einen Bruchteil der anfallenden Kosten abdeckt und zudem noch auf die Präsidentschaftswahlen beschränkt ist. Für Kongresswahlen hingegen werden keine öffentlichen Mittel ausgeschüttet, sodass die Kandidaten ihre Wahlkampfgelder selbst aufbringen oder eintreiben müssen. Ausgabenlimits existieren ebenfalls nur für Präsidentschaftskandidaten, allen anderen stehen unbegrenzte Möglichkeiten offen - vorausgesetzt sie verfügen über einträgliche Geldquellen. In Deutschland dagegen findet man eines der großzügigsten Finanzierungssysteme der Welt. Im Gegensatz zur kandidatenzentrierten Wahlkampffinanzierung der USA muss hier von Parteienfinanzierung gesprochen werden. Niedrige Anspruchshürden, hohe Pauschalbeträge und Zuschüsse sichern den Parteien berechenbare, hohe Einkünfte, die einen beträchtlichen Teil ihrer Kosten decken. Doch auch eine solche staatliche Parteienfinanzierung, die zudem wegen der zu großen Abhä ngigkeit der Parteien vom Staat kritisiert wird, konnte bislang auch keine Spendenskandale wie das „System Kohl“ verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Forschungsfrage
- Forschungsstand
- Die gesetzlichen Grundlagen der Parteien- und Wahlkampffinanzierung
- Spendenlimits und Spendenverbote
- Soft Money und independent Expenditures in den USA
- Öffentliche Finanzierung und Ausgabenbeschränkung
- Indirekte öffentliche Subventionen und Steuervergünstigungen
- Veröffentlichungspflicht
- Empirische Befunde
- Die Wahlkampfbudgets in den USA
- Einnahmestrukturen der Kongresswahlen 2002
- Einnahmestrukturen der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2000
- Einnahmestruktur der deutschen Parteien
- Bewertung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist ein Vergleich der amerikanischen und deutschen Parteienfinanzierungssysteme. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme beleuchtet, um herauszufinden, welche Lösungen und Erkenntnisse sich gegenseitig nutzen lassen.
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der amerikanischen und deutschen Parteienfinanzierung
- Die Auswirkungen unterschiedlicher Finanzierungsmodelle auf die politische Landschaft
- Die Rolle von Spenden, staatlichen Subventionen und anderen Finanzierungsquellen
- Die Bedeutung von Transparenz und Regulierung im Bereich der Parteienfinanzierung
- Die Herausforderungen, die sich aus den unterschiedlichen Systemen ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Forschungsfrage der Arbeit vorgestellt und der Kontext des Themas im Hinblick auf die hohen Kosten von Wahlkämpfen und die damit verbundenen Fragen der Finanzierung beleuchtet. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Forschungsstand zum Thema Parteien- und Wahlkampffinanzierung, wobei ein Überblick über relevante Studien und Forschungsfelder gegeben wird. Kapitel drei beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen der Parteien- und Wahlkampffinanzierung in den USA und Deutschland, mit einem Fokus auf die Regelungen zu Spendenlimits, Spendenverboten und der Rolle staatlicher Finanzierung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Parteienfinanzierung, Wahlkampffinanzierung, Vergleichende Politikwissenschaft, Korruption, Spenden, staatliche Subventionen, Transparenz, Regulierung, USA, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich die Parteienfinanzierung in Deutschland und den USA?
Deutschland hat ein stark staatlich bezuschusstes System, während die USA fast ausschließlich auf private Spenden setzen, was zu unterschiedlichen Abhängigkeiten führt.
Was versteht man unter „Soft Money“ in den USA?
„Soft Money“ bezeichnete früher unbegrenzte Spenden an Parteien für allgemeine Zwecke, die oft zur Umgehung von Limits für Einzelkandidaten genutzt wurden.
Wie hoch sind die Kosten für Wahlkämpfe in den USA?
Bereits im Jahr 2000 kostete der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf über 3 Milliarden Dollar, ein Vielfaches der Ausgaben für deutsche Bundestagswahlen.
Gibt es in Deutschland Grenzen für Parteispenden?
Es gibt keine absoluten Limits für die Höhe von Spenden, aber strenge Veröffentlichungspflichten ab bestimmten Beträgen, um Transparenz zu gewährleisten.
Was sind „Independent Expenditures“?
Dies sind Ausgaben für politische Werbung durch Dritte, die nicht direkt mit dem Kandidaten abgestimmt sind und in den USA eine massive Rolle spielen.
- Citation du texte
- Isabella Holz (Auteur), 2003, Parteienfinanzierung Deutschland / USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24056