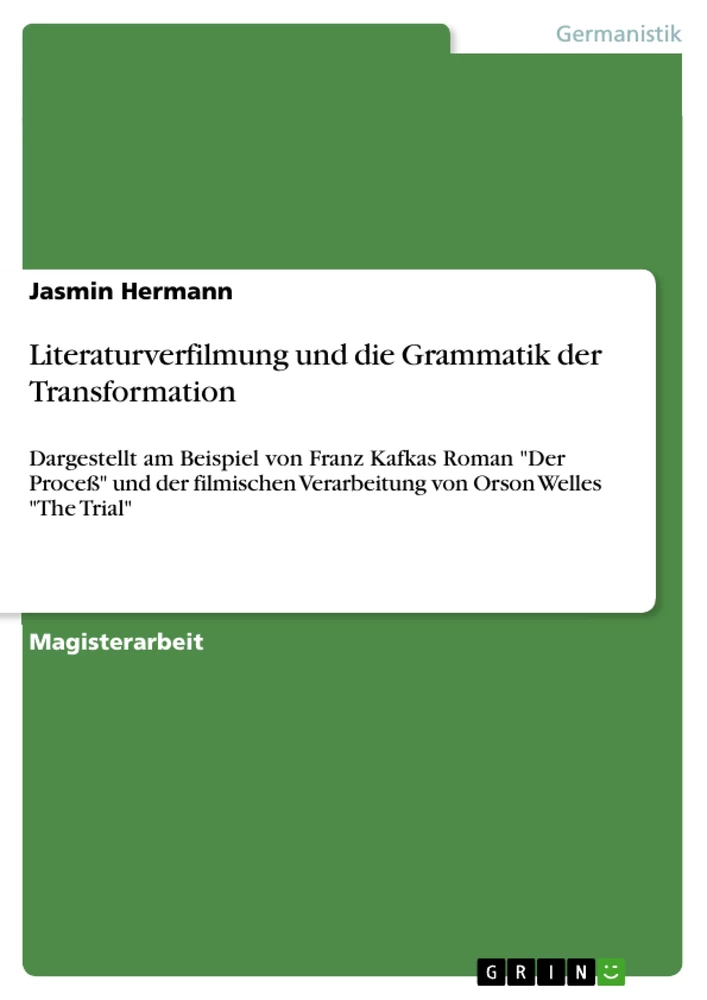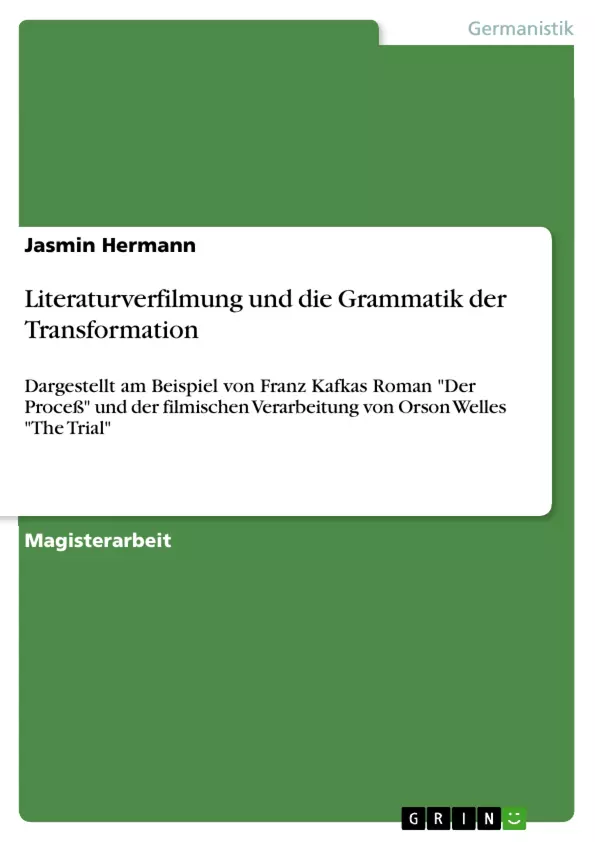Lange Zeit fungierte die Original- oder Werktreue als populär deutsches Ausschließlichkeitskriterium innerhalb eines mit moralisierender Hochkultur-Stimmung aufgeladenen akademischen Diskurses über die Qualität von Literaturverfilmungen. Das Licht des 18. Jahrhunderts hatte seine Schatten weit geworfen.
Die Literaturwissenschaft pflegte im Namen ihres Heroen Goethe die Tradition der Hierarchisierung von innerer und äußerer Wahrnehmung und konnotierte das filmische Medium (auch) aufgrund dessen Anschein der Naturnachahmung tendenziell negativ:
„Das Auge mag wohl der klarste Sinn genannt werden, durch den die leichte Überlieferung möglich ist. Aber der innere Sinn ist noch klarer, und zu ihm gelangt die höchste und schnellste Überlieferung durchs Wort; denn dieses ist eigentlich fruchtbringend, wenn das, was wir durchs Auge auffassen, an und für sich fremd und keineswegs so tiefwirkend vor uns steht.“
Im Erkennen der künstlerisch-gestalterischen Fähigkeiten des Films in Absetzung zu seinem scheinbar reproduzierenden Wesen blieb der innere Sinn jedoch getrübt: Der Oberflächencharakter des Bildes unterlag der Tiefenwirkung des Wortes.
1912/1913 bedurfte der Film des nobilitierenden Wortes in Gestalt literarischer Vorlagen, um sich endlich als gesellschaftsfähiger Autorenfilm - aller jahrmärktlichen Zuckerwatten- und Bratwurstgerüche entledigt - einzureihen in das Pantheon der Künste (wenn auch nur als ‚Siebente Kunst‘) – die Einschätzung visueller Unzulänglichkeit setzte sich bis in die Mitte der 80er Jahre besonders in der Debatte um das Phänomen von Literaturverfilmungen fort: Der Film sei dem Original treu, weil sich dessen Kunst- und Autonomiestatus noch nicht hinlänglich erwiesen habe. Was jedoch, wenn das literarische Original sich selbst gegenüber nicht treu zu sein vermag?
Die öffentliche Meinung hält bis heute unbeirrt an der Borniertheit eines Urteils fest, das das sogenannte ‚Gerechtwerden‘ eines Mediums mit einem anderen in den Mittelpunkt seiner Unmöglichkeit stellt.
Die Respektabilität des Konzeptes der ‚Original– oder Werktreue‘ verstellt den Blick auf die Frage: Wem oder was gegenüber kann und soll der Film im Bewußtsein medialer Differenzen treu sein?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Vom Ende der Original- oder Werktreue
- 2. Konturierung eines methodischen Neuanfangs: Leitfaden - Methodenmodell und Vorstellung des Prozeẞ-Materials
- I. Methodentheorie: Die Grammatik der Transformation
- 1. Zur Analyse von Erzählstrukturen: „Die Erzählung beginnt mit der Geschichte der Menschheit“
- 1.1 Die Beschreibungsebene der Handlungen: Inhalt, Aufbau und Funktionen der Handlung
- 1.2 Die Beschreibungsebene der Personen: Transformationstendenzen
- 1.2.1 Die Figur als Subjekt oder Objekt der Handlung: Dramatisches und episches Erzählen im Film
- 2. Literarische und filmische Erzähltechniken: Auf der Suche nach filmischen Äquivalenzen
- 2.1 Der kinematographische Code: Grenzen und Möglichkeiten filmischer Darstellungsmittel
- 2.1.1 Perspektivenbildung durch Kamerahandlung: „Es kümmert, wer da spricht...“
- 2.1.1.1 Subjektivierende und objektivierende Darstellungsformen im Film
- 2.1.2 Mise-en-scène: Die Inszenierung innerhalb der Einstellung
- 2.1.3 Die Inszenierung zwischen den Einstellungen: Die Montage
- 2.1.3.1 Der Montageroman: Eine ultra-kinematographische Schreibweise
- 2.2 Der filmische Code
- 2.2.1 Die Inszenierung im Ohr: Der Tonkanal
- 3. Intertextualitätsspuren
- 3.1 Universale und spezifische Intertextualität
- 3.1.1 Gérard Genettes Theorie der Intertextualität
- II. Analyse: Der Horizont der Texte
- 1. Erzählstrukturen in Kafkas Roman Der Proceẞ
- 1.1 Inhalt, Aufbau und Funktionen der Handlung: Ein zusammenhangloses Ganzes
- 1.1.1 Konfrontation zweier Ordnungen: K. und das Gericht – Handlungsverfremdungen
- 1.1.2 Die Temporalstruktur im Proceẞ
- 1.1.3 Funktionen der Handlung
- 1.2 Personen: Figurenzeichnung – Verfremdungen
- 1.2.1 Über abgespaltene Ichs und Figurenhüllen
- 1.2.2 Josef K.: Die Konstruktion einer Funktion
- 1.2.2.1 K.s Bewußtseinsstrukturen: Zerstreutheit und Täuschung
- 1.2.3 Nebenfiguren als Figurenserien: Frauen und Kollektive
- 2. Grundfiguren der Erzählweise Kafkas: Die Selbstverständlichkeit des Ungeheuerlichen in Der Proceẞ
- 2.1 Kafkas Erzähltechnik: Einsinnigkeit versus Polyperspektivismus – das Phänomen der Unbestimmtheit
- 2.2 Paradoxie, Metaphorik, das Ineinander von Innen und Außen
- 2.2.1 Ich und Sprache: Die Schwierigkeit mit den Metaphern
- 3. Intertextualitätsthesen: Von, beißenden' Büchern und mimetischen Rückbezügen
- 3.1 Mimetismus
- 3.1.1 Der Brief-Prozeß: Felice Bauer
- 3.1.2 Ein Blutsverwandter: Heinrich von Kleist
- 4. Erzählstrukturen in Welles' Film The Trial
- 4.1 Inhalt, Aufbau und Funktionen der Handlung: Nähe in der Distanz – Inversionen: Eine allgegenwärtige Ordnung – Macht als soziale Kritik
- 4.1.1 Umsetzungsstrategien: Selektion - Konzentration
- 4.1.2 Die Temporalstruktur in The Trial
- 4.1.3 Funktionen der Handlung
- Die Transformation von Erzählstrukturen
- Die Erforschung von filmischen Äquivalenzen für literarische Elemente
- Die Bedeutung von Intertextualität in der Literaturverfilmung
- Die Analyse von Kafkas Roman „Der Proceß“ und Welles' Film „The Trial“
- Die Anwendung der „Grammatik der Transformation“ als methodisches Werkzeug
- Einführung: Diese Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die methodische Vorgehensweise. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Analyse von Literaturverfilmungen und führt die Relevanz eines neuen methodischen Ansatzes ein, der sich auf die „Grammatik der Transformation“ stützt.
- 1. Vom Ende der Original- oder Werktreue: Dieses Kapitel problematisiert den Begriff der „Werktreue“ in der Literaturverfilmung und zeigt die Notwendigkeit auf, von diesem traditionellen Konzept abzugehen. Es betont die eigenständige filmische Sprache und die Notwendigkeit einer neuen Methode zur Analyse von Adaptionen.
- 2. Konturierung eines methodischen Neuanfangs: Leitfaden - Methodenmodell und Vorstellung des Prozeẞ-Materials: Dieses Kapitel präsentiert die methodische Grundlage der Arbeit und stellt das konkrete Studienmaterial vor. Es erläutert die „Grammatik der Transformation“ als ein Werkzeug zur Analyse von Erzählstrukturen in der Literaturverfilmung und gibt einen Einblick in das gewählte Beispiel, Kafkas „Der Proceß“ und Welles' „The Trial“.
- I. Methodentheorie: Die Grammatik der Transformation: Der erste Teil der Analyse konzentriert sich auf die Entwicklung einer theoretischen Grundlage für die Analyse von Erzählstrukturen in der Literaturverfilmung. Es werden verschiedene Aspekte von Erzählstrukturen und filmischen Adaptionen behandelt, um ein umfassendes Methodenmodell zu entwickeln.
- 1. Zur Analyse von Erzählstrukturen: „Die Erzählung beginnt mit der Geschichte der Menschheit“: Dieses Kapitel geht der Frage nach, wie Erzählstrukturen analysiert werden können. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, um den Inhalt, Aufbau und die Funktionen von Handlung und Figuren in literarischen und filmischen Werken zu beschreiben.
- 2. Literarische und filmische Erzähltechniken: Auf der Suche nach filmischen Äquivalenzen: Dieses Kapitel befasst sich mit den spezifischen Eigenschaften von literarischen und filmischen Erzähltechniken. Es untersucht die Möglichkeiten und Grenzen filmischer Darstellungsmittel, um die ästhetische Wirkung von Literatur im Film zu realisieren.
- 3. Intertextualitätsspuren: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Intertextualität in der Literaturverfilmung. Es analysiert die verschiedenen Ebenen und Formen der Intertextualität und stellt deren Bedeutung für die Interpretation von Adaptionen heraus.
- II. Analyse: Der Horizont der Texte: Der zweite Teil der Analyse befasst sich mit der Anwendung der entwickelten methodischen Grundlagen auf das konkrete Studienmaterial. Es werden die Erzählstrukturen in Kafkas „Der Proceß“ und Welles' „The Trial“ detailliert analysiert.
- 1. Erzählstrukturen in Kafkas Roman Der Proceẞ: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse der Erzählstrukturen in Kafkas Roman „Der Proceß“. Es beleuchtet den Inhalt, den Aufbau und die Funktionen der Handlung sowie die Figurenzeichnung und die spezifischen Merkmale von Kafkas Erzählweise.
- 2. Grundfiguren der Erzählweise Kafkas: Die Selbstverständlichkeit des Ungeheuerlichen in Der Proceẞ: Dieses Kapitel geht genauer auf die spezifischen Aspekte von Kafkas Erzähltechnik ein. Es analysiert die besonderen Elemente von Kafkas Prosa, wie die Paradoxie, die Metaphorik und die Vermischung von Innen- und Außenwelt.
- 3. Intertextualitätsthesen: Von, beißenden' Büchern und mimetischen Rückbezügen: Dieses Kapitel untersucht die Intertextualität in Kafkas „Der Proceß“ und zeigt die Verbindungen zu anderen Werken und literarischen Strömungen auf. Es werden insbesondere die Beziehungen zu Felice Bauer und Heinrich von Kleist hervorgehoben.
- 4. Erzählstrukturen in Welles' Film The Trial: Dieses Kapitel analysiert die Erzählstrukturen in Welles' Film „The Trial“ und setzt sie in Bezug zu Kafkas Roman. Es untersucht die Umsetzung von literarischen Elementen in die filmische Sprache und beleuchtet die spezifischen filmischen Mittel, die Welles zur Darstellung der Handlung und der Figuren verwendet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Analyse von Erzählstrukturen in der Literaturverfilmung, wobei sie den Fokus auf die Transformationsprozesse von der literarischen Vorlage zum filmischen Werk legt. Die Untersuchung betrachtet das Verhältnis von Original und Adaption und entwickelt ein methodisches Vorgehen, um die spezifischen Herausforderungen der filmischen Umsetzungsarbeit zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Literaturverfilmung, Erzählstrukturen, filmische Äquivalenzen, Intertextualität, Transformationsprozesse, „Grammatik der Transformation“, Franz Kafka, „Der Proceß“, Orson Welles, „The Trial“, und die Analyse von Adaptionen. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen bei der filmischen Umsetzung literarischer Werke und liefert einen Beitrag zur Diskussion über die Eigenständigkeit von Adaptionen.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter der „Grammatik der Transformation“ verstanden?
Es handelt sich um ein methodisches Werkzeug zur Analyse, wie literarische Erzählstrukturen in filmische Formen übersetzt und angepasst werden.
Warum wird das Konzept der „Werktreue“ kritisch hinterfragt?
Die Arbeit argumentiert, dass der Film eine eigenständige Kunstform ist. Das starre Konzept der Werktreue ignoriert die medialen Differenzen und die notwendige künstlerische Freiheit bei der Adaption.
Welche Werke dienen als Fallbeispiele für die Analyse?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Franz Kafkas Roman „Der Proceß“ und dessen filmische Umsetzung „The Trial“ von Orson Welles.
Was sind filmische Äquivalenzen in der Literaturverfilmung?
Das sind filmische Mittel (wie Kameraeinstellung, Montage oder Ton), die versuchen, die ästhetische Wirkung oder Bedeutung eines literarischen Elements visuell und auditiv umzusetzen.
Welche Rolle spielt Intertextualität in dieser Arbeit?
Intertextualität hilft zu verstehen, wie Texte und Filme auf andere Werke Bezug nehmen (z.B. Kafkas Bezug zu Kleist), und wie diese Bezüge die Interpretation der Adaption beeinflussen.
Wie unterscheidet sich die Zeitstruktur in Kafkas Roman von Welles' Film?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Inversionen und Umsetzungsstrategien wie Selektion und Konzentration, die Welles nutzte, um Kafkas komplexe Temporalstruktur filmisch darzustellen.
- Quote paper
- Jasmin Hermann (Author), 2001, Literaturverfilmung und die Grammatik der Transformation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24168