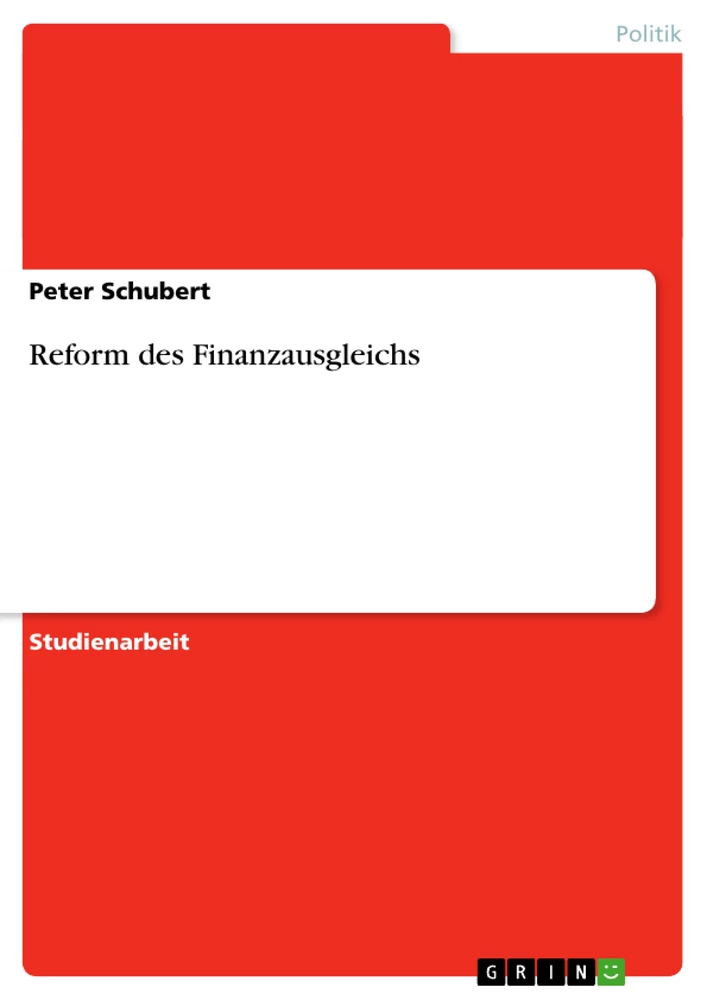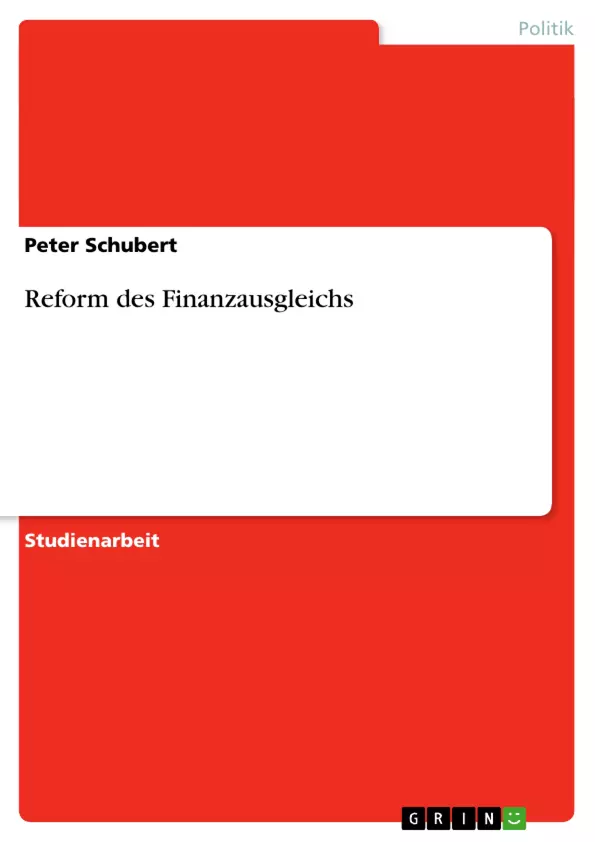[...] Dies wäre an sich nicht weiter verwundernswert, stellt dieser doch den „Kern der
bundesstaatlichen Ordnung dar“1, in dem sich entscheidet, ob die den Ebenen im Grundgesetz
zugedachten Aufgaben auch hinreichend ausgeführt werden können. Daher herrscht bei
sämtlichen politischen Kräften nahezu Konsens, dass eine Reform des
Länderfinanzausgleichs notwendig sei. Allerdings führten diese Bemühungen bisher zu
keinem grundsätzlich neuartigen Kompromiss. Im Gegenteil, geringfügig verändert wird der
Ausgleich bis 2019 fortgesetzt. Eine Hausarbeit, die die Reformüberlegungen zum Finanzausgleich thematisiert, muss daher notwendig auch nach der Realisierbarkeit von Reformvorhaben fragen und Gründe für die Diskrepanz zwischen Reformwillen und mangelnder Reformbereitschaft suchen. Dazu soll in einem ersten Schritt das momentane System des Länderfinanzausgleichs dargestellt, im
zweiten Kapitel die Reformüberlegungen systematisiert werden, um schließlich nach Gründen
für die Starre der Handelnden zu fragen. Im Mittelpunkt dieses ersten Kapitels steht die Darstellung des Finanzausgleichs im weitem Sinn. Dazu ist es allerdings nötig zuerst die Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern
knapp zu skizzieren, da diese die Grundlage für die Verteilung der Gelder sowohl in
horizontaler als auch in vertikaler Ebene bildet. Die Fragen, wer macht die Steuergesetze und wie werden die Steuern verteilt, werden im
Grundgesetz hauptsächlich in den Absätzen 104a – 106, sowie 72 behandelt.
Artikel 105 regelt dabei die Gesetzgebungskompetenz. Aus diesem Artikel folgt, dass der
Bund zwar nur die „ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über Zölle und
Finanzmonopole“2 innehat, allerdings eröffnet ihm Absatz 2 in Zusammenhang mit Artikel 72
Absatz 2 die Möglichkeit in den Bereichen der konkurrierenden Gesetzgebung Steuergesetze
zu erlassen, wenn „ihm das Aufkommen dieser Steuern ganz oder zum Teil zusteht“3, bzw. in
diesen Bereichen: „ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung besteht, weil [...] 3. die
Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung der Einheitlichkeit
der Lebensverhältnisse über das Gebiet des Landes hinaus sie erfordert“.4 [...] 1 Vgl. Ute Wachendorfer-Schmidt: Politikverflechtung im vereinigten Deutschland, Wiesbaden 2003, Seite 191. 2 Vgl. Artikel 105 Absatz 1 GG. 3 Vgl. Artikel 105 Absatz 2 GG. 4 Vgl. Artikel 72 Absatz 2 GG, die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse wurde 1994 durch Gleichwertigkeit ersetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist? Der Finanzausgleich im Grundgesetz
- Die Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern
- Der Finanzausgleich
- Der Ausgleich der Steuerkraft
- Finanzkraft und Finanzbedarf
- Der horizontale Finanzausgleich
- Der vertikale Finanzausgleich
- Die Finanzverfassung
- Was sein soll? – Kritik und Reform des Finanzausgleichs
- Kritik am Finanzausgleich
- Optionen für eine Reform des Finanzausgleichs
- Warum es ist? Das Scheitern von Reformansätzen
- Die Verflechtungsfalle
- Reform trotz Verflechtung?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Reform des Finanzausgleichs in der Bundesrepublik Deutschland. Sie beleuchtet die Kritik am bestehenden System, untersucht die Optionen für eine Reform und analysiert die Gründe für das bisherige Scheitern von Reformansätzen. Dabei wird die Frage nach der Realisierbarkeit von Reformvorhaben im Vordergrund stehen.
- Das System des Länderfinanzausgleichs und seine Kritikpunkte
- Mögliche Reformansätze und ihre Herausforderungen
- Die Verflechtungsfalle und ihre Auswirkungen auf Reformbemühungen
- Die Diskrepanz zwischen Reformwillen und mangelnder Reformbereitschaft
- Die Rolle der Finanzverfassung im föderativen System
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Was ist - Der Finanzausgleich im Grundgesetz
Dieses Kapitel erläutert den Finanzausgleich im weiten Sinn und beleuchtet die Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern. Es skizziert die grundlegenden Regelungen des Grundgesetzes zur Steuergesetzgebung und zur Verteilung des Steueraufkommens. Dabei werden die verschiedenen Steuerarten, ihre Aufteilung zwischen Bund und Ländern sowie die Prinzipien des horizontalen und vertikalen Finanzausgleichs beschrieben.
Kapitel 3: Was sein soll? – Kritik und Reform des Finanzausgleichs
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Kritik am bestehenden Finanzausgleich und präsentiert verschiedene Reformoptionen. Es beleuchtet die Argumente für eine Reform und diskutiert verschiedene Konzepte zur Neugestaltung des Systems.
Kapitel 4: Warum es ist? Das Scheitern von Reformansätzen
In diesem Kapitel werden die Ursachen für das bisherige Scheitern von Reformansätzen untersucht. Die Verflechtungsfalle, die durch die enge Verzahnung der Finanzsysteme von Bund und Ländern entsteht, wird als ein wesentlicher Grund für die Reformblockade identifiziert.
Schlüsselwörter
Finanzausgleich, föderale Finanzordnung, Steuerverteilung, Steuerkraft, Finanzbedarf, horizontaler und vertikaler Finanzausgleich, Reform, Verflechtungsfalle, Reformwillen, Reformbereitschaft, Grundgesetz, Bundesrat, Länder, Bund.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernproblem des Länderfinanzausgleichs?
Das System wird oft kritisiert, weil es wenig Anreize für Geberländer bietet, ihre Einnahmen zu steigern, und Empfängerländer teilweise in eine Abhängigkeit führt.
Was bedeutet "Verflechtungsfalle"?
Es beschreibt eine Situation, in der notwendige Reformen blockiert werden, weil Bund und Länder so eng miteinander verzahnt sind, dass kein Akteur ohne den anderen grundlegende Änderungen durchsetzen kann.
Was ist der Unterschied zwischen horizontalem und vertikalem Finanzausgleich?
Horizontaler Ausgleich findet direkt zwischen den Bundesländern statt, während vertikaler Ausgleich die Verteilung der Mittel zwischen Bund und Ländern bezeichnet.
Warum scheitern Reformansätze trotz breitem Konsens?
Oft fehlt die konkrete Reformbereitschaft, da einzelne Akteure befürchten, durch Neuregelungen finanziell schlechter gestellt zu werden als im aktuellen System.
Welche Rolle spielt das Grundgesetz im Finanzausgleich?
Die Artikel 104a bis 106 GG legen die Gesetzgebungskompetenzen und die Verteilung der Steuereinnahmen fest und bilden damit das rechtliche Fundament der Finanzverfassung.
- Quote paper
- Peter Schubert (Author), 2003, Reform des Finanzausgleichs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24207