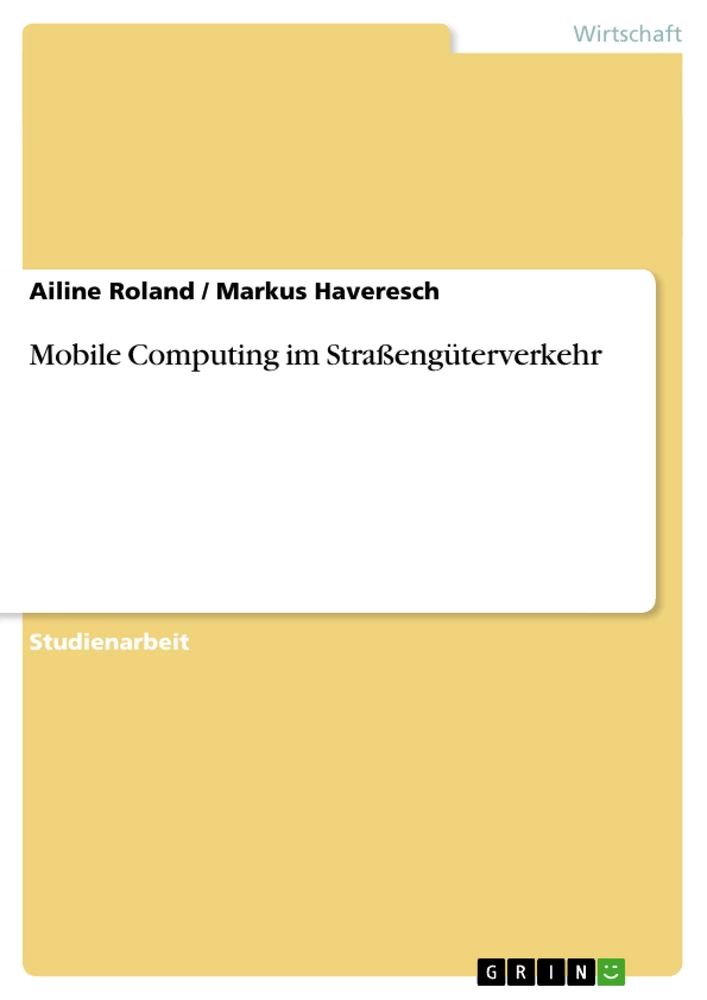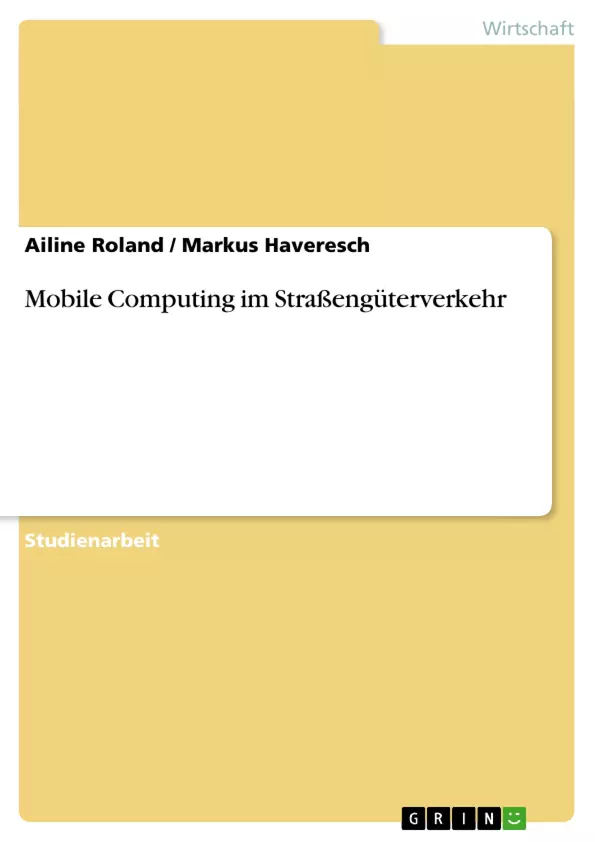Wie bereits eingangs erwähnt, soll ein konventionelles Speditionsunternehmen
betrachtet werden, das sich über Technik und Einsatzmöglichkeiten des Mobile
Computing informieren möchte. Dazu ist zunächst erforderlich den Begriff der Spedition näher zu erläutern.
„Eine Spedition besorgt alle Arbeiten, die mit der Güterbeförderung, mit der Lagerung
und dem Güterumschlag zusammenhängen. Das Aufgabengebiet umfasst den
Abschluss, die Abwicklung und Überwachung von Frachtverträgen und anderen
Verträgen, den Empfang und die Weiterleitung von Gütern sowie eine
unüberschaubare Zahl von damit verbundenen Dienstleistungen.“4
Das hier gewählte fiktive Beispiel eines Speditionsunternehmen trägt den Namen
„Speedy GmbH“, hat ca. 45 Mitarbeiter und 20 Sattelzugmaschinen.
Es handelt sich bei dem ausgewählten Fall also um eine mittelständische Spedition,
wie sie überall in Deutschland vertreten sein könnte. Um das Beispiel auch hinreichend konkret zu gestalten, werden noch zusätzliche Angaben gemacht: Die Firma „ Speedy GmbH“ mit Sitz in Duisburg fährt täglich für ihren Großkunden
„VIPwagen AG“ Stahlcoils5 von der„Stahl AG“ Duisburg zum VIPWagenwerk nach
Wolfsburg. Natürlich hat das Speditionsunternehmen noch weitere Kunden, für die sie sowohl
Komplett- als auch Teilladungen organisiert. Um Feiertage, Anlieferverzögerungen und ähnliche Zwischenfälle überbrücken zu können, unterhält „Speedy“ außerdem noch ein kleines Umschlagslager.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die Firma „Speedy“
- 2.1 Vorstellung der Firma
- 2.2 Typischer Auftrag der Speedy
- 2.3 Grobablauf der speditionellen Bearbeitung
- 2.3.1 Auftragsannahme und Disposition
- 2.3.2 Erstellung der Ladungspapiere und Durchführung des Transports
- 2.3.3 Anlieferung und Abrechnung
- 3. Mobile Computing am Beispiel des genannten Transports
- 3.1 Definition: Was heißt überhaupt Mobile Computing (bzw. Telematik)?
- 3.2 Voraussetzungen für den Einsatz von „Mobile Computing“ im Straßengüterverkehr
- 3.2.1 Anbieter von Systemen (Systemlösungen)
- 3.2.2 Technische Anforderungen
- 3.2.2.1 Fahrzeug
- 3.2.2.2 Büro
- 3.2.2.3 Wissen
- 3.2.2.4 Kompatibilität
- 3.3 Disposition
- 3.4 Durchführung des Transportes
- 3.4.1 Klassische Durchführung des Transportes
- 3.4.2 Durchführung unter Nutzung der Möglichkeiten des „Mobile Computing“
- 3.5 Anlieferung - Abrechnung
- 4. Kosten - Nutzen Analyse
- 5. weiterführende Betrachtungen
- 5.1 Analysemöglichkeiten
- 5.2 Probleme und Chancen innerhalb der Spedition
- 5.3 Digitale Abrechnung der Mautgebühren für LKW auf Autobahnen
- 5.4 Automatisches Notrufsystem
- 5.5 Zukunftsperspektive
- 5.6 Die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Mobile Computing im Straßengüterverkehr“ analysiert die Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen von Mobile-Computing-Technologien im Transportwesen. Dabei wird der Fokus auf die Optimierung der logistischen Prozesse eines Speditionsunternehmens gelegt.
- Einführung in die Thematik des Mobile Computing im Straßengüterverkehr
- Vorstellung des fiktiven Speditionsunternehmens „Speedy“ und dessen typischer Arbeitsabläufe
- Analyse der technischen Voraussetzungen und Herausforderungen für den Einsatz von Mobile Computing in der Speditionsbranche
- Untersuchung des Einflusses von Mobile Computing auf verschiedene Phasen des Transportprozesses (Disposition, Durchführung, Anlieferung, Abrechnung)
- Bewertung der Kosten und Nutzen von Mobile Computing im Straßengüterverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik des Mobile Computing im Straßengüterverkehr und stellt den Kontext der digitalen Transformation in der Speditionsbranche dar. Im Anschluss wird das fiktive Speditionsunternehmen „Speedy“ vorgestellt und ein typischer Transportauftrag analysiert. Der Fokus liegt auf den einzelnen Phasen des Transportablaufs, von der Auftragsannahme und Disposition bis zur Anlieferung und Abrechnung. In den folgenden Kapiteln werden die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von Mobile Computing im Straßengüterverkehr erläutert und die spezifischen Herausforderungen für Spediteure beleuchtet.
Im Fokus der Arbeit stehen die konkreten Auswirkungen von Mobile Computing auf verschiedene Phasen des Transportprozesses, insbesondere auf die Disposition, die Durchführung des Transports und die Anlieferung. Dabei werden die Vorteile und Herausforderungen der Integration von Mobile-Computing-Technologien in die Praxis detailliert dargestellt.
Das vorletzte Kapitel der Arbeit widmet sich einer Kosten-Nutzen-Analyse des Mobile Computing im Straßengüterverkehr. Hier werden die verschiedenen Kostenfaktoren und die potenziellen Einsparpotenziale von Mobile Computing in der Speditionsbranche gegenübergestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Mobile Computing im Kontext des Straßengüterverkehrs. Im Vordergrund stehen die konkreten Einsatzmöglichkeiten und die Auswirkungen von Mobile Computing auf die Prozesse eines Speditionsunternehmens. Die Arbeit analysiert dabei die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von Mobile Computing und zeigt die spezifischen Herausforderungen und Potenziale für die Branche auf. Wichtige Schlüsselbegriffe sind dabei Mobile Computing, Telematik, Spedition, Straßengüterverkehr, Disposition, Transport, Anlieferung, Abrechnung, Kosten-Nutzen-Analyse und digitale Transformation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Mobile Computing im Straßengüterverkehr?
Mobile Computing (oder Telematik) umfasst den Einsatz mobiler Kommunikationstechnologien zur Überwachung, Steuerung und Optimierung von Transportabläufen in Echtzeit.
Welche Vorteile bietet Mobile Computing für eine Spedition?
Es ermöglicht eine effizientere Disposition, bessere Überwachung der Frachtverträge, schnellere Abrechnung und eine verbesserte Kommunikation zwischen Büro und Fahrzeug.
Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Es werden entsprechende Systemlösungen für das Fahrzeug und das Büro benötigt, sowie technisches Wissen und Kompatibilität zwischen den verschiedenen Systemen.
Wie verändert Mobile Computing die Disposition?
Disponenten können Fahrzeuge präziser steuern, auf Verzögerungen sofort reagieren und Leerfahrten durch bessere Planung vermeiden.
Lohnt sich der Einsatz von Mobile Computing finanziell?
Eine Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass den Investitionskosten erhebliche Einsparpotenziale durch Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung gegenüberstehen.
- Quote paper
- Ailine Roland (Author), Markus Haveresch (Author), 2002, Mobile Computing im Straßengüterverkehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24216