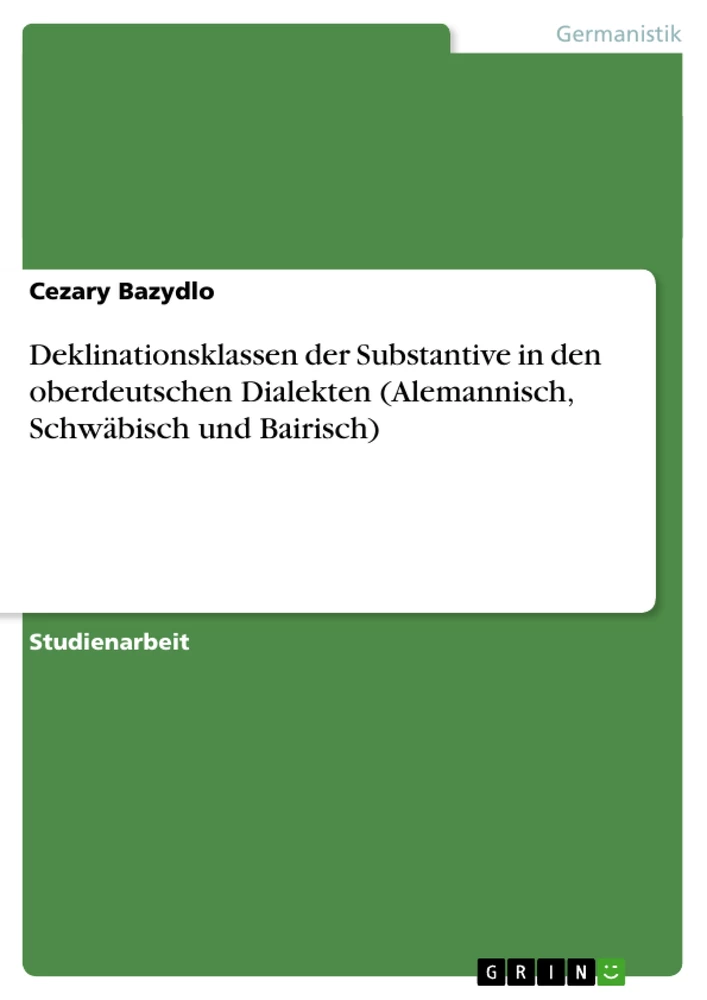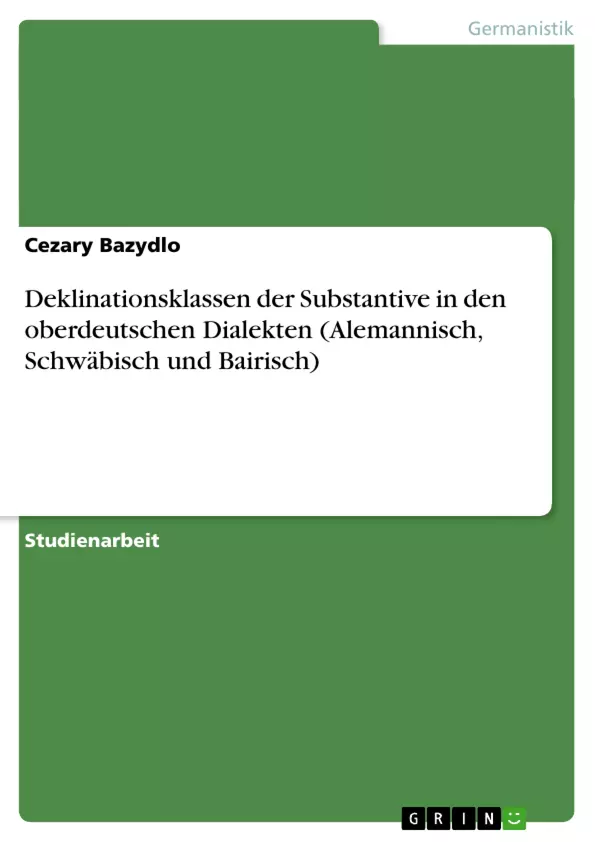Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Einteilung der oberdt. Dialekt-Substantive in Deklinationsklassen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, stelle ich im ersten Abschnitt die Grundlagen vor - die entsprechenden Einteilung der Substantive für das Mittel- und Neuhochdeutsche. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Mhd., das traditionellerweise als Grundlage für Erklärungen und historische Vergleiche in der Dialektologie dient.
Im zweiten Abschnitt wird, ausgehend von allgemeinen Eigenschaften der oberdt. Nominalflexion, eine Einteilung der Deklinationsklassen für das Alem., Schwäb. und Bair. vorgenommen. Die typischen Flexionsformen der jeweiligen Klassen werden anschließend mit nhd. Formen verglichen, und ihre Entwicklung wird anhand eines sorgfältig recherchierten Korpus bis ins Mhd. zurückverfolgt. Die herangezogenen Dialektgrammatiken benutzen sehr unterschiedliche Schreibweisen der Dialektwörter. Da die genauen Lautwerte der verwendeten Zeichen nicht präzise bestimmt werden konnten, war es nicht möglich, die Schreibweise der Belege in dieser Arbeit zu vereinheitlichen - es wurde in allen Fällen die Schreibweise der jeweiligen Quelle beibehalten. Eine Ausnahme bilden lediglich Belege aus Kollmer (1985): Vokale mit offener Aussprache werden durch einen Gravis (z.B. „è“), Vokale mit geschlossener Aussprache durch einen Akut (z.B. „é“) und alle nasalierten Vokale mit dem Zirkumflex (z.B. „â“) wiedergegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundlagen: Deklinationsklassen des Mittel- und Neuhochdeutschen
- 1.1. Deklinationsklassen des Mittelhochdeutschen
- 1.1.1. Traditionelle Einteilung nach Wortstämmen
- 1.1.2. Eine alternative Einteilung
- 1.2. Deklinationsklassen des Neuhochdeutschen
- 1.2.1. Traditionelle Einteilung in Anlehnung an Jacob Grimm
- 1.2.2. Neuere adäquate Einteilungen für das Neuhochdeutsche
- 1.1. Deklinationsklassen des Mittelhochdeutschen
- 2. Erörterung: Deklinationsklassen der Substantive in den oberdeutschen Dialekten
- 2.1. Grundeigenschaften der oberdeutschen Kasussysteme
- 2.2. Einteilung der Deklinationsklassen in den oberdeutschen Dialekten
- 2.3. Deklinationsklassen der oberdeutschen Substantive aus komparativer Sicht
- 2.3.1. Vergleich mit dem Neuhochdeutschen
- 2.3.2. Vergleich mit dem Mittelhochdeutschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Einteilung von Substantiven in Deklinationsklassen in den oberdeutschen Dialekten. Sie untersucht die Entwicklung der Deklination von der mittelhochdeutschen bis zur neuhochdeutschen Sprache und analysiert, wie diese Entwicklung sich in den oberdeutschen Dialekten (Alemannisch, Schwäbisch und Bairisch) zeigt.
- Entwicklung der Deklinationsklassen von Mittelhochdeutsch bis Neuhochdeutsch
- Charakterisierung der oberdeutschen Kasussysteme
- Einteilung der Deklinationsklassen in den oberdeutschen Dialekten
- Vergleich der Deklinationsklassen in den oberdeutschen Dialekten mit dem Neuhochdeutschen
- Vergleich der Deklinationsklassen in den oberdeutschen Dialekten mit dem Mittelhochdeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit vor. Kapitel 1 behandelt die Grundlagen der Deklinationsklassen des Mittel- und Neuhochdeutschen. Hier werden die traditionellen Einteilungen nach Wortstämmen vorgestellt und alternative Einteilungen diskutiert. Kapitel 2 erörtert die Deklinationsklassen der Substantive in den oberdeutschen Dialekten. Zunächst werden die Grundeigenschaften der oberdeutschen Kasussysteme erläutert, anschließend erfolgt eine Einteilung der Deklinationsklassen in den oberdeutschen Dialekten. Im letzten Teil des Kapitels werden die oberdeutschen Deklinationsklassen aus komparativer Sicht betrachtet, wobei ein Vergleich mit dem Neuhochdeutschen und dem Mittelhochdeutschen durchgeführt wird.
Schlüsselwörter
Oberdeutsche Dialekte, Deklinationsklassen, Substantive, Nominalflexion, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Kasussystem, Vergleichende Sprachwissenschaft, Dialektologie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die oberdeutschen Dialekte?
Die oberdeutschen Dialekte umfassen im Wesentlichen das Alemannische, das Schwäbische und das Bairische. Sie zeichnen sich durch spezifische sprachliche Merkmale in der Lautung und Grammatik aus.
Warum ist das Mittelhochdeutsche (Mhd.) wichtig für die Dialektologie?
Das Mittelhochdeutsche dient traditionell als historische Vergleichsbasis, um die Entwicklung der Dialekte und deren Abweichungen von der neuhochdeutschen Standardsprache zu erklären.
Was untersucht die Arbeit im Bereich der Nominalflexion?
Die Arbeit untersucht, wie Substantive in den Dialekten dekliniert werden und in welche Klassen sie sich aufgrund ihrer Endungen und Kasusformen einteilen lassen.
Gibt es Unterschiede in der Einteilung der Deklinationsklassen?
Ja, es gibt traditionelle Einteilungen nach Wortstämmen (aus dem Germanischen) und neuere, adäquatere Ansätze, die sich stärker an den tatsächlichen Flexionsformen der Dialekte orientieren.
Welche Besonderheiten gibt es bei der Schreibung von Dialektwörtern?
Da es keine einheitliche Rechtschreibung für Dialekte gibt, nutzen verschiedene Quellen unterschiedliche Zeichen. Oft werden Akzente (z. B. é für geschlossene Aussprache) verwendet, um die genaue Lautung wiederzugeben.
- Citar trabajo
- Cezary Bazydlo (Autor), 2003, Deklinationsklassen der Substantive in den oberdeutschen Dialekten (Alemannisch, Schwäbisch und Bairisch), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24318