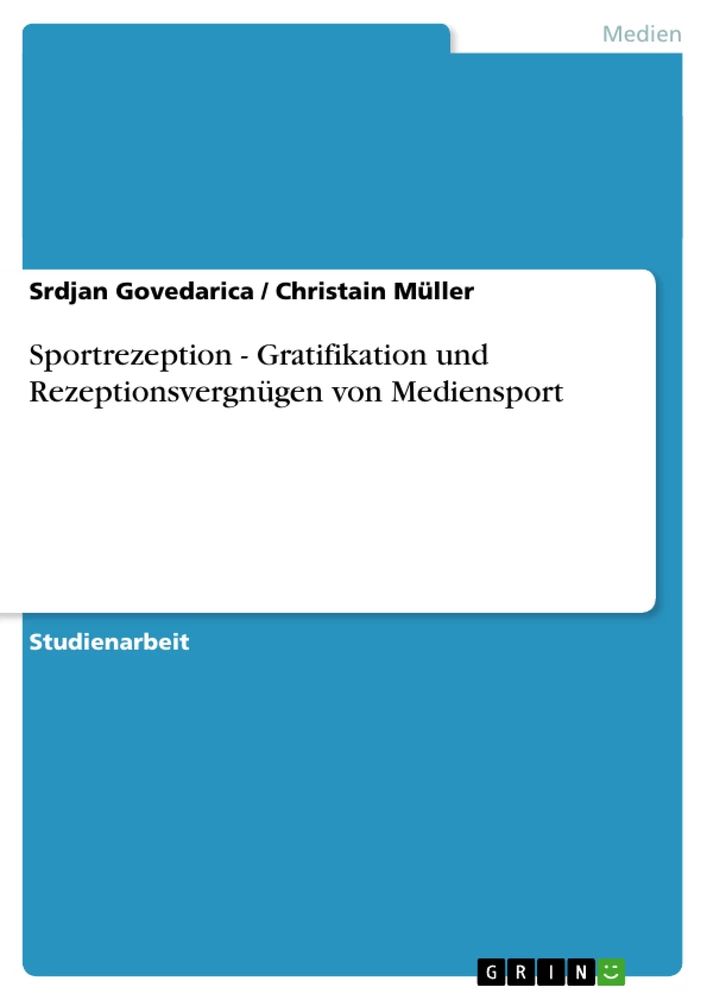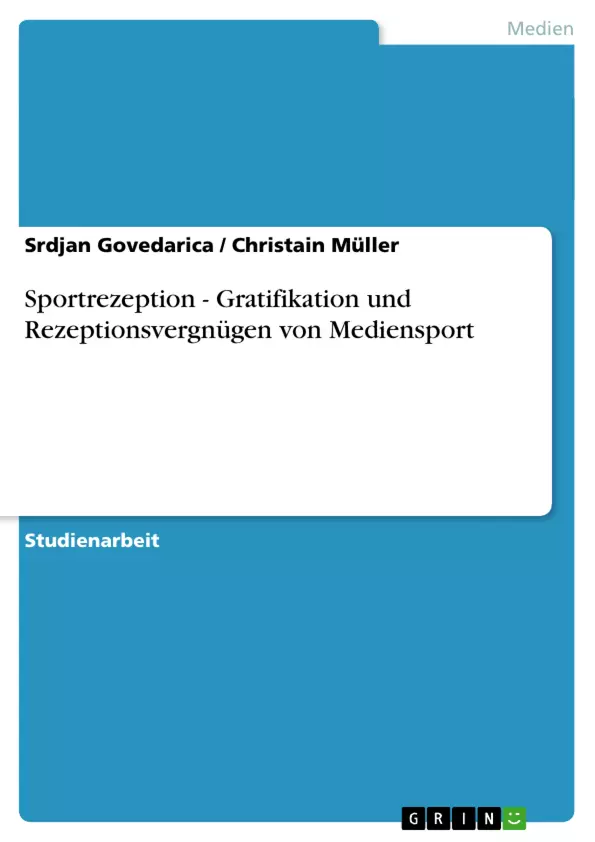Diese Arbeit soll der Frage nachgehen, warum mediale Sportereignisse weltweit eine so große Anziehungskraft ausüben. Dabei berücksichtigen wir insbesondere die Theorien „Mood Management“, „Exitation Transfer Theory“ und die „Affective Disposition Theory“ von Dolf Zillmann und prüfen, ob sich diese auch auf Sportsendungen übertragen lassen. Außerdem liegen dieser Arbeit die Texte „Mediensport als sozialer Ersatz“ von Otmar Weiß und „Sports on the screen“ von Bryant und Raney zugrunde. Während der Text von Brynat & Raney Mediensport unter besonderer Berücksichtung der Theorien von Zillmann betrachtet, enthält die Arbeit von Otmar Weiß einige interessant ergänzende Aspekte.
Nach der Vorstellung der einzelnen Theorien und Ansatzpunkte der Texte folgt ein Überblick über die Diskussion des Seminars. Anschließend geben wir ein Überblick über unsere Kritik, in der wir auf die einzelnen Bestandteile beider Texte eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Relevanz des Themas
- 3.0 Theoretische Erklärungsansätze von Bryant und Raney (3.1.-3.5.) sowie von Weiß (3.6.-3.9.)
- 3.1. Disposition Theory des Sportfanseins und die Bedeutung des Spielausgangs
- 3.2. Drama in Sportprogrammen
- 3.3. Die Rolle der Spannung in der Sportunterhaltung
- 3.4. Neuartige, riskante und effektive Spielzüge
- 3.5. Genderspezifische Unterschiede in der Sportrezeption
- 3.6. Mediensport als pseudosoziale Kommunikation
- 3.7. Sportler als Idole
- 3.8. Mediensport als Vermittler von gesellschaftlichen Normen und Werten
- 3.9. Mediensport als gemäßigte Affektivität und dosierte Spannung
- 4.0 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum mediale Sportereignisse weltweit eine so große Anziehungskraft ausüben. Sie analysiert die Theorien "Mood Management", "Exitation Transfer Theory" und "Affective Disposition Theory" von Dolf Zillmann und untersucht deren Übertragbarkeit auf Sportsendungen. Außerdem werden die Texte "Mediensport als sozialer Ersatz" von Otmar Weiß und "Sports on the screen" von Bryant und Raney herangezogen. Die Arbeit stellt die einzelnen Theorien und Ansätze der Texte vor, gibt einen Überblick über die Diskussion des Seminars und präsentiert anschließend eine kritische Analyse der einzelnen Bestandteile beider Texte.
- Rezeption und Bedeutung von Mediensport
- Theoretische Ansätze zur Erklärung der Sportrezeption
- Die Rolle von Spannung und Drama in Sportprogrammen
- Genderspezifische Unterschiede in der Sportrezeption
- Mediensport als sozialer Ersatz und Vermittler von Werten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den Hintergrund der Untersuchung. Kapitel 2 beleuchtet die Relevanz des Themas, indem es die enormen Zuschauerzahlen von Sportübertragungen im Vergleich zu "nonmediativen" Sportveranstaltungen herausstellt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den theoretischen Erklärungsansätzen von Bryant und Raney sowie von Weiß. Hierbei werden insbesondere die "Disposition Theory" des Sportfanseins, die Rolle von Spannung und Drama in Sportprogrammen, sowie die Bedeutung von Genderspezifischen Unterschieden in der Sportrezeption beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sportrezeption, Mediensport, Disposition Theory, Mood Management, Exitation Transfer Theory, Affective Disposition Theory, Spannung, Drama, Genderspezifische Unterschiede, Sozialer Ersatz, Gesellschaftliche Normen und Werte.
Häufig gestellte Fragen
Warum schauen Menschen so gerne Sport im Fernsehen?
Theorien wie „Mood Management“ und „Disposition Theory“ erklären, dass Zuschauer durch die Identifikation mit Teams und die Spannung des Spielausgangs ihre Emotionen regulieren.
Was ist die „Affective Disposition Theory“?
Sie besagt, dass das Vergnügen am Zuschauen davon abhängt, ob eine gemochte Partei gewinnt oder eine nicht gemochte Partei verliert.
Kann Mediensport soziale Kontakte ersetzen?
Otmar Weiß beschreibt Mediensport als „pseudosoziale Kommunikation“, die als Ersatz für reale soziale Bindungen fungieren kann.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Sportrezeption?
Die Arbeit untersucht genderspezifische Unterschiede in den Motiven und der Art des Vergnügens beim Konsum von Sportmedien.
Welche Rolle spielt Spannung (Suspense) in Sportübertragungen?
Spannung ist ein zentraler Faktor für das Rezeptionsvergnügen; sie entsteht durch die Ungewissheit des Ausgangs und das dramatische Potenzial des Wettkampfs.
- Quote paper
- Srdjan Govedarica (Author), Christain Müller (Author), 2002, Sportrezeption - Gratifikation und Rezeptionsvergnügen von Mediensport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24333