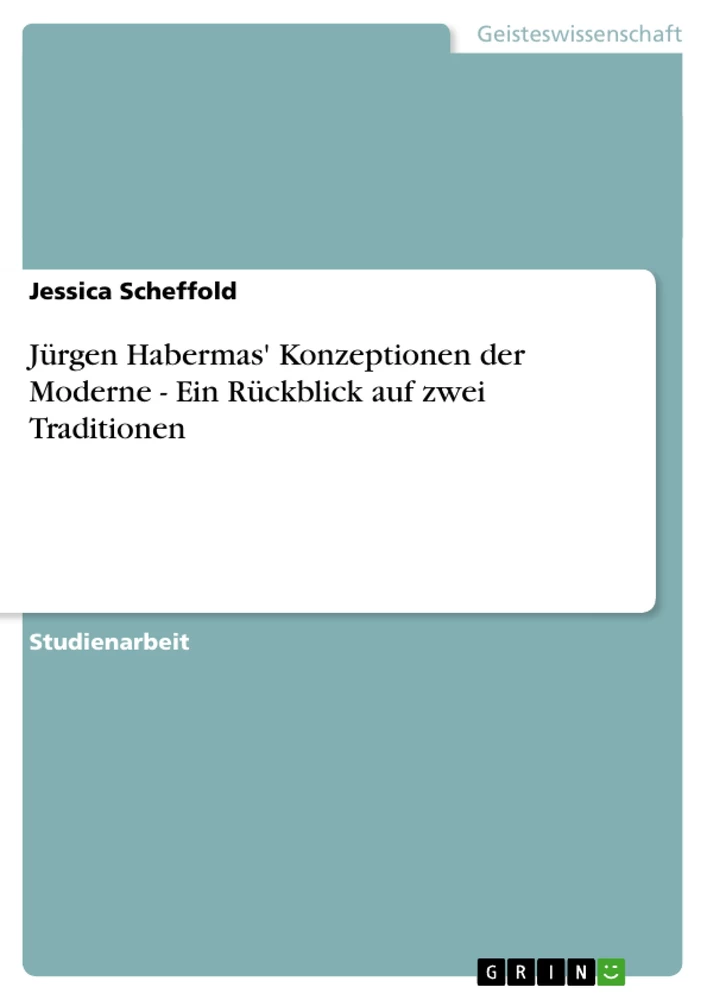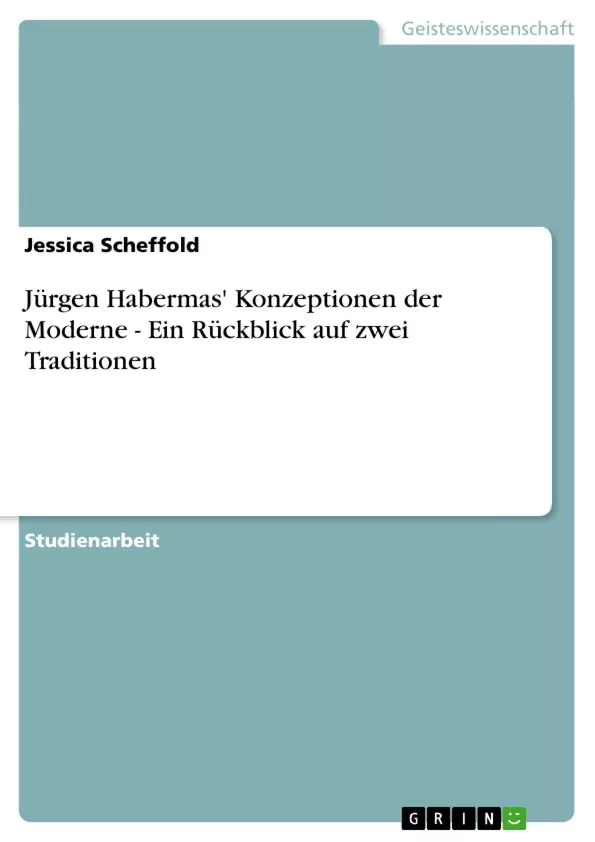Bevor der prägende Leitbegriff „Moderne“ und dessen Darstellung in Habermas‘ Vortragstext eingehend untersucht werden kann, sind zunächst die Definitionen aufgeführt.
Definition „Moderne“: (frz.), Ursprüngliche Bezeichnung für den Naturalismus, dann für jede moderne Richtung der Kunst, auch allgemein moderner (Zeit-) Geist.
Definition „Postmoderne“: (lat.), kulturgeschichtliche Epoche nach der Moderne. [...] Als Usprung der Postmoderne gelten die künstlerischen und politischen Umbrüche der 1960er Jahre in den USA. [...] Die Geschichte wird nicht mehr fortschrittsoptimistisch als zielgerichteter, auf einen höheren Zustand hinreifender Entwicklungsprozess verstanden, sondern als regellose Abfolge heterogener Ereignisse.
Die Philosophie bedient sich der Begriffe „Moderne“ und „Postmoderne“ um scheinbar epochal voneinander getrennte Zeitabschnitte zu definieren. Als Meta-Wissenschaft, die gleichsam verschiedene Disziplinen inkludiert oder aber zumindest instruiert, hat die Philosophie einen besonderen Stellenwert in der Wissenschaft. Sie dient zum einen der Beschreibung übergeordneter Zusammenhänge, weiterhin dem Schließen der (Wissens-)lücken, den andere hinterlassen. Zudem betrachtet sie die gebotenen Realitäten und prognostiziert daraus Szenarien der Zukunft.
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob -und inwieweit- wir im hier-und-jetzt in der Moderne oder der Postmoderne leben. Dazu wird der Artikel „Konzeption der Moderne, Ein Rückblick auf zwei Traditionen“ von Jürgen Habermas untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bearbeitung der Fragestellung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Jürgen Habermas beschäftigt sich mit der Frage, ob die Moderne zu Ende ist und wir in der Postmoderne leben. Der Autor untersucht die Konzeptionen der Moderne aus zwei unterschiedlichen Traditionen: der klassischen Moderne und der postmodernen Überwindung des normativen Selbstverständnisses.
- Die Entwicklung des Begriffs „Moderne“ und dessen Bedeutung im Kontext der Geschichte
- Die unterschiedlichen Sichtweisen auf die „Moderne“ von Philosophen wie Hegel, Marx und Weber
- Die Herausforderungen der Modernisierung für die Gesellschaft und die Folgen der Individualisierung
- Die Rolle von Vernunft und Tradition im Kontext der Modernisierung
- Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung definiert die Begriffe „Moderne“ und „Postmoderne“ und erläutert die Bedeutung der Philosophie für die Beschreibung und Analyse von Epochen. Sie stellt die Frage, ob wir in der Moderne oder der Postmoderne leben und kündigt die Untersuchung von Habermas' Artikel „Konzeption der Moderne, Ein Rückblick auf zwei Traditionen“ an.
Bearbeitung der Fragestellung
Dieses Kapitel analysiert Habermas' Darstellung der gesellschaftskritischen Sichtweisen bedeutender Philosophen und ordnet sie den Epochen „Moderne“ und „Postmoderne“ zu. Es werden die verschiedenen Definitionen von „Moderne“ und die Herausforderungen der Modernisierung für die Gesellschaft beleuchtet. Die Individualisierungstendenzen, die mit der Moderne einhergehen, werden diskutiert und ihre Auswirkungen auf die traditionellen Strukturen der Gesellschaft betrachtet.
Schlüsselwörter
Moderne, Postmoderne, Hegel, Marx, Weber, Individualisierung, Vernunft, Tradition, Gesellschaft, Gesellschaftskritik, Objektivation, Zukunft.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Jürgen Habermas den Begriff "Moderne"?
Habermas betrachtet die Moderne als ein noch nicht abgeschlossenes Projekt, das durch Vernunft, Aufklärung und das Streben nach Fortschritt gekennzeichnet ist.
Was ist der wesentliche Unterschied zur Postmoderne?
In der Postmoderne wird Geschichte nicht mehr als zielgerichteter Fortschrittsprozess verstanden, sondern als regellose Abfolge heterogener Ereignisse ohne festes Ziel.
Welche Rolle spielen Hegel, Marx und Weber in Habermas' Analyse?
Habermas greift auf deren gesellschaftskritische Sichtweisen zurück, um die Entwicklung und die Widersprüche des modernen Selbstverständnisses zu verdeutlichen.
Was bedeutet "Individualisierung" im Kontext der Moderne?
Die Moderne führt zu einer Lockerung traditioneller Bindungen, was dem Einzelnen mehr Freiheit, aber auch die Herausforderung der ständigen Selbstdefinition auferlegt.
Warum ist die Philosophie für diese Debatte so wichtig?
Als Meta-Wissenschaft beschreibt die Philosophie übergeordnete Zusammenhänge, schließt Wissenslücken und prognostiziert Szenarien für die zukünftige Gesellschaft.
- Quote paper
- Jessica Scheffold (Author), 2004, Jürgen Habermas' Konzeptionen der Moderne - Ein Rückblick auf zwei Traditionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24450