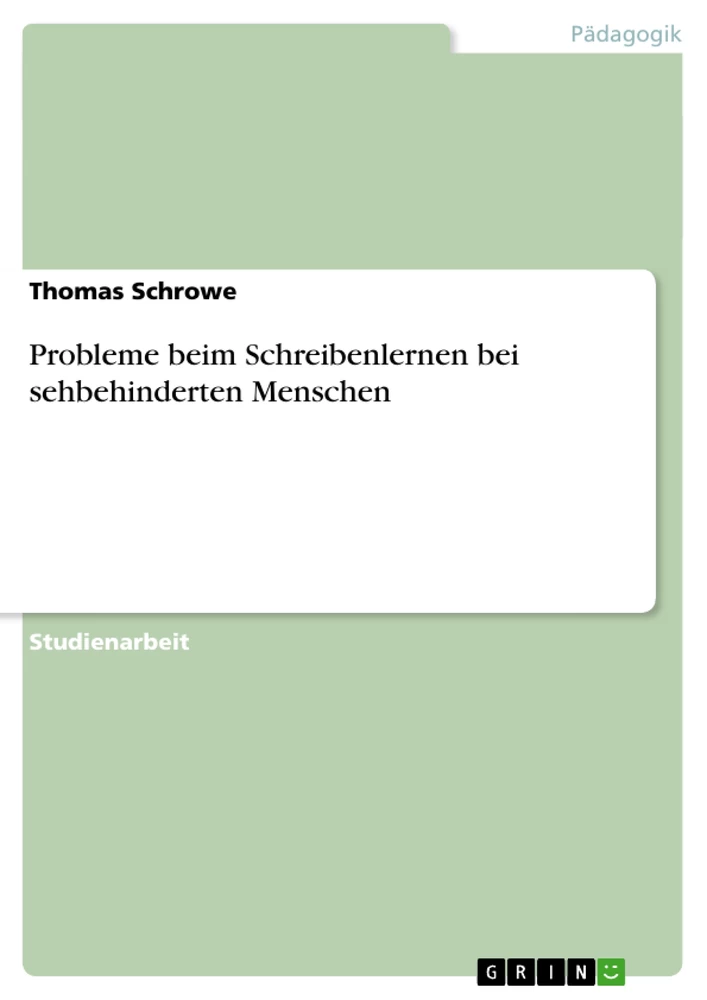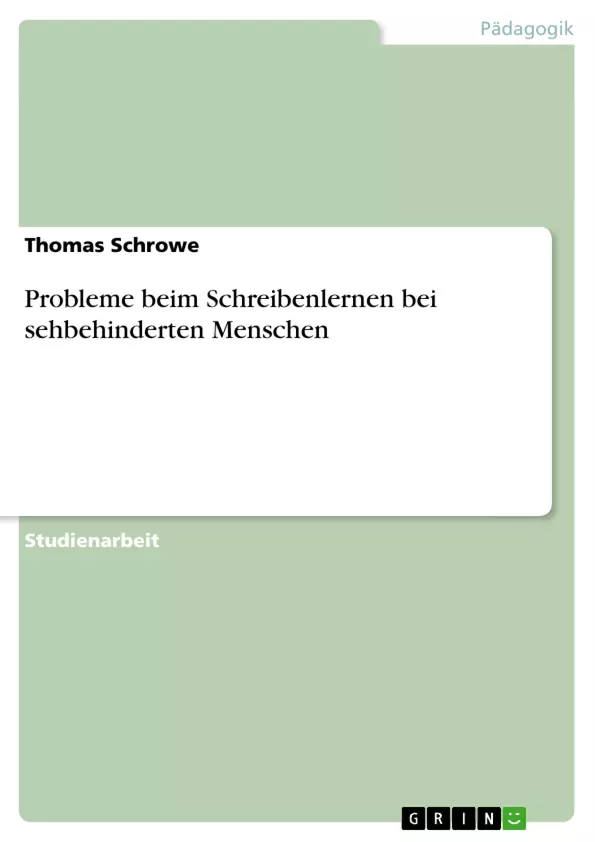In dieser Arbeit werde ich versuchen, verschiedene Probleme aufzeigen, die speziell bei Menschen
mit einem oder mehreren visuellen Defiziten entstehen, wenn es darum geht das
Schreiben zu erlernen. Ausgehen möchte ich dabei von allgemeinen Theorien zum Prozess
des Schriftspracherwerbs, da das Schreibenlernen unweigerlich ein Teil des Schriftsprache rwerbs
ist. Dazu erläutere ich ganz kurz die Bedeutung vom Lesen und Schreiben als Teile des
Schriftspracherwerbs und gehe weiter auf die dem Prozess des Schriftspracherwerbs vorgeschaltete
kindliche Situation ein. Die Modelle zum Schriftspracherwerbsprozess möchte ich
hier nicht weiter erörtern. Aber die Methoden des Schriftspracherwerbs nach HANS BRÜ-
GELMANN sind meiner Meinung nach doch nennenswert, wobei ich hier keine Beurteilung
zu den genannten Parten abgeben möchte, da dies das Thema der Arbeit sprengen würde.
Anschließend wäre es etwas zu abrupt, wenn ich gleich auf die Probleme des Schreibenle rnens
bei sehbehinderten Menschen eingehen würde, weil es für viele Menschen nur schwer
verständlich ist, wie sehbehinderte Menschen sehen und was eine Sehbehinderung überhaupt
ist. Daher möchte ich zuvor noch in einem weiteren Kapitel relativ kurz die drei klassischen
Klassifizierungen von sehbehinderten Menschen, eine Erläuterung zum Begriff des Visus’
und dann eine sehr kurze Beschreibung der häufigsten Sehbehinderungen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Schriftspracherwerb im Allgemeinen
- 2.1. Die Teilbereiche des Spracherwerbs
- 2.2. Die Situation des Kindes vor dem Schriftspracherwerb
- 2.3. Methoden des Schriftspracherwerbs (nach BRÜGELMANN)
- 2.3.1. Die ganzheitliche (analytische) Methode
- 2.3.2. Die einzelheitliche (synthetische) Methode
- 2.3.3. Der Spracherfahrungssatz
- 3. Sehbehinderungen
- 3.1. Definition der Grade
- 3.2. Visus und Sehvermögen
- 3.3. Die häufigsten Sehbehinderungen
- 3.3.1. Asthenopische Beschwerden
- 3.3.2. Augenzittern
- 3.3.3. Blendempfindlichkeit und Lichtscheu
- 3.3.4. Farbsinnstörung
- 3.3.5. Gesichtsfeldausfälle
- 3.3.6. Grauer Star
- 3.3.7. Grüner Star
- 3.3.8. Hornhauttrübungen oder -narben
- 3.3.9. Kurzsichtigkeit
- 3.3.10. Makulaerkrankungen
- 3.3.11. Netzhautablösung
- 3.3.12. Schielen
- 3.3.13. Sehnerverkrankungen
- 3.3.14. Weitsichtigkeit
- 4. Die verschiedenen Probleme für sehbehinderte Menschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die sehbehinderte Menschen beim Erlernen des Schreibens erfahren. Sie befasst sich mit den allgemeinen Theorien des Schriftspracherwerbs und stellt die Relevanz des Lesens und Schreibens als Bestandteile dieses Prozesses heraus. Die Arbeit befasst sich mit den Bedingungen, die das Schreibenlernen beeinflussen, und erörtert die Methoden des Schriftspracherwerbs nach HANS BRÜGELMANN.
- Schriftspracherwerb im Allgemeinen
- Methoden des Schriftspracherwerbs
- Definition und Klassifizierung von Sehbehinderungen
- Herausforderungen beim Schreibenlernen für Sehbehinderte
- Bedeutung von Visus und Sehvermögen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und skizziert den Aufbau. Kapitel 2 befasst sich mit dem Schriftspracherwerb im Allgemeinen, einschließlich der Bedeutung von Lesen und Schreiben als Bestandteile des Prozesses sowie der Bedingungen und Methoden des Schriftspracherwerbs. Kapitel 3 erläutert das Konzept der Sehbehinderung, definiert verschiedene Grade und beschreibt den Visus. Es bietet eine Übersicht über häufige Sehbehinderungen und deren Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Sehbehinderung, Visus, Lesen, Schreiben, Methoden des Schriftspracherwerbs, BRÜGELMANN, Ganzheitsmethode, Einzelheitsmethode, Spracherfahrungssatz, Sehbehinderungsgrade, Asthenopische Beschwerden, Augenzittern, Blendempfindlichkeit, Farbsinnstörung, Gesichtsfeldausfälle, Grauer Star, Grüner Star, Hornhauttrübungen, Kurzsichtigkeit, Makulaerkrankungen, Netzhautablösung, Schielen, Sehnerverkrankungen, Weitsichtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche spezifischen Probleme haben sehbehinderte Menschen beim Schreibenlernen?
Sehbehinderte Menschen stehen vor Herausforderungen bei der visuellen Erfassung von Schriftzeichen und der Auge-Hand-Koordination, was den Prozess des Schriftspracherwerbs erheblich erschweren kann.
Wie wird eine Sehbehinderung klassifiziert?
Es gibt drei klassische Einstufungen, die sich am Visus (Sehschärfe) und am Sehvermögen orientieren, um den Grad der Beeinträchtigung medizinisch und pädagogisch festzulegen.
Welche Methoden des Schriftspracherwerbs nach Brügelmann werden genannt?
Die Arbeit erläutert die ganzheitliche (analytische) Methode, die einzelheitliche (synthetische) Methode sowie den Spracherfahrungssatz als Ansätze zum Erlernen von Lesen und Schreiben.
Was versteht man unter dem Begriff „Visus“?
Der Visus beschreibt die zentrale Sehschärfe eines Menschen. Er ist ein entscheidender Faktor dafür, wie gut Details und Kontraste beim Lesen und Schreiben wahrgenommen werden können.
Welche sind die häufigsten Sehbehinderungen, die das Lernen beeinflussen?
Zu den behandelten Beeinträchtigungen gehören unter anderem Grauer und Grüner Star, Augenzittern (Nystagmus), Gesichtsfeldausfälle, Blendempfindlichkeit sowie starke Kurz- oder Weitsichtigkeit.
Warum ist die Situation des Kindes vor dem Schulstart so wichtig?
Die vorschulischen Erfahrungen mit Sprache und Symbolen bilden das Fundament für den späteren Schriftspracherwerb. Bei sehbehinderten Kindern muss dieser Bereich oft besonders gefördert werden.
- Citar trabajo
- Thomas Schrowe (Autor), 2001, Probleme beim Schreibenlernen bei sehbehinderten Menschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24596