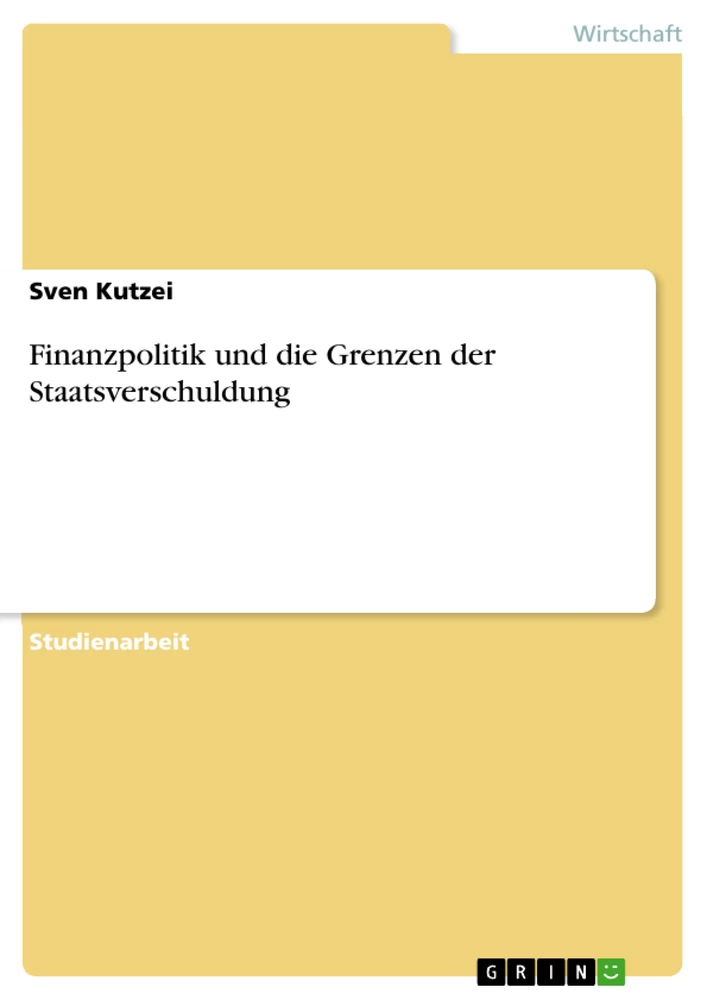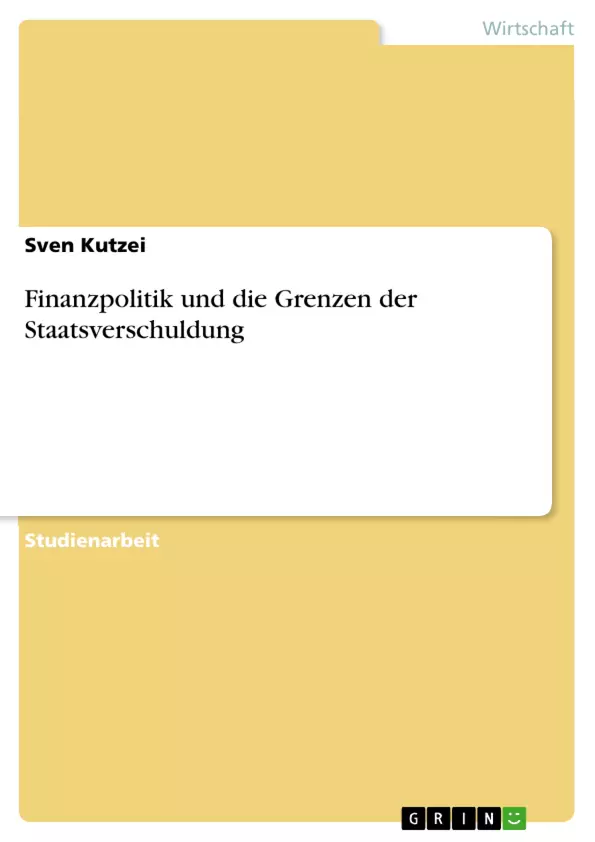Einführung
Die Finanzpolitik ist neben der Geldpolitik ein wichtiges Instrument, um konjunkturpolitisch in den Wirtschaftskreislauf eingreifen zu können. So lassen sich beispielsweise mit
Steuererhöhungen in der Hochkonjunktur Wachstumsrückgänge und mit Steuersenkungen in der Rezession Wachstumssteigerungen erzeugen. Auch über eine Veränderung der Staatsausgaben lassen sich Wachstumsveränderungen erzeugen.(1) In den letzten Jahrzehnten hat die Kreditaufnahme des Staates, also die Staatsverschuldung, zunehmend an Bedeutung gewonnen, da hier scheinbar in der Gegenwart eine kostenlose Finanzierung der Staatsausgaben zur Verfügung steht.(2) Inzwischen treten die Folgen der Verschuldung ans Tageslicht. Bei immer mehr Bürgern und Politikern überwiegt
heute die Skepsis gegenüber der Staatsverschuldung, nicht zuletzt wegen der Kriterien des Maastrichtvertrages, welcher eine Schuldenstandsquote(3) von 60 v.H. und eine Defizitquote(4)
von 3 v.H. gemessen am BIP vorsieht, um 1999 an der Europäischen Währungsunion teilnehmen zu können.(5)
Aus diesen Gründen gehe ich in dieser Arbeit ausschließlich auf das finanzpolitische Instrument der Staatsverschuldung ein und werde die Entwicklung, die Ursachen, die Folgen, die Begrenzungsmöglichkeiten sowie die Grenzen der Verschuldung darlegen.
[...]
______
1 Vgl. Haller, Heinz (1972), S. 173
2 Vgl. Ottnad, Adrian (1996), S. 124
3 Die Schuldenstandsquote gibt die Gesamtverschuldung gemessen in v.H. des BIP an. Nur durch die Betrachtung im Verhältnis zu einer Größe die Aufschluß über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gibt, ist eine Beurteilung sinnvoll. Der absolute Schuldenbestand ist wenig aussagekräftig.
4 Die Defizitquote gibt die Neuverschuldung bzw. die Nettokreditaufnahme gemessen am BIP an.
5 Vgl. Art. 104c des Vertrags über die Europäische Union und zugehöriges Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigem Defizit
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen
- Entwicklung
- Historische Entwicklung in der BRD
- Aktuelle Situation
- Internationaler Vergleich
- Ursachen
- Überforderung des Staates
- Wachsende Nachfrage nach staatlichen Leistungen
- Wachsendes Angebot und steigende Kosten staatlicher Leistungen
- Wachsende Staatsverschuldung aufgrund politischer Willensbildung
- Nichtberücksichtigung der Folgen
- Mangelnde Betroffenheit
- Makroökonomische Gründe
- Gesellschaftliche Wertvorstellungen
- Überforderung des Staates
- Folgen
- Finanzwirtschaftliche Folgen
- Der Weg in die Schuldenfalle
- Zwang zur Erzielung eines Primärüberschusses
- Höhere Steuer- und Abgabenbelastung
- Realwirtschaftliche Folgen
- Monetäre Folgen
- Verteilungspolitsche Folgen
- Ordnungspolitische Folgen
- Finanzwirtschaftliche Folgen
- Möglichkeiten der Begrenzung
- Maßnahmen zur indirekten Schuldenbegrenzung
- Maßnahmen zur direkten Schuldenbegrenzung
- Ergänzende Reformen
- Grenzen der Staatsverschuldung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die finanzpolitische Herausforderung der Staatsverschuldung in Deutschland. Sie analysiert die historische Entwicklung, die zugrundeliegenden Ursachen, die vielschichtigen Folgen und mögliche Strategien zur Begrenzung der Staatsverschuldung. Der Fokus liegt auf der Darstellung der komplexen Zusammenhänge und der Abwägung von Handlungsoptionen.
- Historische Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland
- Ursachen für die steigende Staatsverschuldung
- Wirtschaftliche, soziale und politische Folgen der Staatsverschuldung
- Möglichkeiten zur Begrenzung der Staatsverschuldung
- Grenzen staatlicher Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit der Verschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beschreibt die Finanzpolitik als wichtiges Instrument zur konjunkturpolitischen Steuerung und betont die wachsende Bedeutung der Staatsverschuldung in den letzten Jahrzehnten. Sie hebt die zunehmende Skepsis gegenüber der Staatsverschuldung hervor, insbesondere im Kontext der Maastricht-Kriterien. Die Arbeit konzentriert sich auf die Staatsverschuldung als finanzpolitisches Instrument und kündigt die Analyse ihrer Entwicklung, Ursachen, Folgen, Begrenzungsmöglichkeiten und Grenzen an.
Grundlagen: Dieses Kapitel differenziert zwischen verschiedenen Arten von Verschuldungshaushalten (Bund, Länder, Gemeinden und Sondervermögen) und erläutert die relevanten rechtlichen Grundlagen für die Finanzpolitik und die Staatsverschuldung, wie sie in Artikeln des Grundgesetzes und speziellen Finanzgesetzen verankert sind. Es legt den Fokus auf die verschiedenen Akteure und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Verschuldung.
Entwicklung: Das Kapitel "Entwicklung" beschreibt die historische Entwicklung der Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland, von einem vergleichsweise niedrigen Stand nach dem Krieg bis zum starken Anstieg insbesondere nach der Wiedervereinigung. Es werden sowohl die historischen Höchststände nach den Weltkriegen als auch der niedrigste Stand im Jahr 1962 genannt. Die aktuelle Situation nach der Wiedervereinigung mit einer explosionsartigen Zunahme der Schulden wird ebenfalls beleuchtet, wobei die hohen Kosten der Vereinigung als Hauptursache genannt werden. Der Text verweist auf Diagramme und Tabellen, die die Entwicklung veranschaulichen.
Ursachen: Das Kapitel "Ursachen" analysiert die Gründe für die steigende Staatsverschuldung. Es identifiziert drei Hauptursachen: die Überforderung des Staates durch wachsende Nachfrage und steigende Kosten staatlicher Leistungen, die Nichtberücksichtigung der Folgen der Verschuldung aus Gründen mangelnder Betroffenheit und makroökonomischer Faktoren sowie die Rolle gesellschaftlicher Wertvorstellungen. Diese Aspekte werden detailliert untersucht und mit Beispielen untermauert.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Maastricht-Kriterien, Schuldenstandsquote, Defizitquote, Wiedervereinigung, Konjunkturpolitik, Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Ordnungspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Staatsverschuldung in Deutschland
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Staatsverschuldung in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Analyse der historischen Entwicklung, der Ursachen, der Folgen und der Möglichkeiten zur Begrenzung der Staatsverschuldung.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: die historische Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland, die Ursachen für die steigende Verschuldung (z.B. Überforderung des Staates, Nichtberücksichtigung der Folgen, gesellschaftliche Wertvorstellungen), die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen der Staatsverschuldung, Möglichkeiten zur Begrenzung der Staatsverschuldung und die Grenzen staatlicher Handlungsmöglichkeiten.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in folgende Kapitel gegliedert: Einführung, Grundlagen, Entwicklung (inkl. historischer Entwicklung in der BRD, aktueller Situation und internationalem Vergleich), Ursachen (inkl. Überforderung des Staates, Nichtberücksichtigung der Folgen und gesellschaftlicher Wertvorstellungen), Folgen (inkl. finanzwirtschaftlicher, realwirtschaftlicher, monetärer, verteilungspolitscher und ordnungspolitischer Folgen), Möglichkeiten der Begrenzung (inkl. Maßnahmen zur indirekten und direkten Schuldenbegrenzung sowie ergänzenden Reformen) und Grenzen der Staatsverschuldung.
Welche Ursachen für die steigende Staatsverschuldung werden analysiert?
Die Analyse benennt drei Hauptursachen: die Überforderung des Staates durch wachsende Nachfrage und steigende Kosten staatlicher Leistungen, die Nichtberücksichtigung der Folgen der Verschuldung (Mangelnde Betroffenheit und makroökonomische Gründe) und die Rolle gesellschaftlicher Wertvorstellungen.
Welche Folgen der Staatsverschuldung werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt finanzwirtschaftliche Folgen (Weg in die Schuldenfalle, Zwang zu Primärüberschüssen, höhere Steuerbelastung), realwirtschaftliche, monetäre, verteilungspolitsche und ordnungspolitische Folgen der Staatsverschuldung.
Welche Möglichkeiten zur Begrenzung der Staatsverschuldung werden diskutiert?
Es werden Maßnahmen zur indirekten und direkten Schuldenbegrenzung sowie ergänzende Reformen diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Staatsverschuldung, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Maastricht-Kriterien, Schuldenstandsquote, Defizitquote, Wiedervereinigung, Konjunkturpolitik, Finanzwirtschaft, Realwirtschaft und Ordnungspolitik.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich im akademischen Kontext mit der Thematik der Staatsverschuldung auseinandersetzen möchten. Es dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
Wie ist die Struktur des Dokuments?
Das Dokument ist klar strukturiert und umfasst ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, eine Kapitelzusammenfassung sowie eine Liste der Schlüsselbegriffe. Diese Struktur erleichtert den Zugriff auf die relevanten Informationen.
- Citar trabajo
- Sven Kutzei (Autor), 1997, Finanzpolitik und die Grenzen der Staatsverschuldung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2460