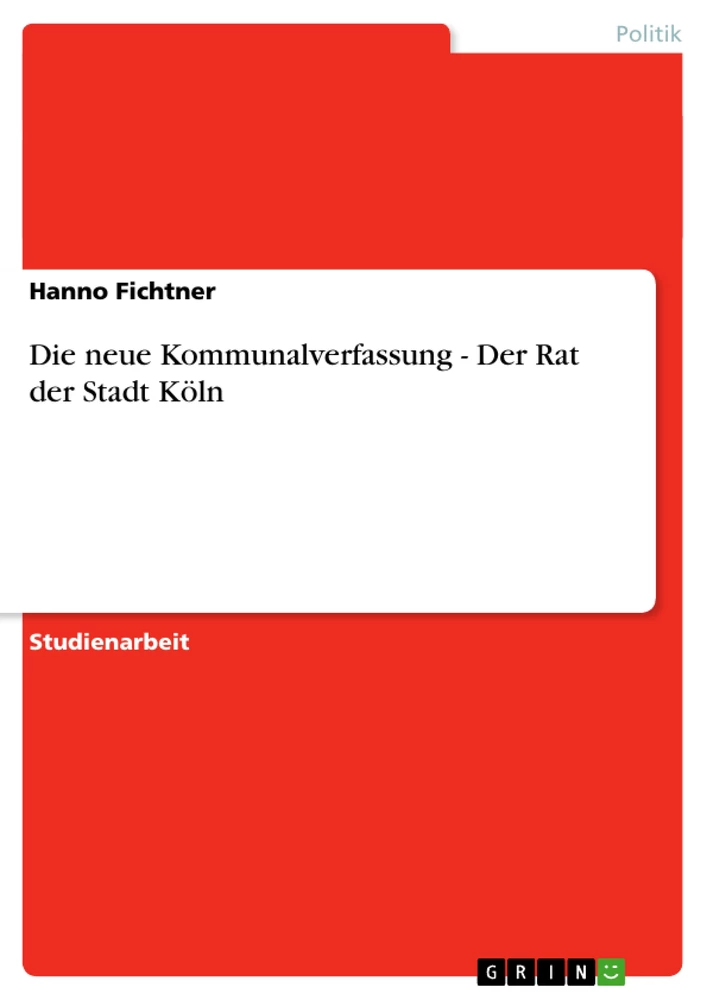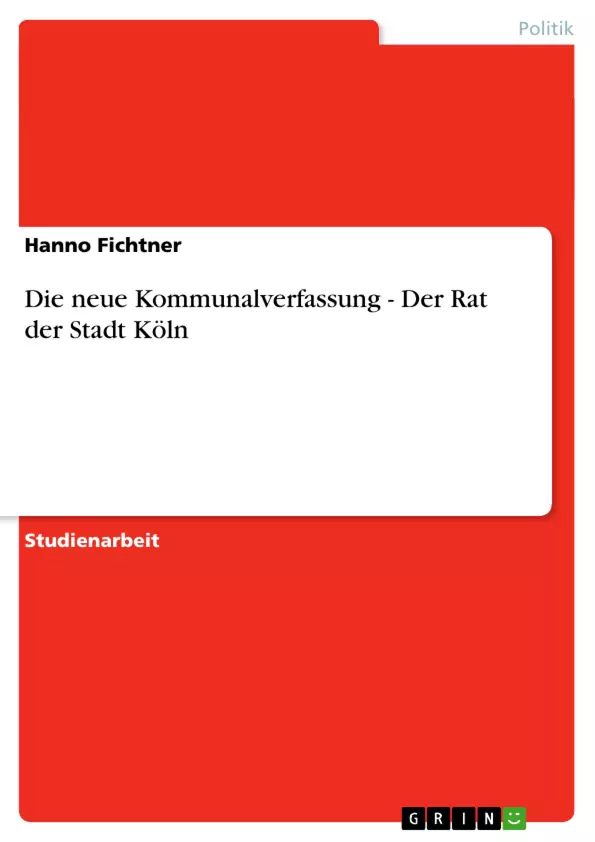Einleitung
1994 ist in Nordrhein-Westfalen eine neue Gemeindeordnung (GO) in Kraft getreten, die zu Veränderungen der Rahmenbedingungen für die kommunalen Akteure geführt hat. Auch für den im Zentrum dieser Arbeit stehenden Rat der Stadt Köln haben sich somit die konstitutionellen Regeln, die als unabhängige Variable betrachtet werden können, verändert. Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob Änderungen der Arbeitsweise des Rates (dieses ist dann die abhängige Variable) durch die Verfassungsänderung feststellbar sind. Konkret soll untersucht werden, inwiefern sich die Zusammenarbeit der Parteien im Rat durch die Änderung der GO verändert hat.
Als Bewertungsmodell für diese mögliche Veränderung der Kooperation zwischen den Parteien wurde das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart gewählt. Zu diesem Modell gab es an der Universität zu Köln bereits mehrere Arbeiten. Untersucht wurde so z.B. das Abstimmungsverhalten im Rat. Bisher nicht analysiert wurde jedoch die aus den Abstimmungen des Rates resultierende Besetzung von Ämtern in städtischen Unternehmen. Lässt sich hier eine stärkere Berücksichtigung von Kandidaten der Mehrheitsfraktionen zeigen, ist von einer Orientierung hin zum Mehrheitsmodell auszugehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verfassungsänderungen in NRW
- 2.1 Stellung der Kommune in Forschung und Recht
- 2.2 Verfassungsänderung
- 3. Mehrheits- und Konsensdemokratie bei Lijphart
- 3.1 Die beiden Modelle
- 3.2 Übertragung auf Köln
- 4. Konkurrenz oder Konsens in Köln?
- 4.1 Systemtheoretische Argumentation für das Mehrheitsmodell
- 4.2 Systemtheoretische Argumentation für das Konsensmodell
- 4.3 Prüfsteine für einen Trend zum Mehrheitsmodell
- 5. Empirische Untersuchung der Ämtervergabe
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der neuen Gemeindeordnung (GO) von 1994 in Nordrhein-Westfalen auf die Arbeitsweise des Rates der Stadt Köln. Konkret wird analysiert, ob sich die Zusammenarbeit der Parteien im Rat durch die Verfassungsänderung verändert hat. Hierzu dient das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart als Bewertungsrahmen. Die empirische Untersuchung konzentriert sich auf die Ämtervergabe in städtischen Unternehmen.
- Auswirkungen der neuen Gemeindeordnung auf die Zusammenarbeit der Parteien im Kölner Rat
- Anwendung des Mehrheits- und Konsensmodells von Lijphart auf das Kölner politische System
- Analyse der Ämtervergabe als Indikator für Mehrheits- oder Konsensorientierung
- Theoretische Auseinandersetzung mit der Stellung der Kommune in Forschung und Recht
- Vergleich verschiedener Kommunalverfassungstypen in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht den Einfluss der neuen Gemeindeordnung von 1994 in Nordrhein-Westfalen auf die Arbeitsweise des Rates der Stadt Köln, insbesondere die Zusammenarbeit der Parteien. Das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart dient als analytisches Instrument. Die Analyse der Ämtervergabe in städtischen Unternehmen soll Aufschluss über eine mögliche Veränderung der Kooperationsstrukturen geben. Die Arbeit baut auf früheren Kölner Studien zum Abstimmungsverhalten im Rat auf, erweitert diese aber um die Perspektive der Ämterbesetzung.
2. Verfassungsänderungen in NRW: Dieses Kapitel beleuchtet zunächst die Stellung der Kommune in Forschung und Recht, betont ihren Wandel vom "unpolitischen Harmoniemodell" hin zu stärker ausgeprägten Konfrontationen und Mehrheits-Minderheitskonstellationen. Es beschreibt die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung in Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 78 der NRW-Landesverfassung sowie die Gemeindeordnung. Des Weiteren werden verschiedene Kommunalverfassungstypen in Deutschland, insbesondere die bis 1994 in NRW geltende Norddeutsche Ratsverfassung mit ihrer Doppelspitze (Bürgermeister und Gemeindedirektor) und ihre Kritikpunkte, erläutert. Die Verfassungsänderung von 1994 wird als Kontext der Untersuchung eingeführt.
3. Mehrheits- und Konsensdemokratie bei Lijphart: Das Kapitel stellt das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart vor, beschreibt die charakteristischen Merkmale beider Modelle und überträgt diese auf den Kontext des Kölner Rates. Dieser Teil legt die theoretische Grundlage für die Analyse der Parteizusammenarbeit im Kölner Rat, indem er die unterschiedlichen Mechanismen und Ergebnisse von Mehrheits- und Konsensmodellen herausarbeitet. Die Übertragung auf den spezifischen Fall Kölns dient als Brücke zur empirischen Untersuchung.
4. Konkurrenz oder Konsens in Köln?: Dieser Abschnitt entwickelt systemtheoretische Argumentationen sowohl für ein Mehrheits- als auch ein Konsensmodell im Kölner Rat im Kontext der Verfassungsänderung. Es werden verschiedene Perspektiven und Argumente gegenübergestellt und mögliche Indikatoren für einen Trend zum Mehrheitsmodell diskutiert. Dieser Teil bietet eine differenzierte Analyse der theoretischen Erwartungen an die Veränderung der Parteizusammenarbeit im Rat.
5. Empirische Untersuchung der Ämtervergabe: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung der Ämtervergabe im Kölner Rat von der 1. bis zur 34. Sitzung der Wahlperiode 1999/2004. Die Analyse der Ämterbesetzung dient als konkreter Indikator für die Zusammenarbeit der Parteien und mögliche Verschiebungen hin zu einem Mehrheits- oder Konsensmodell. Die Ergebnisse dieser Analyse sollen im folgenden Fazit diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Kommunalverfassung Nordrhein-Westfalen, Gemeindeordnung, Rat der Stadt Köln, Mehrheitsmodell, Konsensmodell, Lijphart, Parteizusammenarbeit, Ämtervergabe, Kommunalpolitik, Systemtheorie, Empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen der Gemeindeordnung 1994 auf den Kölner Stadtrat
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der neuen Gemeindeordnung (GO) von 1994 in Nordrhein-Westfalen auf die Arbeitsweise des Rates der Stadt Köln. Im Fokus steht die Analyse, ob sich die Zusammenarbeit der Parteien im Rat durch die Verfassungsänderung verändert hat. Dafür wird das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart als Bewertungsrahmen verwendet. Die empirische Untersuchung konzentriert sich auf die Ämtervergabe in städtischen Unternehmen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Auswirkungen der neuen Gemeindeordnung auf die Zusammenarbeit der Parteien im Kölner Rat; Anwendung des Mehrheits- und Konsensmodells von Lijphart auf das Kölner politische System; Analyse der Ämtervergabe als Indikator für Mehrheits- oder Konsensorientierung; Theoretische Auseinandersetzung mit der Stellung der Kommune in Forschung und Recht; Vergleich verschiedener Kommunalverfassungstypen in Deutschland.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit einer empirischen Untersuchung. Das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart dient als theoretischer Rahmen. Empirisch wird die Ämtervergabe in Kölner städtischen Unternehmen in der Wahlperiode 1999/2004 untersucht, um Veränderungen in der Parteizusammenarbeit zu belegen.
Welche Verfassungsänderungen in NRW werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Stellung der Kommune in Forschung und Recht, ihren Wandel vom "unpolitischen Harmoniemodell" hin zu stärker ausgeprägten Konfrontationen. Sie beschreibt die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 78 der NRW-Landesverfassung sowie die Gemeindeordnung) und erläutert verschiedene Kommunalverfassungstypen in Deutschland, insbesondere die bis 1994 in NRW geltende Norddeutsche Ratsverfassung und die Verfassungsänderung von 1994.
Wie wird das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart angewendet?
Das Kapitel 3 stellt das Mehrheits- und Konsensmodell von Lijphart vor, beschreibt dessen Merkmale und überträgt diese auf den Kontext des Kölner Rates. Es dient als theoretische Grundlage für die Analyse der Parteizusammenarbeit, indem es die unterschiedlichen Mechanismen und Ergebnisse von Mehrheits- und Konsensmodellen herausarbeitet. Die Übertragung auf Köln bildet die Brücke zur empirischen Untersuchung.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Kapitel 5 beschreibt die empirische Untersuchung der Ämtervergabe im Kölner Rat von der 1. bis zur 34. Sitzung der Wahlperiode 1999/2004. Die Analyse der Ämterbesetzung dient als Indikator für die Zusammenarbeit der Parteien und mögliche Verschiebungen hin zu einem Mehrheits- oder Konsensmodell. Die Ergebnisse werden im Fazit diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit (Kapitel 6) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen. Es wird diskutiert, inwieweit die empirischen Befunde die theoretischen Erwartungen bestätigen und welche Schlussfolgerungen für die zukünftige Entwicklung der kommunalen Politik in Köln gezogen werden können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Kommunalverfassung Nordrhein-Westfalen, Gemeindeordnung, Rat der Stadt Köln, Mehrheitsmodell, Konsensmodell, Lijphart, Parteizusammenarbeit, Ämtervergabe, Kommunalpolitik, Systemtheorie, Empirische Untersuchung.
- Quote paper
- Hanno Fichtner (Author), 2003, Die neue Kommunalverfassung - Der Rat der Stadt Köln, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24670