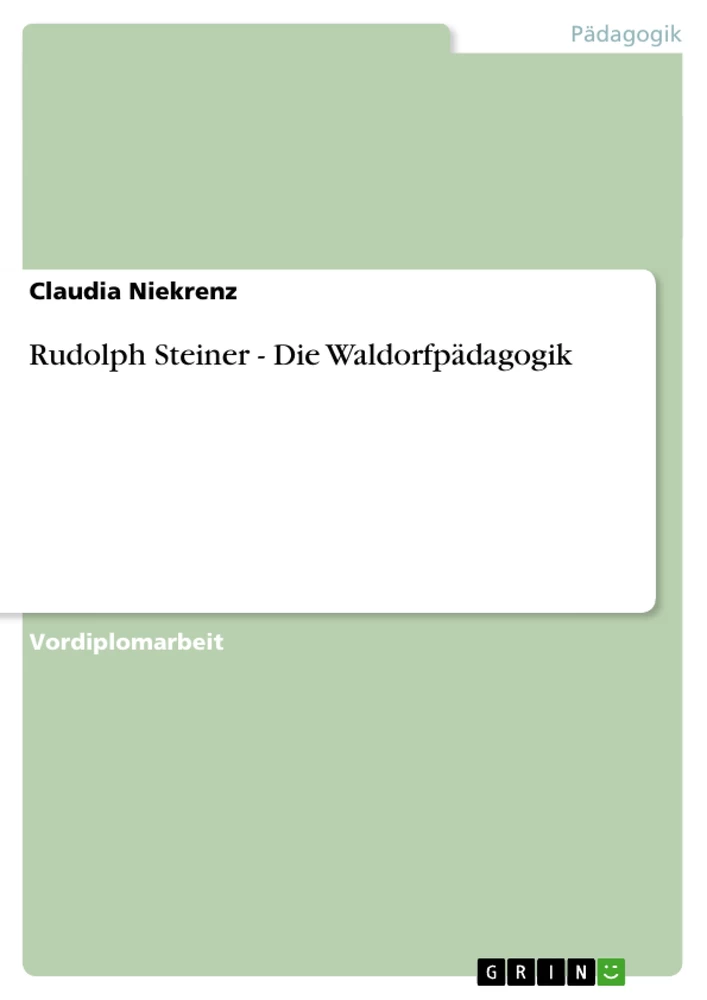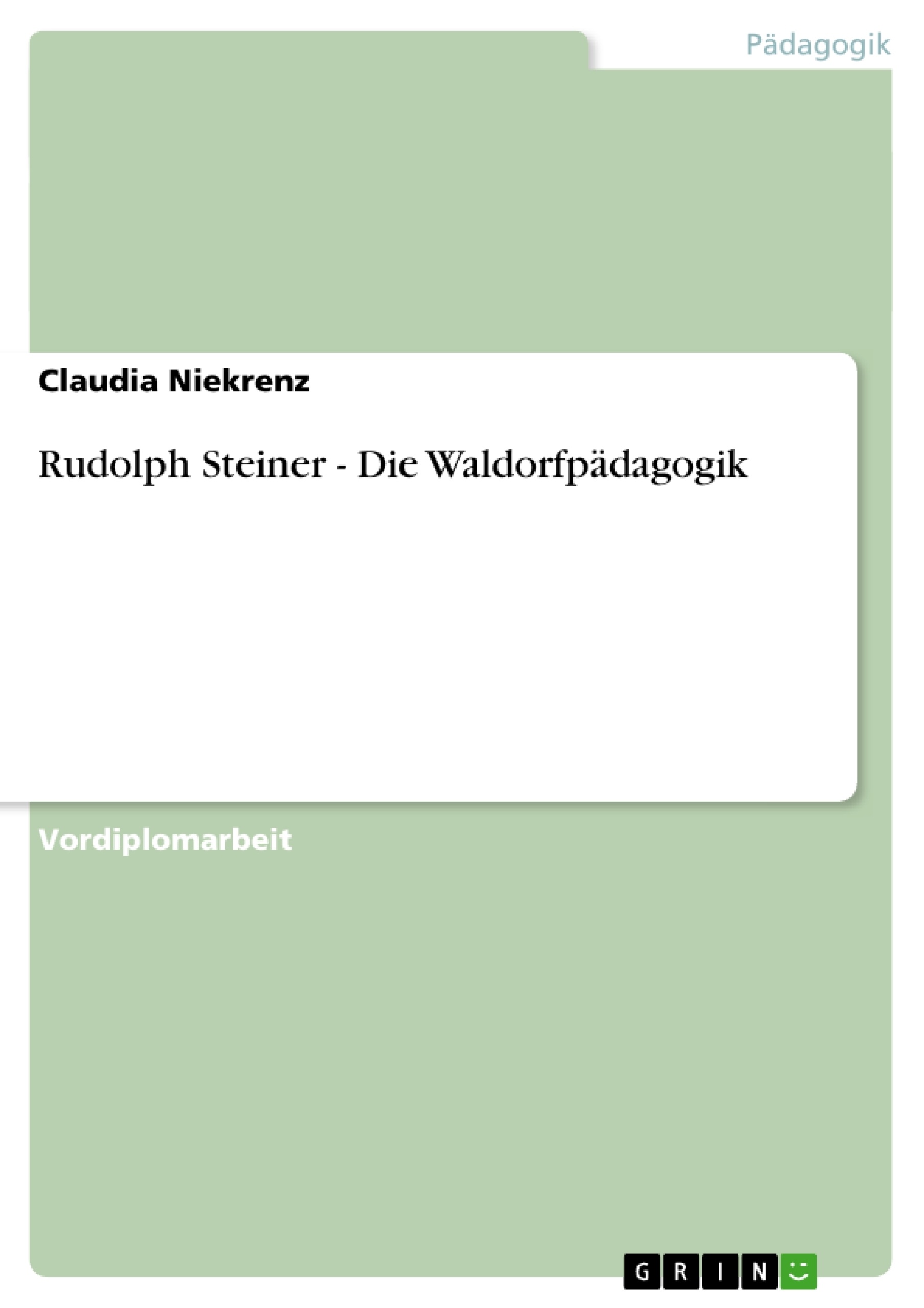Nach Waldorfschulen besteht heute Nachfrage wie nie zuvor in der
Geschichte dieser Schule in freier Trägerschaft. Die Zahl der Freien
Waldorfschulen hat sich hierzulande im vergangenen Jahrzehnt mehr als
verdoppelt, das Ausmaß der Gründungsinitiativen deutet darauf hin, dass die
Popularität dieses Schultyps rasant weiter wächst. Man darf heute davon
ausgehen, dass es in jeder Groß- bzw. Universitätsstadt eine Waldorfschule
gibt oder dass zumindest eine Elterninitiative grade dabei ist, eine solche
Schule oder einen sie vorbereitenden Waldorfkindergarten zu gründen. Damit
zusammenhängend hat sich auch die Funktion dieses Schultyps gewandelt:
Waren die wenigen Waldorfschulen in der Zeit nach dem letzten Krieg bis
etwa zur Mitte der sechziger Jahre durch freie Kapazitäten oft Auffangbecken
für „gestrandete“ Schüler staatlicher Schulen, so führen heute lange
Wartelisten für Schulanfänger dazu, dass die Mehrzahl der Waldorfschüler
diese Schule von der ersten bis zur zwölften Klasse besucht. Kurzfristiges
Überwechseln in diesen begehrten Schultyp ist zur Ausnahme geworden.
Ein bedeutsamer Grund für das steigende Interesse an den Freien
Waldorfschulen kann in einer veränderten Einstellung gegenüber der
staatlichen „Regelschule“ bzw. der staatlichen Bildungsreform und in der
Favorisierung freier „alternativer“ Schulen gesehen werden.
Im folgenden will ich daher einen kurzen Überblick über die Pädagogik der
Waldorfschule geben. Was ist so anderes an der Waldorfpädagogik?
Wodurch kam die Gründung der ersten Waldorfschule zustande? Wie wird
das pädagogische Modell in der Waldorfschule umgesetzt?
Natürlich sollte man bei einem so umfangreichen Thema auch die Biographie
und die Anthroposophie Rudolph Steiners nicht außer Acht lassen. Da diese
beiden Themen jedoch nicht Hauptbestandteil meiner Arbeit sein sollen,
möchte ich mich in bezug auf die Biographie und die Anthroposophie eher
kurz fassen. Dies erscheint mir grade was die Anthroposophie betrifft jedoch
als eine sehr schwierige Aufgabe. Dennoch bin ich der Meinung, dass die
Geisteslehre Steiners im Zusammenhang mit der Waldorfpädagogik
unbedingt erwähnt werden muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rudolph Steiner - eine Lebenschronik
- Grundzüge Steiners anthroposophischer Menschenlehre
- Die anthroposophische Entwicklungslehre - Grundlage einer normativen Pädagogik
- Die erste freie Waldorfschule in Stuttgart
- Selbstverwaltung der Waldorfschule
- Gründung der Waldorfschule 1919-1925
- Finanzierung der Waldorfschule
- Pädagogik der Waldorfschule
- kindliches Lernen
- Unterrichtsform der Waldorfschule
- Zeugnisse und Abschlüsse der Waldorfschule
- Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Waldorfpädagogik und ihren Wurzeln in der Anthroposophie Rudolf Steiners. Ziel ist es, einen Einblick in die Geschichte und die pädagogischen Prinzipien der Waldorfschule zu geben. Dabei wird die Entwicklung der Waldorfpädagogik von ihrer Gründung bis zur Gegenwart beleuchtet.
- Die Biographie und die anthroposophische Philosophie Rudolf Steiners
- Die Grundprinzipien der Waldorfpädagogik
- Die Entwicklung der Waldorfschule in Stuttgart
- Die Bedeutung der Selbstverwaltung und Finanzierung der Waldorfschulen
- Die pädagogischen Methoden der Waldorfschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Waldorfschulen in der heutigen Gesellschaft dar und erläutert die steigende Nachfrage nach diesem Schultyp. Es wird die Frage aufgeworfen, was die Waldorfpädagogik so anders macht und wie das pädagogische Modell in der Praxis umgesetzt wird.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Biographie Rudolf Steiners und seine Entwicklung von einem naturwissenschaftlich orientierten Denker hin zu einem spirituellen Philosophen. Es werden seine frühen Studien, seine Auseinandersetzung mit dem Werk Goethes sowie sein Engagement in der Geisteswissenschaft dargestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Grundzügen der anthroposophischen Menschenlehre, die die Grundlage für die Waldorfpädagogik bildet. Es werden die zentralen Elemente der anthroposophischen Philosophie erläutert, die Steiners pädagogisches Denken prägten.
Das vierte Kapitel behandelt die anthroposophische Entwicklungslehre als Grundlage für die Waldorfpädagogik. Es wird dargestellt, wie Steiners anthropologische Erkenntnisse in die Entwicklung eines pädagogischen Modells einfließen.
Das fünfte Kapitel gibt einen Überblick über die erste freie Waldorfschule in Stuttgart. Es werden die Selbstverwaltung, die Gründung und die Finanzierung der Schule beleuchtet.
Das sechste Kapitel widmet sich den pädagogischen Prinzipien der Waldorfschule. Es wird auf die besonderen Merkmale des kindlichen Lernens, die Unterrichtsformen und die Zeugnisse und Abschlüsse der Waldorfschule eingegangen.
Schlüsselwörter
Waldorfpädagogik, Anthroposophie, Rudolf Steiner, Selbstverwaltung, freie Schule, kindliches Lernen, Unterrichtsform, Geisteswissenschaft, Entwicklungslehre, Goethe, Bildungsreformen
- Citation du texte
- Claudia Niekrenz (Auteur), 2001, Rudolph Steiner - Die Waldorfpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24774