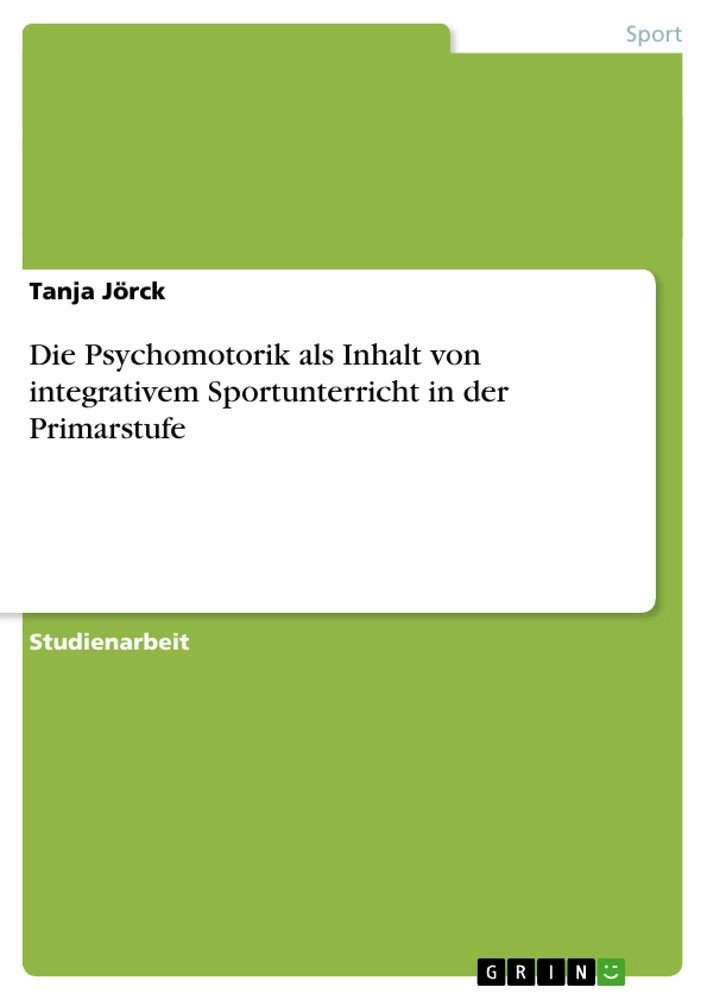Die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft der Nichtbehinderten wird in Hamburg von den meisten Politikern und auch Pädagogen befürwortet und unterstützt. Ein Teil dieser gesellschaftlichen Integration ist die schulische Integration, um die es in dieser Arbeit vorrangig gehen soll. Es entstanden in den 80er Jahren in Hamburg Integrationsklassen und integrative Regelklassen. Vor-und Nachteile der integrativen Beschulung werden in der Literatur und bei den Betroffenen immer wieder abgewogen. Ich möchte mich mit einem Unterrichtsfach auseinander setzen, das meist nicht viel Aufmerksamkeit erhält, dem Sportunterricht.
Wenn behinderte und nichtbehinderte Schüler eine Klasse besuchen, muss der Lehrer/die Lehrerin sich überlegen wie der integrative Sportunterricht gestaltet werden soll. In der Literatur liegen unterschiedliche Meinungen vor. Diese Diskussion möchte ich in der vorliegenden Arbeit aufgreifen, und mich auf die gegenwärtige Situation im integrativen Primarbereich an Hamburger Grundschulen beziehen. Hier herrscht die Methode der Psychomotorik in Form von Bewegungslandschaften vor. Meine Frage für diese Arbeit lautet: Ist die Psychomotorik die geeignete Methode für den integrativen Sportunterricht, welche anderen Möglichkeiten gibt es um die soziale Integration und die Entwicklung zu fördern? Innerhalb dieser Fragestellung soll herausgearbeitet werden ob man mit den Bewegungsbaustellen den Zielen soziale Integration und Entwicklungsförderung gerecht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Integration
- 2.1 Integrationsbegriff
- 2.2 Soziales Lernen
- 2.3 Entwicklung der integrativen Beschulung in Hamburg
- 3. Psychomotorik
- 3.1 Ursprung und Entwicklung
- 3.2 Einordnung des Begriffes Psychomotorik
- 3.3 Die Theorie der Psychomotorik
- 3.3.1 Die Bedeutung des Bewegungs- und Wahrnehmungslernens für die Entwicklung des Kindes
- 4. Psychomotorische Erziehung im Sportunterricht
- 4.1 Veränderte Lebensbedingungen der Kinder
- 4.2 Integrativer Sportunterricht
- 5. Die Bewegungslandschaft
- 6. Vorzüge und Grenzen der Psychomotorischen Erziehung im Sportunterricht
- 6.2 Grenzen der Psychomotorik
- 7. Alternative Vorschläge für integrativen Sportunterricht
- 7.1 Wahl der Inhalte
- 7.2 Methodische Überlegungen
- 7.3 Anforderungen an den Lehrer
- 7.4 Gesamtbeurteilung des Konzeptes von MÜLLER aus eigener Sicht
- 8. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung der Psychomotorik als Methode für integrativen Sportunterricht in der Primarstufe, insbesondere im Hamburger Kontext. Die Autorin analysiert, ob Bewegungslandschaften den Zielen der sozialen Integration und Entwicklungsförderung gerecht werden und welche alternativen Möglichkeiten bestehen.
- Der Integrationsbegriff und seine Anwendung im schulischen Kontext
- Die Theorie und Praxis der Psychomotorik
- Die Bedeutung von Bewegung und Wahrnehmung für die kindliche Entwicklung
- Integrativer Sportunterricht und seine Herausforderungen
- Bewertung von Bewegungslandschaften im integrativen Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der integrativen Beschulung in Hamburg ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Eignung der Psychomotorik für integrativen Sportunterricht. Die Autorin hebt die kontroversen Positionen in der Literatur bezüglich der Integration im Sportunterricht hervor und kündigt den Aufbau der Arbeit an.
2. Integration: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Integration“ und differenziert zwischen sozialer und personaler Integration nach Speck (1991). Es beleuchtet den Aspekt des sozialen Lernens im integrativen Unterricht und skizziert die Entwicklung der integrativen Beschulung in Hamburg, beginnend mit Elterninitiativen und den Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates. Kontroversen um die optimale Gruppenzusammensetzung in Integrationsklassen werden diskutiert, und Studienergebnisse zu den Leistungen von Schülern in Integrationsklassen werden präsentiert.
3. Psychomotorik: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Ursprung und der Entwicklung der Psychomotorik sowie deren theoretischen Grundlagen. Es analysiert die Bedeutung von Bewegungs- und Wahrnehmungslernen für die Entwicklung des Kindes und legt den Fokus auf den Beitrag der Psychomotorik zur kindlichen Entwicklung.
4. Psychomotorische Erziehung im Sportunterricht: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss veränderter Lebensbedingungen von Kindern auf den Sportunterricht und beleuchtet die Besonderheiten des integrativen Sportunterrichts. Es stellt den Zusammenhang zwischen den Lebensbedingungen der Kinder und den Anforderungen an den Sportunterricht her und legt den Grundstein für die Diskussion über geeignete Methoden im integrativen Kontext.
5. Die Bewegungslandschaft: Dieses Kapitel beschreibt das Konzept der Bewegungslandschaft und erläutert seine Prinzipien. Es bildet die Grundlage für die spätere Bewertung der Bewegungslandschaft als Methode im integrativen Sportunterricht.
6. Vorzüge und Grenzen der Psychomotorischen Erziehung im Sportunterricht: Dieses Kapitel evaluiert die Vor- und Nachteile der Psychomotorik im integrativen Sportunterricht, wobei insbesondere die Grenzen der Methode im Fokus stehen. Es analysiert die potenziellen Limitationen und bereitet den Weg für die Diskussion alternativer Ansätze.
7. Alternative Vorschläge für integrativen Sportunterricht: Das Kapitel präsentiert alternative Vorschläge aus der Literatur für den Sportunterricht mit heterogenen Gruppen und beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen sowie die Darstellung der eigenen Position der Autorin. Es analysiert verschiedene methodische Überlegungen und Anforderungen an Lehrkräfte im integrativen Sportunterricht.
Schlüsselwörter
Integration, inklusive Bildung, Sportunterricht, Psychomotorik, Bewegungslandschaft, soziale Integration, Entwicklungsförderung, heterogene Gruppen, Primarstufe, Hamburg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Psychomotorik im integrativen Sportunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Eignung der Psychomotorik als Methode für integrativen Sportunterricht in der Primarstufe, insbesondere im Hamburger Kontext. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Bewegungslandschaften den Zielen der sozialen Integration und Entwicklungsförderung gerecht werden und welche alternativen Möglichkeiten bestehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Integrationsbegriff und seine Anwendung im schulischen Kontext, die Theorie und Praxis der Psychomotorik, die Bedeutung von Bewegung und Wahrnehmung für die kindliche Entwicklung, integrativen Sportunterricht und seine Herausforderungen sowie die Bewertung von Bewegungslandschaften im integrativen Sportunterricht. Zusätzlich werden alternative Vorschläge für integrativen Sportunterricht diskutiert und die Anforderungen an Lehrkräfte beleuchtet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Integration (inkl. Integrationsbegriff, soziales Lernen und Entwicklung integrativer Beschulung in Hamburg), Psychomotorik (Ursprung, Entwicklung, Theorie und Bedeutung für die kindliche Entwicklung), Psychomotorische Erziehung im Sportunterricht (veränderte Lebensbedingungen der Kinder und integrativer Sportunterricht), Die Bewegungslandschaft, Vorzüge und Grenzen der Psychomotorischen Erziehung im Sportunterricht, Alternative Vorschläge für integrativen Sportunterricht (Wahl der Inhalte, methodische Überlegungen, Anforderungen an den Lehrer und Gesamtbeurteilung eines Konzeptes) und Schlussbetrachtung und Ausblick.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Eignung der Psychomotorik für integrativen Sportunterricht. Die Arbeit untersucht, ob Bewegungslandschaften den Zielen der sozialen Integration und Entwicklungsförderung gerecht werden und welche alternativen Methoden im integrativen Sportunterricht eingesetzt werden können.
Welche Methoden werden im integrativen Sportunterricht diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Psychomotorik und Bewegungslandschaften als Methoden im integrativen Sportunterricht und präsentiert anschließend alternative Vorschläge aus der Literatur, die kritisch bewertet werden. Die Arbeit beleuchtet methodische Überlegungen und die Anforderungen an Lehrkräfte im integrativen Sportunterricht.
Welche Rolle spielt der Hamburger Kontext?
Der Hamburger Kontext spielt eine wichtige Rolle, da die Arbeit die Entwicklung der integrativen Beschulung in Hamburg mit einbezieht und die Ergebnisse auf den spezifischen Kontext anwendet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in der Schlussbetrachtung und im Ausblick zusammengefasst. Hier wird die Eignung der Psychomotorik und alternativer Methoden für integrativen Sportunterricht bewertet und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gegeben. Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden und gibt Empfehlungen für die Praxis.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integration, inklusive Bildung, Sportunterricht, Psychomotorik, Bewegungslandschaft, soziale Integration, Entwicklungsförderung, heterogene Gruppen, Primarstufe, Hamburg.
- Citar trabajo
- Tanja Jörck (Autor), 2000, Die Psychomotorik als Inhalt von integrativem Sportunterricht in der Primarstufe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24849