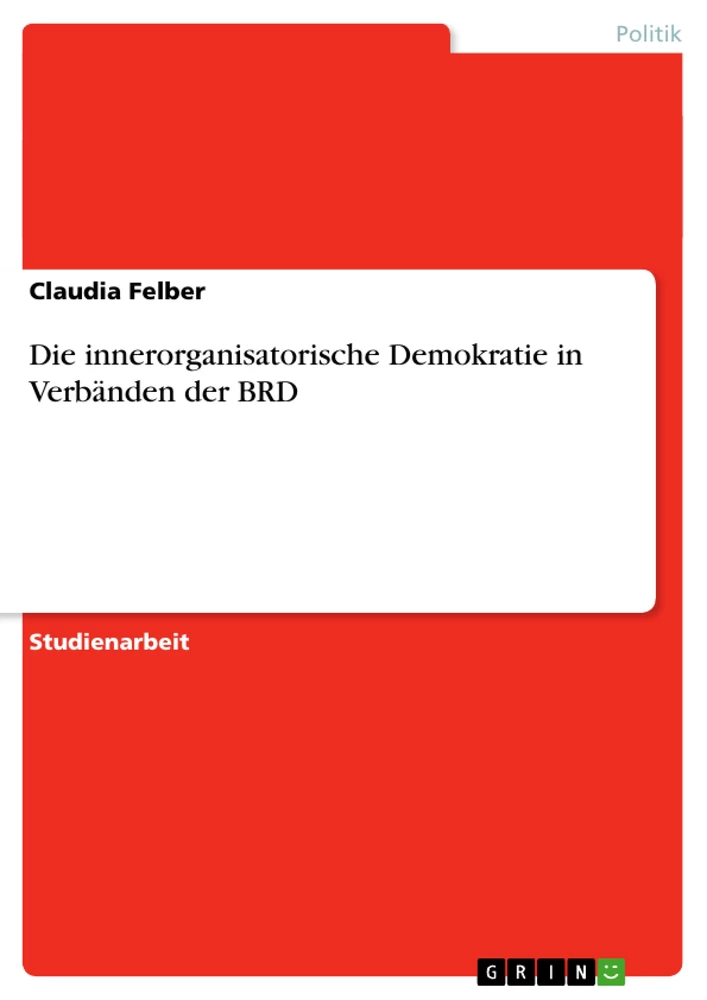Innerhalb des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschlands nehmen Verbände eine entscheidende Position ein.
Relativ schnell ist festzustellen, dass erhebliche Defizite in der demokratischen Struktur des Verbandssystems erkennbar sind. Bei dem bereits erwähnten Beitrag der den Verbänden im Politikprozess in der BRD zugesprochen wird, kann dies zu enormen Problemen für das System führen. Jenes ist auch die Grundlage für die Frage nach der Gefahr, die der Mangel an innerverbandlicher Demokratie für die pluralistische Interessenvertretung darstellt.2 Allgemein kann man davon sprechen, dass es ganz im Sinne des Pluralismus ist eine hohe Anzahl von Interessen in staatliche Entscheidungen mit einzubeziehen.3 Allerdings bleibt zu klären, ob die positiven Aspekte dieser Einbindung bei der Betrachtung der innerorganisatorischen Demokratie noch haltbar sind.
Zunächst versuche ich, die Verbände im Pluralismus zu verorten, um dann dazu überzugehen, kurz den Versuch der gesetzlichen Regulation von innerorganisatorischen Strukturen darzustellen. Weiterhin werde ich auf Kriterien eingehen, welche die Binnendemokratie ausmachen, um dann anhand des Aufbaus von Beispielverbänden den Zustand dieser in der Bundesrepublik zu untersuchen. Daraus resultiert dann die Überlegung über den Nutzen von Demokratisierungsprozessen in komplexen Organisationen. Schließlich wird noch einmal auf die Rolle der Interessengruppen im Pluralismus eingegangen, indem die Beeinflussung ihrer Funktionen durch das Prinzip der konsequenten innerverbandlichen Demokratie betrachtet wird. Die Aussagen dieser Hausarbeit beziehen sich nur auf Verbände des Wirtschafts - und Arbeitsbereiches, obwohl sie in Teilen auch in anderen Typen auffindbar sind. Diese Herangehensweise erlaubt jedoch zumindest ein Maß an Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Der Hausarbeit liegt eine Sekundärliteraturanalyse zugrunde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbände im Pluralismus
- Verbände und ihre Rolle im pluralistischen System der BRD.
- Der Versuch der Regulierung...
- Kriterien an die innerverbandliche Demokratie.
- Die innerorganisatorische Demokratie in Verbänden der BRD.
- Die Struktur von Verbänden
- Die Determinante Größe
- Die Determinanten Mitglieder und Führung.
- Der formale Aufbau und die Kompetenzzuweisung.
- Die Diskussion über die Notwendigkeit von innerverbandlicher Demokratie
- Der Einfluss der Binnendemokratie auf die Funktionen von Verbänden
- Die Struktur von Verbänden
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die innerorganisatorische Demokratie in Verbänden der Bundesrepublik Deutschland und analysiert, ob der Mangel an innerverbandlicher Demokratie eine Gefahr für die pluralistische Interessenvertretung darstellt. Die Arbeit befasst sich mit der Rolle von Verbänden im pluralistischen System, den Kriterien für innerverbandliche Demokratie und dem Einfluss der Binnendemokratie auf die Funktionen von Verbänden.
- Die Rolle von Verbänden im pluralistischen System der BRD.
- Die Kriterien für innerverbandliche Demokratie.
- Der Einfluss der Binnendemokratie auf die Funktionen von Verbänden.
- Die Diskussion über die Notwendigkeit von innerverbandlicher Demokratie.
- Der Versuch der gesetzlichen Regulierung von innerorganisatorischen Strukturen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz von Verbänden im politischen System der Bundesrepublik Deutschland dar und betont die Bedeutung innerverbandlicher Demokratie für die Legitimation von Interessenvertretung. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Gefahr, die der Mangel an innerverbandlicher Demokratie für die pluralistische Interessenvertretung darstellt.
Verbände im Pluralismus
Verbände und ihre Rolle im pluralistischen System der BRD.
Dieser Abschnitt definiert Verbände als Organisationen, die die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik vertreten. Er erläutert die Bedeutung von Verbänden für die politische Partizipation und den Einfluss auf den staatlichen Entscheidungsprozess im Rahmen des pluralistischen Systems.
Der Versuch der Regulierung
Dieser Abschnitt beleuchtet den Versuch der gesetzlichen Regulierung von Verbandsstrukturen in den 1970er Jahren. Er beschreibt die Idee eines Verbändegesetzes, das am Parteiengesetz orientiert war und auf eine Ausweitung des Grundgesetzartikels 9 abzielte, um innerverbandliche Demokratie zur gesetzlichen Pflicht zu erheben.
Kriterien an die innerverbandliche Demokratie
Dieser Abschnitt definiert die Kriterien für innerverbandliche Demokratie, die für die Legitimation der Interessenvertretung von entscheidender Bedeutung sind.
Die innerorganisatorische Demokratie in Verbänden der BRD.
Die Struktur von Verbänden
Dieser Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Faktoren, die die Struktur von Verbänden beeinflussen, wie Größe, Mitgliederzahl und Führung. Er untersucht den formalen Aufbau von Verbänden und die Kompetenzzuweisung.
Die Diskussion über die Notwendigkeit von innerverbandlicher Demokratie
Dieser Abschnitt diskutiert die Notwendigkeit von innerverbandlicher Demokratie für eine effektive und legitime Interessenvertretung.
Der Einfluss der Binnendemokratie auf die Funktionen von Verbänden
Dieser Abschnitt analysiert den Einfluss der innerverbandlichen Demokratie auf die Funktionen von Verbänden und beleuchtet die Bedeutung von demokratischen Prozessen für die effiziente und legitime Interessenvertretung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: innerverbandliche Demokratie, Verbände, pluralistische Interessenvertretung, politische Willensbildung, politische Partizipation, intermediäre Einrichtungen, Legitimation, demokratische Willensbildung, staatlicher Entscheidungsprozess, Regulierung, Binnendemokratie, Verbandsstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die innerverbandliche Demokratie in der BRD ein Thema?
Verbände nehmen eine Schlüsselposition im politischen System ein. Ein Mangel an demokratischen Strukturen in diesen Verbänden könnte die Legitimation der pluralistischen Interessenvertretung gefährden.
Welche Kriterien definieren die Binnendemokratie eines Verbandes?
Die Arbeit untersucht Kriterien wie den formalen Aufbau, die Kompetenzzuweisung zwischen Führung und Mitgliedern sowie die Möglichkeiten der politischen Willensbildung innerhalb der Organisation.
Gab es Versuche, Verbandsstrukturen gesetzlich zu regulieren?
Ja, in den 1970er Jahren gab es Überlegungen für ein „Verbändegesetz“, das sich am Parteiengesetz orientieren sollte, um innerverbandliche Demokratie zur Pflicht zu machen.
Welche Faktoren beeinflussen die Struktur von Verbänden?
Wesentliche Determinanten sind die Größe des Verbandes, die Anzahl der Mitglieder sowie das Verhältnis zwischen der Führungsebene und der Basis.
Auf welche Arten von Verbänden bezieht sich diese Hausarbeit?
Die Aussagen der Arbeit konzentrieren sich primär auf Verbände aus dem Wirtschafts- und Arbeitsbereich der Bundesrepublik Deutschland.
Welchen Nutzen haben Demokratisierungsprozesse in komplexen Organisationen?
Die Arbeit diskutiert, ob mehr Demokratie die Effizienz und Legitimation der Interessenvertretung gegenüber dem Staat und der Öffentlichkeit steigert.
- Citar trabajo
- Claudia Felber (Autor), 2004, Die innerorganisatorische Demokratie in Verbänden der BRD, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24885