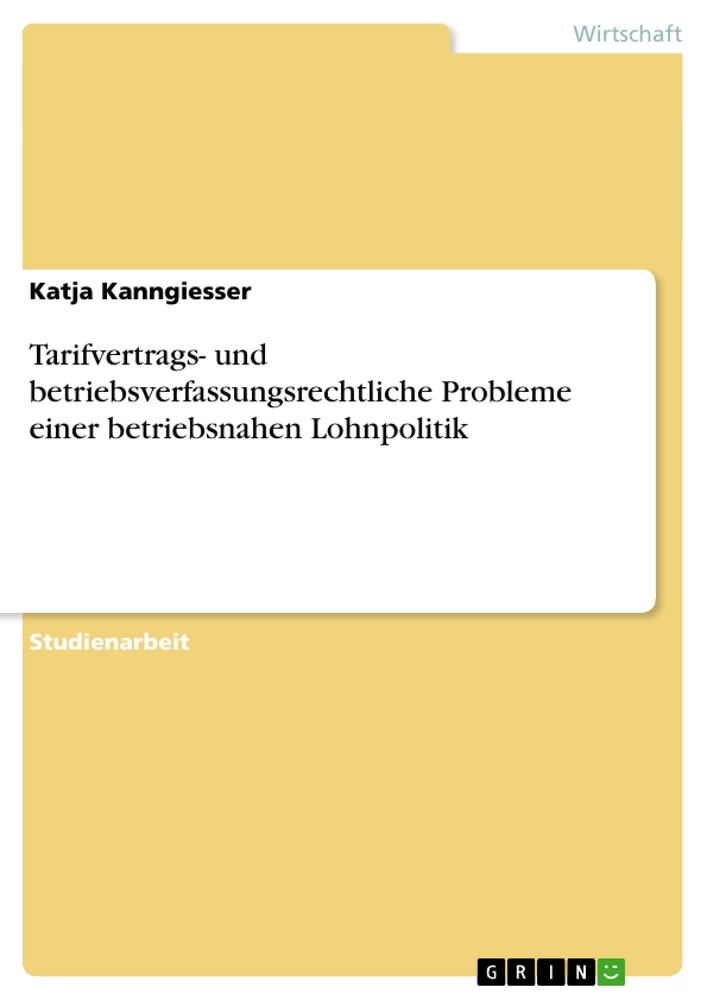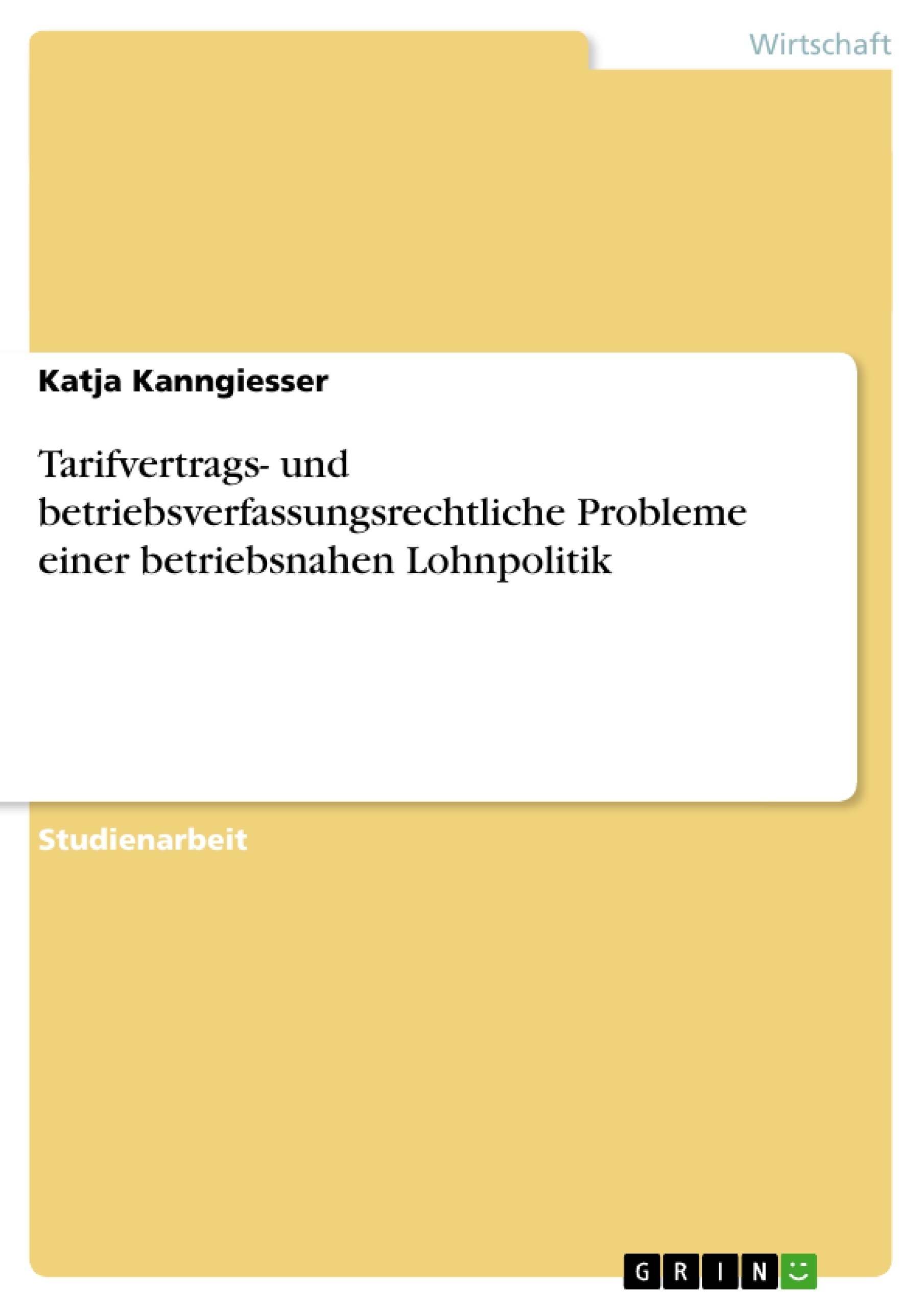[...] Die in der Bundesrepublik
Deutschland beunruhigende Statistik von 4,6 Millionen Arbeitslosen3 stellt für die
bundesdeutsche Wirtschaft und Gesellschaft eine harte Bewährungsprobe dar.
Es besteht eine dringende Aufforderung an die Entscheidungsträger, gemeinsame
Anstrengungen zu entwickeln, um den Arbeitsplatzabbau zu stoppen und die Schaffung
neuer Arbeitsplätze zu forcieren. Dass dies bis heute nicht geschehen ist, liegt an den
konfliktären Standpunkten der beteiligten Interessengruppen, wie Parteien, Arbeitgeberund
Arbeitnehmervereinigungen. Neben gesetzgeberischen Aspekten und wirtschaftpolitischen Maßnahmen zur
Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten ist betriebsnahe Lohnpolitik ein
Versuch, gegen die von Unternehmen offensichtlich als geschäftsschädigend
angesehenen Ursachen von Arbeitslosigkeit vorzugehen, wie die Reaktionen auf die
genannten Probleme zeigen: Besonders junge Unternehmen verzichten mittlerweile von
Beginn an auf den Beitritt zu Arbeitgeberverbänden mit Tarifbindung, um möglichst
große Gestaltungsspielräume zu behalten. Einige Unternehmen versuchen, sich den als
Zwangsjacke empfundenen Flächentarifverträgen durch Austritt aus
Arbeitgeberverbänden zu entziehen und erwirken stattdessen Firmentarif- oder
Einzelarbeitsverträge. Andere wiederum bleiben zwar formell tarifgebunden, begehen
aber in Absprache mit ihrer Belegschaft rechtswidrige Verstöße gegen bindende
Tarifbestimmungen.4
Die Gegenstrategie scheint klar: Eine detaillierte Revision der Betriebsverfassung, des
Arbeitsrechts und der Tarifordnung ist zwingend. In diesem Zusammenhang wird seit
einigen Jahren zunehmend die Forderung nach einer betriebsnäheren Lohnpolitik laut. Ziel dieser Arbeit ist es, sowohl beschäftigungssichernde als auch
beschäftigungsfördernde Möglichkeiten einer betriebsnahen Lohnpolitik genauer zu
betrachten und unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten zu analysieren. Dabei sollen
sowohl die damit verbundenen Chancen als auch die Risiken untersucht werden, um
eine abschließende Beurteilung der Problematik treffen zu können. Darüber hinaus ist es
Ziel dieser Arbeit, die tarifvertrags- und betriebsverfassungsrechtlichen Konflikte bei
den betrachteten Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
3 Vgl. Statistisches Bundesamt (2004).
4 Vgl. Kohaut/Schnabel (1998), S. 3.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Gang der Untersuchung
- Begriffliche und rechtliche Grundlagen
- Tarifautonomie
- Tarifvertrag
- Gewerkschaft und Arbeitgeberverband
- Gestaltungsmöglichkeiten einer betriebsnahen Lohnpolitik
- Reform des Flächentarifvertrags
- Modifizierung des Günstigkeitsprinzips
- Probleme einer betriebsnahen Lohnpolitik
- Risiken einer Reform des Flächentarifvertrags
- Risiken einer Modifizierung des Günstigkeitsprinzips
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Chancen und Risiken einer betriebsnahen Lohnpolitik im Hinblick auf die Beschäftigungsentwicklung. Dabei werden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten analysiert, die sowohl beschäftigungssichernde als auch beschäftigungsfördernde Effekte erzielen könnten.
- Analyse der Funktions- und Wirkungsweise von Tarifverträgen
- Untersuchung der Gestaltungsmöglichkeiten einer betriebsnahen Lohnpolitik, insbesondere durch Reform des Flächentarifvertrags und Modifizierung des Günstigkeitsprinzips
- Bewertung der Chancen und Risiken der genannten Maßnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven (Arbeitnehmer, Unternehmen, Volkswirtschaft)
- Aufarbeitung der tarifvertrags- und betriebsverfassungsrechtlichen Konflikte im Kontext der betrachteten Gestaltungsmöglichkeiten
- Diskussion der Gegenargumente und Risiken, die mit einer Verlagerung der Tarifpolitik in Richtung der Betriebe verbunden sind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit. Sie stellt die Bedeutung der Beschäftigungsentwicklung für die deutsche Wirtschaft dar und zeigt die Notwendigkeit einer betriebsnahen Lohnpolitik auf.
Kapitel 2 legt die rechtlichen und begrifflichen Grundlagen für das Verständnis der betriebsnahen Lohnpolitik dar. Es erläutert die Tarifautonomie, die Funktionsweise von Tarifverträgen und die Rolle von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden.
Kapitel 3 analysiert verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten einer betriebsnahen Lohnpolitik und die damit verbundenen Chancen. Es betrachtet insbesondere die Reform des Flächentarifvertrags und die Modifizierung des Günstigkeitsprinzips.
Schlüsselwörter
Betriebsnahe Lohnpolitik, Tarifautonomie, Flächentarifvertrag, Günstigkeitsprinzip, Beschäftigungssicherung, Beschäftigungsförderung, Tarifvertrag, Gewerkschaft, Arbeitgeberverband.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter 'betriebsnaher Lohnpolitik'?
Es bezeichnet die Verlagerung von Lohnentscheidungen weg vom Flächentarifvertrag hin zu individuellen Vereinbarungen auf Betriebsebene, um flexibler auf wirtschaftliche Lagen reagieren zu können.
Warum fordern Unternehmen mehr Betriebsnähe?
Viele Unternehmen empfinden Flächentarife als zu starr ("Zwangsjacke") und erhoffen sich durch betriebsnahe Lösungen eine Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und den Erhalt von Arbeitsplätzen.
Was ist das 'Günstigkeitsprinzip'?
Das Günstigkeitsprinzip besagt, dass Abweichungen vom Tarifvertrag nur zulässig sind, wenn sie für den Arbeitnehmer vorteilhafter sind. Eine Modifizierung könnte auch Abweichungen zur Beschäftigungssicherung erlauben.
Welche Risiken birgt eine Reform des Flächentarifvertrags?
Risiken sind unter anderem ein möglicher Unterbietungswettbewerb bei den Löhnen, der Verlust der Schutzfunktion des Tarifs und zunehmende Konflikte innerhalb der Belegschaft.
Welche rechtlichen Konflikte entstehen dabei?
Konflikte ergeben sich vor allem im Tarifvertragsrecht und der Betriebsverfassung, da die Tarifautonomie der Gewerkschaften durch betriebliche Öffnungsklauseln beschnitten werden könnte.
- Citation du texte
- Katja Kanngiesser (Auteur), 2004, Tarifvertrags- und betriebsverfassungsrechtliche Probleme einer betriebsnahen Lohnpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24886