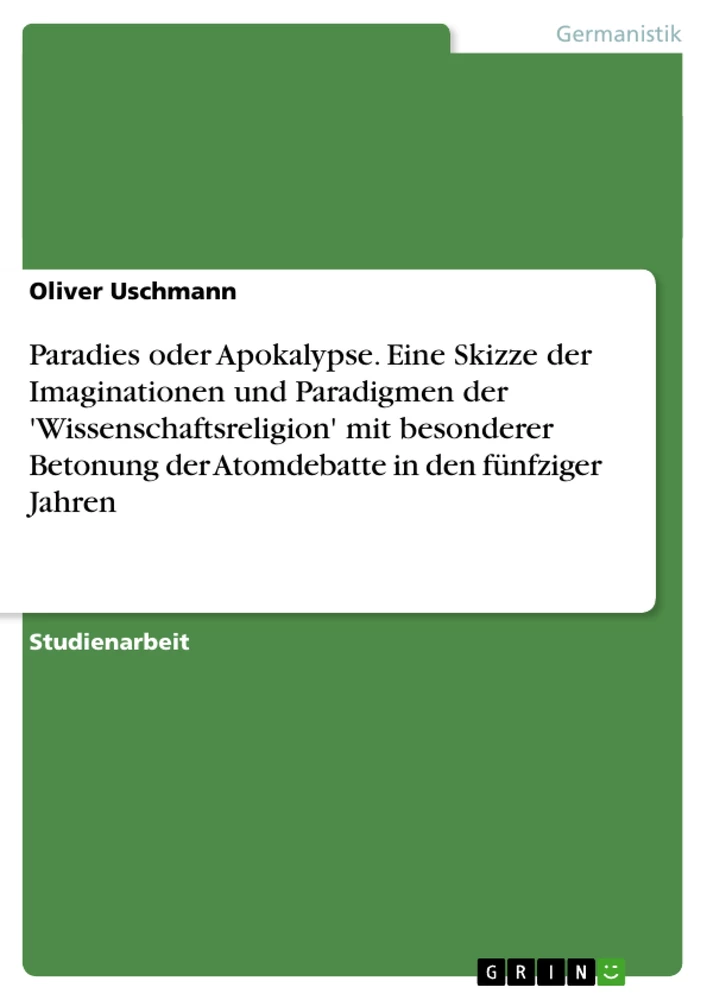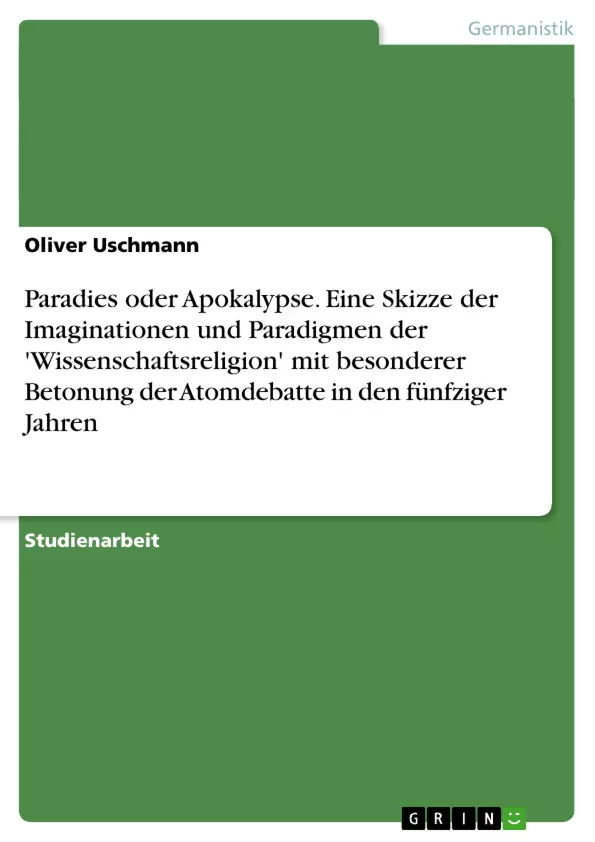Die Wissenschaft scheint uns eine Welt des Lichts. Nüchtern und skeptisch, rational und vernunftgemäß, exakt und systematisch scheint sie der einzige Bereich, der seinen Fortschritt allein durch den Versuch sichert, die eben gewonnenen Erkenntnisse gleich wieder zu falsifizieren. Trotz der Bomben von Hiroshima und Nagasaki, trotz all der Skepsis um Genforschung, künstliche Intelligenz oder Nanotechnologie gilt sie auch weiterhin als einzig rationale Produzentin von Wahrheit. Die Menschheit hat gelernt, damit umzugehen, dass diese Wahrheit manchmal hart sein kann – doch wer sonst außer der Wissenschaft könnte sie uns zeigen? Mythos und Religion, Utopie und Imagination scheinen innerhalb ihrer Methoden keine Rolle zu spielen, sind allenfalls schmückendes Beiwerk motivierender Laborgespräche, aber kein Teil des aufgeklärten Diskurses.
Der vorliegende Beitrag möchte zeigen, dass dem nicht so ist. Wissenschaftlich wie eine Hausarbeit und doch spannend wie ein Krimi enthüllt er, wie die scheinbar rationale Wissenschaft spätestens seit der Entdeckung der Kernspaltung und frühestens seit der kopernikanischen Wende selber religiöse Züge in sich trägt. Wie sie ihren Blick in eine imaginäre Zukunft wendet, diese metaphysisch mit der Vergangenheit verknüpft und sich als Erfüllerin eines Menschheitsschicksals betrachtet.
Wissenschaft - das ist auch ein Glaubenssystem. Eines, das spätestens seit der Atombombe auf Hiroshima in Bedrängnis geriet und die Dialektik seines "Fortschritts" rechtfertigen und erklären musste. Wirft man einen Blick auf diesen Diskurs der Wissenschaft, schälen sich nach und nach deutlich die roten Fäden der Argumentation heraus, welche die Imaginationen der Forscher gesponnen haben. Diese roten Fäden nimmt die Arbeit auf und legt dabei ihren Schwerpunkt auf die Debatte um die Atomkraft in den fünfziger Jahren. Von dort aus schweift der Blick auf andere Forschungsbereiche und Zeitabschnitte und zeigt, dass sich die "Wissenschaftsreligion" im gesamten Diskurs der Wissenschaft (und nicht nur im atomaren Diskurs) finden lässt. Wie damals über die Atomkraft als heiliger Gral unbegrenzter Möglichkeiten gesprochen wurde, wird heute über Gen- und Nanotechnologie geredet. Geschichte wiederholt sich. Wer das weiß, kann auch Bedenken heute weit profunder ausdrücken. Auch dazu darf dieses Büchlein eine Handreichung sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die diskursiven Paradigmen der „Wissenschaftsreligion“
- Eschatologie und Schicksal: Religiöse und mythologische Bezüge
- Die zwei Seiten der Medaille und der faustische Forscher: Die Zweieinheit von Fortschritt und Rückschritt und die Wahl zwischen Fluch und Segen
- Der Cultural Lag oder Warum die Menschen zu langsam sind
- Der Übermensch und die prometheische Scham
- Erdentwertung oder Warum wir so klein und nichtig sind
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die diskursiven Paradigmen der „Wissenschaftsreligion“, die sich in den Imaginationen und Argumentationsmustern von Wissenschaftlern manifestieren, insbesondere im Kontext der Atomdebatte der 1950er Jahre. Sie zeigt, wie die Wissenschaft, trotz ihrer selbst ernannten Rationalität und Objektivität, auf mythische, religiöse und metaphysische Bezüge zurückgreift, um ihre Forschung und ihre potentiellen Folgen zu verstehen und zu rechtfertigen.
- Die Rolle der Eschatologie und des Schicksals in der wissenschaftlichen Diskussion
- Die ambivalente Natur von wissenschaftlichem Fortschritt und die Spannung zwischen Fluch und Segen
- Die „Cultural Lag“-These und die Frage der menschlichen Fähigkeit, mit den Folgen von wissenschaftlichem Fortschritt Schritt zu halten
- Die Ideologie des Übermenschen und die prometheische Scham des Wissenschaftlers
- Die Entwertung der Erde und die Wahrnehmung des Menschen als klein und nichtig angesichts der Größe des Kosmos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die These auf, dass die Wissenschaft, insbesondere seit der Entdeckung der Kernspaltung, ihre eigene Geschichte und Zukunft durch die Brille mythischer und religiöser Bezüge betrachtet. Kapitel 2 untersucht die diskursiven Paradigmen der „Wissenschaftsreligion“, indem es auf die Rolle der Eschatologie, die Ambivalenz von Fortschritt und Rückschritt, den Cultural Lag, die prometheische Scham und die Erdentwertung eingeht. Diese Paradigmen werden anhand von Beispielen aus der Atomdebatte der 1950er Jahre veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Wissenschaftsreligion, Atomdebatte, Eschatologie, Fortschritt, Rückschritt, Cultural Lag, Übermensch, Prometheische Scham, Erdentwertung, Mythos, Religion, Metaphysik, Imagination, Diskurs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist mit dem Begriff "Wissenschaftsreligion" gemeint?
Er beschreibt die Beobachtung, dass die scheinbar rationale Wissenschaft oft religiöse, mythische und metaphysische Züge in ihrer Argumentation trägt.
Welche Rolle spielt die Atomdebatte der 50er Jahre in der Arbeit?
Die Atomkraft dient als zentrales Beispiel dafür, wie wissenschaftlicher Fortschritt entweder als "Paradies" oder als "Apokalypse" imaginiert wurde.
Was bedeutet "Cultural Lag"?
Es beschreibt das Phänomen, dass die kulturelle und moralische Entwicklung der Menschen langsamer verläuft als der technologische Fortschritt.
Was versteht man unter "prometheischer Scham"?
Dieser Begriff (nach Günther Anders) beschreibt die Scham des Menschen gegenüber der Perfektion seiner eigenen technischen Schöpfungen.
Wird die Wissenschaft heute ähnlich betrachtet wie die Atomkraft damals?
Ja, die Arbeit zieht Parallelen zwischen dem atomaren Diskurs der 50er Jahre und heutigen Debatten über Gen- und Nanotechnologie.
- Citation du texte
- Oliver Uschmann (Auteur), 2002, Paradies oder Apokalypse. Eine Skizze der Imaginationen und Paradigmen der 'Wissenschaftsreligion' mit besonderer Betonung der Atomdebatte in den fünfziger Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24892