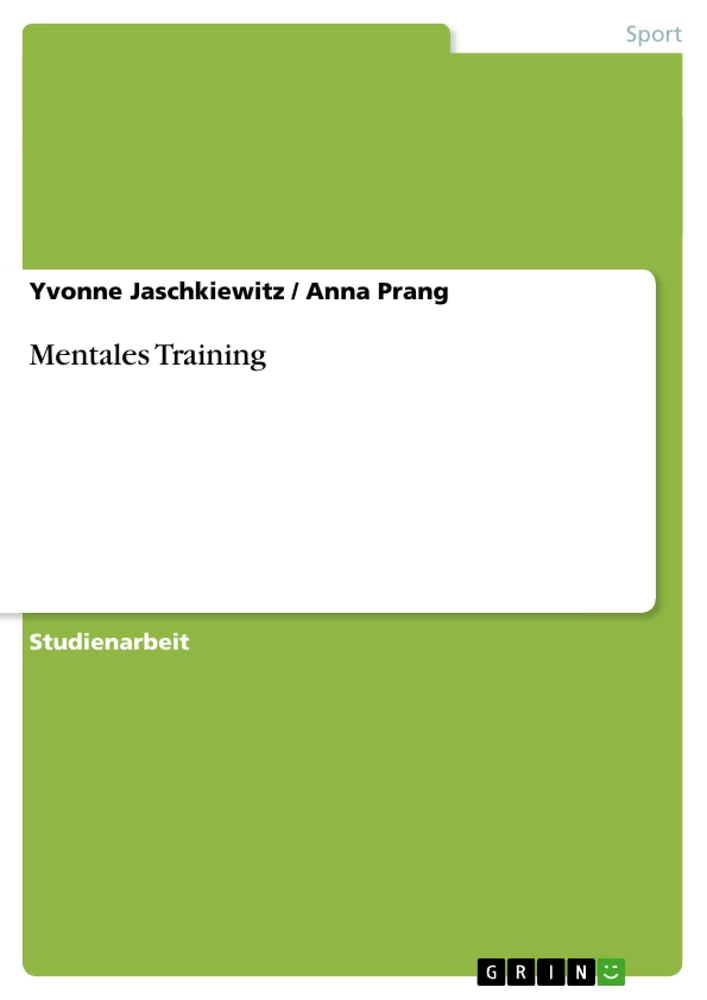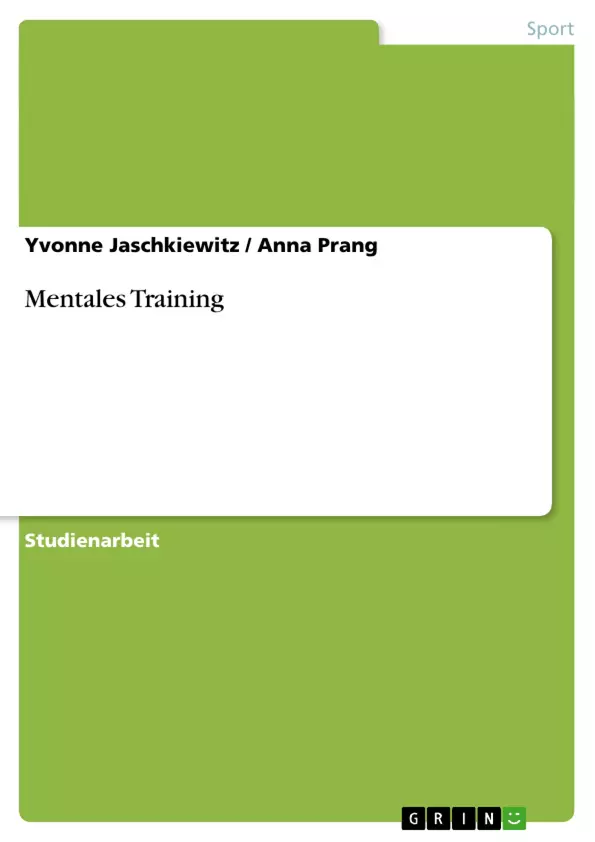Sportwissenschaftler beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit Überlegungen,
wie man Trainingsmethoden optimieren und effizienter gestalten kann. Dabei wurde
versucht, das in der kognitiven Psychologie schon seit längerer Zeit genutzte
Phänomen des mentalen Trainings, auf sportliche Bewegungsabläufe zu übertragen.
In der vorliegenden Hausarbeit wird zunächst auf die Definition und die Formen des
Mentalen Trainings einzugehen sein, um dann praxisrelevante Aspekte aufzeigen zu
können, die die Wirksamkeit vom Mentalen Training auf eine verbesserte
Bewegungsausführung nachzuweisen in der Lage sind. Im Anschluss daran wird die
Frage diskutiert, ob Mentales Training das körperlich durchzuführende Training
ersetzten kann.
Die in der Literatur für die Effizienz des Mentalen Trainings verantwortlich gemachten
Erklärungshypothesen werden auf Plausibilität geprüft. Eine empirische
Untersuchung zur Schwimmausbildung, bei der an Versuchs- und Kontrollgruppen
Daten im kognitiven und bewegungsstrukturellen Leistungsbereich erhoben und auf
statistisch signifikante Unterschiede geprüft wurden, stellt den Validierungsrahmen
für diese Ansätze dar. Dabei werden die Ergebnisse kritisch reflektiert und auf die
Erwartungen im Hinblick auf die Wirksamkeit des Mentalen Trainings bezogen.
Inhalt
1 Einleitung
2 Mentales Training als Grundform des Psychologischen Trainings
3 Definition „Mentales Training“
4 Formen des Mentalen Trainings
5 Mentales Training in der Praxis
5.1 Allgemeine Voraussetzungen für die Durchführung eines Mentalen Trainings
5.2 Ablaufphasen eines Mentalen Trainings
5.3 Ein Beispiel aus der Praxis
6 Die Wirksamkeit des Mentalen Trainings
7 Kann Mentales Training das körperlich durchgeführte Techniktraining ersetzen?
8 Erklärungsansätze
8.1 Wie lässt sich die Wirksamkeit von Mentalen Training erklären?
8.2 Emotional- motivationaler Aspekt
8.3 Ideomotorische Hypothese
8.4 Programm- Hypothese
8.5 Kognitive- Hypothese
8.6 KR- Frequenzhypothese
9 Empirische Untersuchung zur Modifikation der internen Repräsentation bewegungsstruktureller Merkmale durch Mentales Training von S. NARCISS
9.1 Problemstellung
9.2 Theoretischer Hintergrund
9.3 Methodisches zur Untersuchung
9.4 Erhebungsverfahren
9.5 Versuchspersonen und Design
9.6 Versuchsablauf
9.7 Ergebnisse
9.7.1 Kognitive Leistungen
9.7.2 Bewegungsstrukturelle Ergebnisse
10 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Sportwissenschaftler beschäftigen sich schon seit geraumer Zeit mit Überlegungen, wie man Trainingsmethoden optimieren und effizienter gestalten kann. Dabei wurde versucht, das in der kognitiven Psychologie schon seit längerer Zeit genutzte Phänomen des mentalen Trainings, auf sportliche Bewegungsabläufe zu übertragen. In der vorliegenden Hausarbeit wird zunächst auf die Definition und die Formen des Mentalen Trainings einzugehen sein, um dann praxisrelevante Aspekte aufzeigen zu können, die die Wirksamkeit vom Mentalen Training auf eine verbesserte Bewegungsausführung nachzuweisen in der Lage sind. Im Anschluss daran wird die Frage diskutiert, ob Mentales Training das körperlich durchzuführende Training ersetzten kann.
Die in der Literatur für die Effizienz des Mentalen Trainings verantwortlich gemachten Erklärungshypothesen werden auf Plausibilität geprüft. Eine empirische Untersuchung zur Schwimmausbildung, bei der an Versuchs- und Kontrollgruppen Daten im kognitiven und bewegungsstrukturellen Leistungsbereich erhoben und auf statistisch signifikante Unterschiede geprüft wurden, stellt den Validierungsrahmen für diese Ansätze dar. Dabei werden die Ergebnisse kritisch reflektiert und auf die Erwartungen im Hinblick auf die Wirksamkeit des Mentalen Trainings bezogen.
2 Mentales Training als Grundform des Psychologischen Trainings
Unter psychologischem Training versteht man Trainingsmethoden, die systematisch die psychischen Voraussetzungen des Leistungshandelns im Sport optimieren sollen. Es lassen sich drei Grundformen des psychologischen Trainings unterscheiden:
- Mentales Training (MT) unterstützt das Erlernen und Verbessern von Bewegungen und kann als psychologisches Äquivalent zum körperlichen Techniktraining gesehen werden.
- Kognitives Funktionstraining unterstützt das Anwenden von Bewegungen, indem die kognitiven Funktionen wie Wahrnehmung, Antizipation, Konzentration verbessert werden. Man siedelt diese Grundform an der Schnittstelle von Technik- und Taktiktraining an.
- Im Selbstkontrolltraining soll gelernt werden, wie ein für einen Wettkampf optimales Motivations- und Aktivierungsniveau erreicht werden kann. So können diese Trainingsverfahren dafür sorgen, dass die im Techniktraining erreichten Leistungsverbesserungen im Wettkampf umgesetzt werden können.
(vgl. BUND (in Vorber.), 1-3)
3 Definition „Mentales Training“
Eine mögliche Definition bietet folgende Aussage: „Mentales Training beinhaltet das systematische und intensive Sich-Vorstellen einer Bewegung, mit dem Ziel, diese Bewegung zu erlernen oder zu verbessern, ohne sie aber gleichzeitig praktisch auszuführen.“
4 Formen des Mentalen Trainings
Man unterscheidet innerhalb des MT drei Formen:
- Im subvokalen Training sagt man sich den zu trainierenden Bewegungsablauf als Selbstgespräch oder Selbstinstruktion vor. Diese Form bietet eine gute Einstiegsmöglichkeit in das MT.
- Beim ideomotorischen Training nimmt der Sportler eine Innenperspektive ein, wobei er sich in seine eigene Bewegung hineinversetzt. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Schwimmer beim Vorstellen spürt, wie er aufgrund seiner Bewegung durch das Wasser gleitet.
- Im Gegensatz dazu soll beim verdeckten Wahrnehmungstraining die Außenperspektive eingenommen werden. Der Sportler stellt sich dabei vor „seinem geistigen Auge“ den Bewegungsablauf vor.
(vgl. BUND (in Vorber.), 4-5)
5 Mentales Training in der Praxis
5.1 Allgemeine Voraussetzungen für die Durchführung eines Mentalen Trainings
Die praktische Umsetzung eines MT fällt Trainern und Sportlern am Anfang nicht leicht. Daher gibt es einige Aspekte, denen bei der Durchführung besondere Beachtung geschenkt werden sollte:
Grundvoraussetzung ist ein entspannter Zustand des Sportlers. Das bedeutet einerseits, dass er den Kopf frei haben muss und andererseits, dass er sich gleichzeitig voll konzentrieren können muss. Außerdem muss der Sportler über ein Minimum an Eigenerfahrung mit der Bewegung verfügen, wobei sich gezeigt hat, dass eine körperliche Ausführung ausreicht. Weiterhin muss die Bewegungsvorstellung an die Eigenperspektive des Sportlers angepasst sein, das heißt, sie sollte dessen konditionelles und technisches Leistungsniveau widerspiegeln. Bedingung ist auch, dass ein Mentales Training im Wechsel mit körperlichem Training durchgeführt wird, da so Gefühle, die beim Techniktraining empfunden wurden, leichter abgerufen werden können. Selbstinstruktionen sollten dem Bewegungsablauf als Unterstützung dienen, da so „Störungen“ vorgebeugt werden kann, z.B. das Vorstellen eines Sturzes.
5.2 Ablaufphasen eines Mentalen Trainings
Man unterscheidet zwischen fünf Lernphasen des Mentalen Trainings:
- In der ersten Phase wird die Handlung, das heißt die Bewegung, die trainiert werden soll, vom Trainer laut beschrieben und aufgeschrieben.
- In der zweiten Phase passiert dasselbe wie in Phase 1, nur wird diesmal vom Sportler die Bewegung selbst durchgeführt.
- In der dritten Phase wird die Handlung subvokal beschrieben, wobei dies solange wiederholt wird, bis der Sportler in der Lage ist, die Bewegung jederzeit abzurufen.
- In der vierten Phase werden die „Knotenpunkte“ der Bewegung subvokal beschrieben. Unter „Knotenpunkten“ versteht man Stellen im Bewegungsablauf, die die Qualität der Ausführung entscheidend bestimmen.
„Knotenpunkte sind beim Tennisaufschlag beispielsweise das Ballhochwerfen (1.
Knotenpunkt), die Bogenspannung (2. Knotenpunkt), die Schlägerrückführung
(3. Knotenpunkt), die Streckung (4. Knotenpunkt) und das Abklappen des
Schlägers (5. Knotenpunkt). Wird der Ball nicht optimal hochgeworfen, ist es
nicht möglich, den Aufschlag richtig auszuführen.
- In der fünften Phase werden die Knotenpunkte symbolisch markiert, das heißt sie werden mit einer verbalen Kurzformel versehen, so dass ein schneller Abruf möglich ist. Im Idealfall stellt die Kurzformel einen doppelten Bezug zur Bewegung her, nämlich inhaltlich und in ihrer Länge.“ Ein Diskuswerfer (…) hat z.B. seine Knotenpunkte mit folgender Symbolik markiert: Laaang (Eindrehen) – Sta (Landung zur Wurfauslage) – Pap (Abwurf).“
(vgl. EBERSPÄCHER 1990a, 78-80)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Mentalem Training?
Mentales Training ist das systematische und intensive Sich-Vorstellen einer Bewegung mit dem Ziel, diese zu erlernen oder zu verbessern, ohne sie praktisch auszuführen.
Welche drei Formen des Mentalen Trainings gibt es?
Man unterscheidet das subvokale Training (Selbstgespräch), das ideomotorische Training (Innenperspektive) und das verdeckte Wahrnehmungstraining (Außenperspektive).
Kann Mentales Training das körperliche Training ersetzen?
Nein, es dient als Ergänzung. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Mentales Training im Wechsel mit praktischer Ausführung durchgeführt wird.
Was sind die Voraussetzungen für erfolgreiches Mentales Training?
Wichtige Faktoren sind ein entspannter Zustand, hohe Konzentrationsfähigkeit und ein Minimum an eigener praktischer Erfahrung mit der Bewegung.
Was versteht man unter „Knotenpunkten“?
Knotenpunkte sind kritische Stellen im Bewegungsablauf, die die Qualität der gesamten Ausführung maßgeblich bestimmen und im Training symbolisch markiert werden.
Welche wissenschaftlichen Hypothesen erklären die Wirksamkeit?
Diskutiert werden unter anderem die ideomotorische Hypothese, die Programm-Hypothese und die kognitive Hypothese.
- Citation du texte
- Yvonne Jaschkiewitz (Auteur), Anna Prang (Auteur), 2004, Mentales Training, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24968