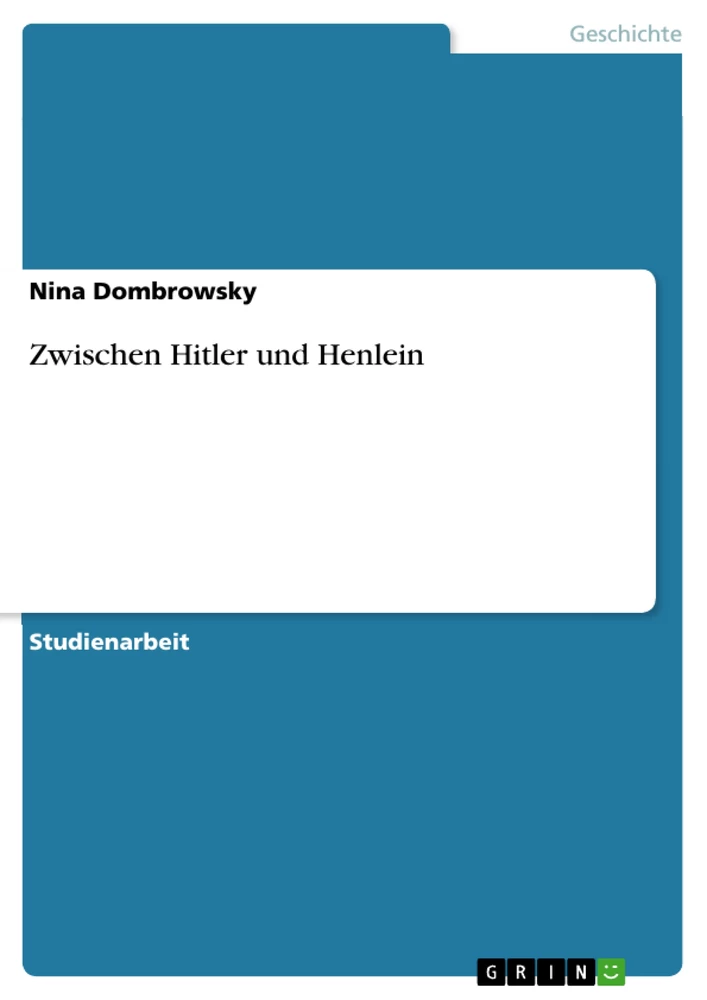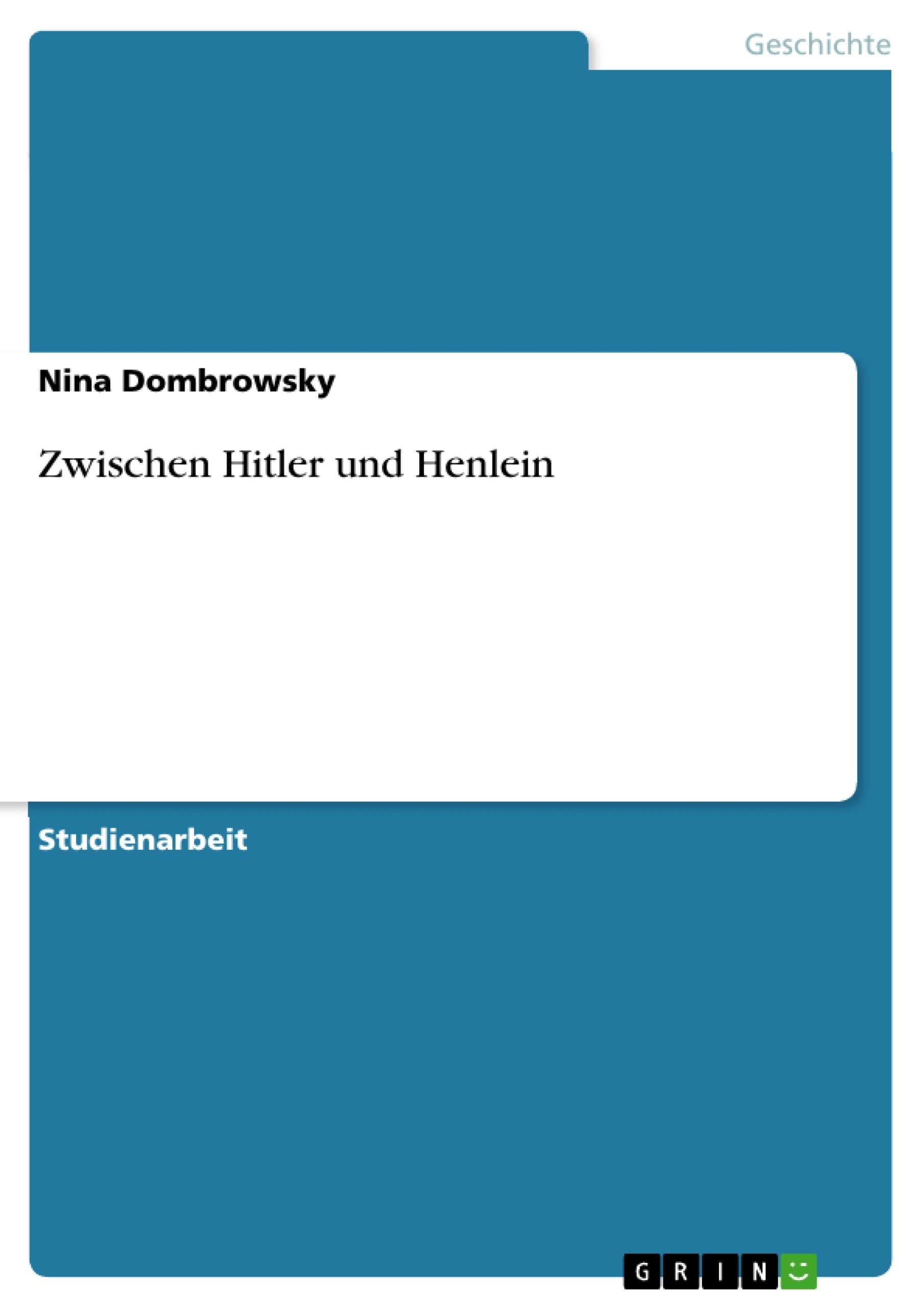Im wesentlichen gliedert sich die Arbeit in drei Teile.
Im ersten wird die Politik der DSAP ab der Gründung der Ersten Tschechoslowakischen Republik 1918 bis zur Parteispaltung 1921 dargestellt und die Frage untersucht, ob es sich - trotz des Fehlens einer konkreten nationalsozialistischen Gefahr, wie sie sich später in Parteien wie der DNSAP und SHF/SdP sowie in der Machtergreifung Hitlers im benachbarten Deutschen Reich manifestierte - schon um eine Politik des Widerstands handelte. Auch die Rahmenbedingungen, in denen die DSAP ihre Politik in den schwierigen Anfangsjahren der jungen Republik entwickeln musste, werden hier kurz vorgestellt.
Der zweite Teil greift die Zeit ab dem Eintreten sudetendeutscher Parteien in die Prager Regierung im Jahr 1926 bis zum Verbot der ,,Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei" (DNSAP) 1933 auf. Hier begegnete die DSAP das erste Mal der realen Bedrohung durch den aufsteigenden Nationalsozialismus und musste sich angesichts erheblicher Stimmenverluste kritisch mit der eigenen Politik auseinandersetzen. Ob dies gelungen war, wird hier kurz zu zeigen versucht. In einem zweiten Abschnitt beschäftigt sich dieser Teil auch mit den Beziehungen, die ab der Machtübernahme Adolf Hitlers zu der reichsdeutschen Schwesterpartei bestanden.
Der Aufstieg der ,,Sudetendeutschen Heimatfront" (SHF) und der Kampf der sudetendeutschen Sozialdemokratie gegen eine gewaltsame großdeutsche Lösung der ,,Sudetenfrage" bis zum Anschluss der sudetendeutschen Gebiete an das faschistische ,,Dritte Reich" ist Bestandteil des dritten und letzten Teils meiner Arbeit.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Begriffsdefinition
- 1.2. Zur Problematik des Widerstandsbegriffs
- 2. Von den Anfängen des Aktivismus bis zur Parteispaltung
- 2.1. Äußere Bedingungen
- 3. Von der ersten deutschen Regierungsbeteiligung bis zum Verbot der DNSAP
- 3.1. Die Beziehungen der DSAP zur reichsdeutschen Schwesterpartei SPD
- 4. Vom Aufstieg der DSAP bis zum Anschluss der sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das politische Wirken der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei (DSAP) von 1918 bis 1938. Im Fokus steht der Kampf der DSAP für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. Die Arbeit analysiert die Strategien der DSAP angesichts des aufkommenden Nationalsozialismus und hinterfragt, warum es ihr nicht gelang, der nationalsozialistischen Propaganda erfolgreich entgegenzutreten.
- Der Kampf der DSAP um ein friedliches Zusammenleben von Tschechen und Sudetendeutschen.
- Die Strategien der DSAP im Umgang mit dem aufsteigenden Nationalsozialismus.
- Die Rolle der DSAP in der tschechoslowakischen Politik.
- Die Frage nach der Kollektivschuld der Sudetendeutschen.
- Der wissenschaftliche Diskurs um den Begriff des Widerstands.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Aktualität der Thematik angesichts aktueller nationaler Konflikte und führt in die Arbeit ein. Sie umreißt den Forschungsgegenstand – das politische Wirken der DSAP in der Ersten Tschechoslowakischen Republik – und formuliert zentrale Forschungsfragen. Die Arbeit hinterfragt die gängige These der Kollektivschuld der Sudetendeutschen und die bisherige Vernachlässigung des auslandsdeutschen Widerstands in der Geschichtswissenschaft. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und definiert wichtige Begriffe wie "Faschismus" und "Nationalsozialismus".
2. Von den Anfängen des Aktivismus bis zur Parteispaltung: Dieses Kapitel beschreibt die Politik der DSAP von der Gründung der Tschechoslowakei 1918 bis zur Parteispaltung 1921. Es analysiert die Handlungen der DSAP in den schwierigen Anfangsjahren der jungen Republik und untersucht, ob deren Politik bereits als Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewertet werden kann, obwohl zu diesem Zeitpunkt die nationalsozialistische Gefahr noch nicht so akut war wie später. Die Kapitel beleuchtet auch die äußeren Bedingungen, unter denen die DSAP agierte.
3. Von der ersten deutschen Regierungsbeteiligung bis zum Verbot der DNSAP: Das Kapitel behandelt die Zeit von 1926 bis 1933, in der sudetendeutsche Parteien an der Prager Regierung beteiligt waren. Es fokussiert auf die Konfrontation der DSAP mit der realen Bedrohung durch den aufsteigenden Nationalsozialismus und die Auseinandersetzung mit den eigenen politischen Fehlern angesichts von Stimmenverlusten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Beziehungen zur reichsdeutschen SPD nach der Machtübernahme Hitlers.
4. Vom Aufstieg der DSAP bis zum Anschluss der sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich: Dieser Abschnitt analysiert den Aufstieg der Sudetendeutschen Heimatfront (SHF) und den Kampf der sudetendeutschen Sozialdemokratie gegen eine gewaltsame Lösung der Sudetenfrage bis zum Anschluss an das Deutsche Reich 1938. Es wird untersucht, wie die DSAP versuchte, den Anschluss zu verhindern und welche Strategien eingesetzt wurden. Das Kapitel beleuchtet den Kontext und die Folgen der Ereignisse.
Schlüsselwörter
Sudetendeutsche Sozialdemokratie (DSAP), Nationalsozialismus, Faschismus, Widerstand, Tschechoslowakei, Sudetenfrage, deutsch-tschechisches Verhältnis, Kollektivschuld, friedliches Zusammenleben, nationaler Aktivismus, politische Repression.
Häufig gestellte Fragen zum politischen Wirken der DSAP in der Tschechoslowakei (1918-1938)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das politische Wirken der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei (DSAP) von 1918 bis 1938. Der Fokus liegt auf dem Kampf der DSAP für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben zwischen Tschechen und Sudetendeutschen und der Analyse ihrer Strategien angesichts des aufkommenden Nationalsozialismus.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Kampf der DSAP um friedliches Zusammenleben, ihre Strategien im Umgang mit dem Nationalsozialismus, ihre Rolle in der tschechoslowakischen Politik, die Frage der Kollektivschuld der Sudetendeutschen und den wissenschaftlichen Diskurs um den Begriff des Widerstands.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit abgedeckt?
Die Arbeit umfasst die gesamte Zeitspanne von 1918, der Gründung der Tschechoslowakei, bis 1938, dem Anschluss der sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich. Sie ist in vier Kapitel unterteilt, die jeweils unterschiedliche Phasen dieser Periode behandeln.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, vier Hauptkapitel und ein Fazit. Die Kapitel behandeln chronologisch den Werdegang der DSAP, von ihren Anfängen bis zum Anschluss. Jedes Kapitel fasst einen spezifischen Zeitraum und wichtige Ereignisse zusammen.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Die Arbeit hinterfragt die gängige These der Kollektivschuld der Sudetendeutschen und die bisherige Vernachlässigung des auslandsdeutschen Widerstands in der Geschichtswissenschaft. Sie analysiert die Strategien der DSAP und untersucht, warum es ihr nicht gelang, der nationalsozialistischen Propaganda erfolgreich entgegenzutreten.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Sudetendeutsche Sozialdemokratie (DSAP), Nationalsozialismus, Faschismus, Widerstand, Tschechoslowakei, Sudetenfrage, deutsch-tschechisches Verhältnis, Kollektivschuld, friedliches Zusammenleben, nationaler Aktivismus und politische Repression.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung) stellt den Kontext und die Forschungsfrage dar. Kapitel 2 behandelt die Anfänge des Aktivismus bis zur Parteispaltung (1918-1921). Kapitel 3 fokussiert auf die Zeit der Regierungsbeteiligung bis zum Verbot der DNSAP (1926-1933). Kapitel 4 analysiert den Aufstieg der SHF und den Kampf gegen den Anschluss (bis 1938). Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Quellen wurden verwendet? (Nicht im gegebenen Text enthalten, aber relevant für eine vollständige FAQ)
Diese Frage kann aufgrund der fehlenden Informationen im gegebenen Text nicht beantwortet werden. Eine vollständige Arbeit würde hier die benutzten Quellen auflisten.
- Citar trabajo
- Nina Dombrowsky (Autor), 2001, Zwischen Hitler und Henlein, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2501