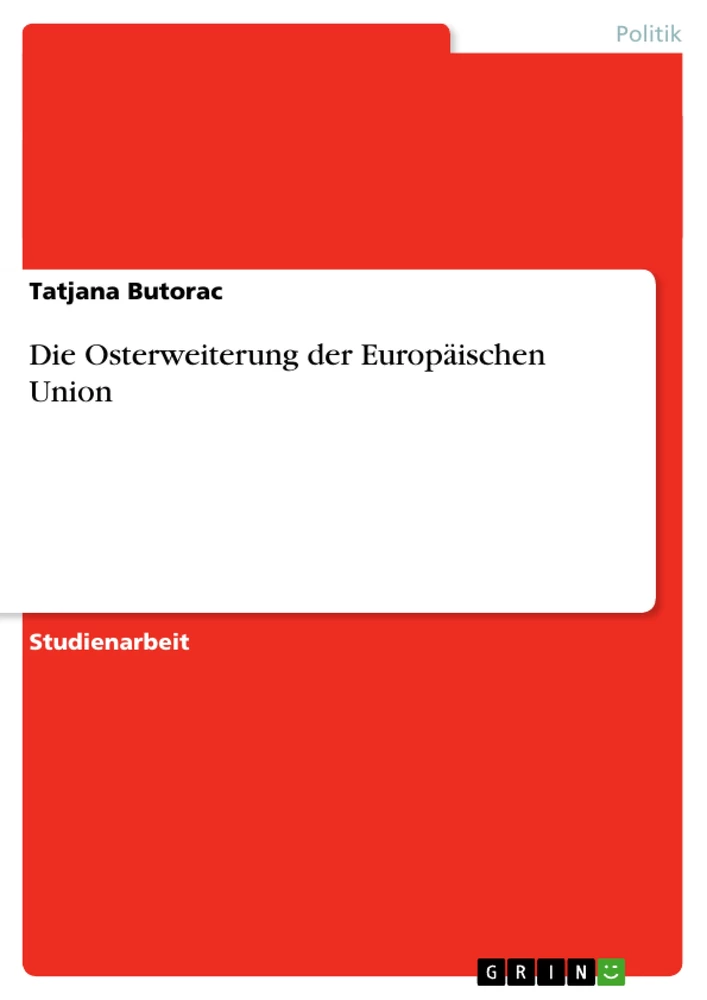Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs steht der Europäischen Union (EU) mit der Integration der ehemaligen Ostblockstaaten in ein demokratisches und marktwirtschaftliches Europa eine schwierige Herausforderung bevor. Die Osterweiterung übersteigt die Dimensionen sämtlicher bisheriger Erweiterungsrunden. Allein die hohe Anzahl der Beitrittswilligen, die eine Eingliederung in die fünfzehner Gemeinschaft anstrebt, ist problematisch. So besteht die 1.Gruppe der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten aus Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Estland und Slowenien. Rumänien, Bulgarien, Litauen, Lettland und die Slowakische Republik bilden die 2.Gruppe. Die Mittelmeerländer Zypern und Malta sind ebenfalls in diesen beiden Gruppen eingegliedert. Die Türkei ist seit 1999 formell als Beitrittskandidat anerkannt worden.
Alle mittel- und osteuropäischen Bewerber verfolgen das Ziel einer Rückkehr nach Europa und einer Einbindung in die militärische Bündnisstruktur des Westens. Dadurch ergibt sich die besondere sicherheitspolitische Lage, vor allem hinsichtlich der Sicherung und Stabilisierung zukünftiger Grenzen. Die wirtschaftliche Integration der ökonomisch rückständigen Länder und damit zukünftigen Nettoempfängern, ist sehr problematisch. Die Eingliederung der 1.Runde lässt beispielsweise die EU- Bevölkerungszahl auf 500 Millionen wachsen, während das gesamte Bruttoinlandsprodukt aber lediglich um höchstens 5% ansteigt.
Angesichts der mit der Osterweiterung einhergehenden Herausforderungen, schreibt der ehemalige Präsident der Kommission Jacques Santer: „Oft empfiehlt sich bei der Bewältigung neuer Herausforderungen ein Blick auf bereits Erreichtes. Nicht als Akt der Selbstgerechtigkeit, sondern um Kraft und Selbstvertrauen für die Zukunft zu schöpfen. Denn Europa braucht angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts Vertrauen in die eigene Kraft.“ Ziel dieser Arbeit ist es bestimmte Sachverhalte im Zusammenhang mit der Osterweiterung der Europäischen Union zu analysieren. Schwerpunkte bilden dabei zunächst der Annäherungsprozess zwischen der EU und den Beitrittsaspiranten aus geschichtlicher Perspektive, der Beitrittsprozess sowie die Beitrittshilfen. Der anschließende Teil beinhaltet speziell ausgesuchte Themenfelder, die hinsichtlich der Osterweiterung vor allem in der Öffentlichkeit debattiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Etappen auf dem Weg zur Osterweiterung der EU
- 2.1 Europaabkommen
- 2.2 Die Kopenhagener Wende
- 2.3 Die Essener Aufnahmekriterien
- 2.4 Der Amsterdamer Vertrag
- 2.5 Die Luxemburger Heranführungsstrategie
- 2.6 Nizza
- 3. Der Beitrittsprozess und die Bedingungen für einen Eintritt in die EU
- 3.1 Grundvoraussetzungen
- 3.2 Prinzipien und Verfahren des Beitrittsprozesses
- 3.3 Beitrittsvorbereitungen und – hilfen
- 3.4 Analytische Prüfung des aquis communautaire
- 4. Spezielle Problemfelder im Zusammenhang mit der Osterweiterung
- 4.1 Befürchtung einer Massenauswanderung
- 4.2 Erwartete ökonomische Auswirkungen einer Erweiterung
- 4.3 Wachsende Europa- Skepsis in den Kandidatenländern
- 4.4 Zukunftsfähigkeit einer erweiterten Union
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, bestimmte Sachverhalte im Zusammenhang mit der Osterweiterung der Europäischen Union zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Annäherungsprozess zwischen der EU und den Beitrittsaspiranten aus historischer Perspektive, dem Beitrittsprozess sowie den Beitrittshilfen. Der anschließende Teil beleuchtet speziell ausgewählte Themenfelder, die hinsichtlich der Osterweiterung vor allem in der Öffentlichkeit debattiert werden.
- Der Annäherungsprozess zwischen der EU und den Beitrittsaspiranten
- Der Beitrittsprozess und die damit verbundenen Bedingungen
- Beitrittshilfen für die Beitrittskandidaten
- Spezialproblemfelder im Zusammenhang mit der Osterweiterung, wie z.B. die Befürchtung einer Massenauswanderung und die erwarteten ökonomischen Auswirkungen
- Die Zukunftsfähigkeit einer erweiterten Union
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Einleitung und skizziert die Herausforderungen der Osterweiterung für die Europäische Union. Es werden die wichtigsten Beitrittskandidaten vorgestellt und die besonderen Herausforderungen der Integration von osteuropäischen Ländern in die EU beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Etappen auf dem Weg zur Osterweiterung der EU und zeichnet die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und den Beitrittskandidaten nach, beginnend mit den Europaabkommen und der Kopenhagener Wende bis hin zur Luxemburger Heranführungsstrategie.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Beitrittsprozess und den Bedingungen für einen Eintritt in die EU. Dabei werden die Grundvoraussetzungen, die Prinzipien und Verfahren des Beitrittsprozesses sowie die Beitrittsvorbereitungen und -hilfen beleuchtet. Auch die analytische Prüfung des aquis communautaire wird in diesem Kapitel behandelt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit speziellen Problemfeldern im Zusammenhang mit der Osterweiterung. Hier werden Themen wie die Befürchtung einer Massenauswanderung, die erwarteten ökonomischen Auswirkungen einer Erweiterung, die wachsende Europa-Skepsis in den Kandidatenländern und die Zukunftsfähigkeit einer erweiterten Union behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Osterweiterung der Europäischen Union und den damit verbundenen Herausforderungen. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: EU-Osterweiterung, Beitrittsprozess, Beitrittsbedingungen, Europaabkommen, Kopenhagener Kriterien, aquis communautaire, Massenauswanderung, ökonomische Auswirkungen, Europa-Skepsis, Zukunftsfähigkeit, Transformation, Integration, Demokratie, Marktwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kopenhagener Kriterien für den EU-Beitritt?
Diese Kriterien umfassen politische Stabilität (Demokratie, Rechtsstaatlichkeit), eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, die Verpflichtungen der EU-Mitgliedschaft (Acquis communautaire) zu übernehmen.
Welche Länder gehörten zur ersten Welle der EU-Osterweiterung?
Zur ersten Gruppe der mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten gehörten Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Estland und Slowenien.
Welche wirtschaftlichen Herausforderungen brachte die Osterweiterung mit sich?
Die Integration ökonomisch rückständigerer Länder führte zu Diskussionen über Nettoempfänger-Positionen, da die Bevölkerung stark wuchs, das BIP der EU jedoch nur geringfügig anstieg.
Was bedeutet der Begriff „Acquis communautaire“?
Es handelt sich um den gesamten gemeinsamen Rechtsbesitz der EU, den jeder Beitrittskandidat vollständig in nationales Recht überführen muss.
Gab es Befürchtungen bezüglich einer Massenwanderung?
Ja, in der öffentlichen Debatte der alten Mitgliedsstaaten gab es große Sorgen vor einer unkontrollierten Zuwanderung von Arbeitskräften aus den neuen osteuropäischen Mitgliedsländern.
- Quote paper
- Tatjana Butorac (Author), 2002, Die Osterweiterung der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25073