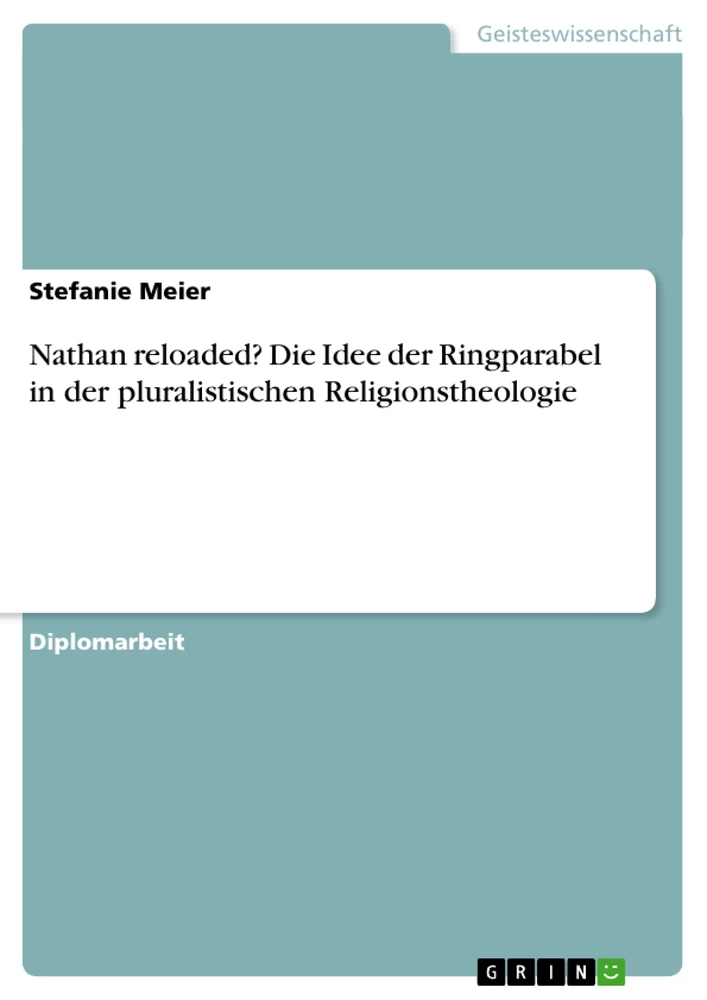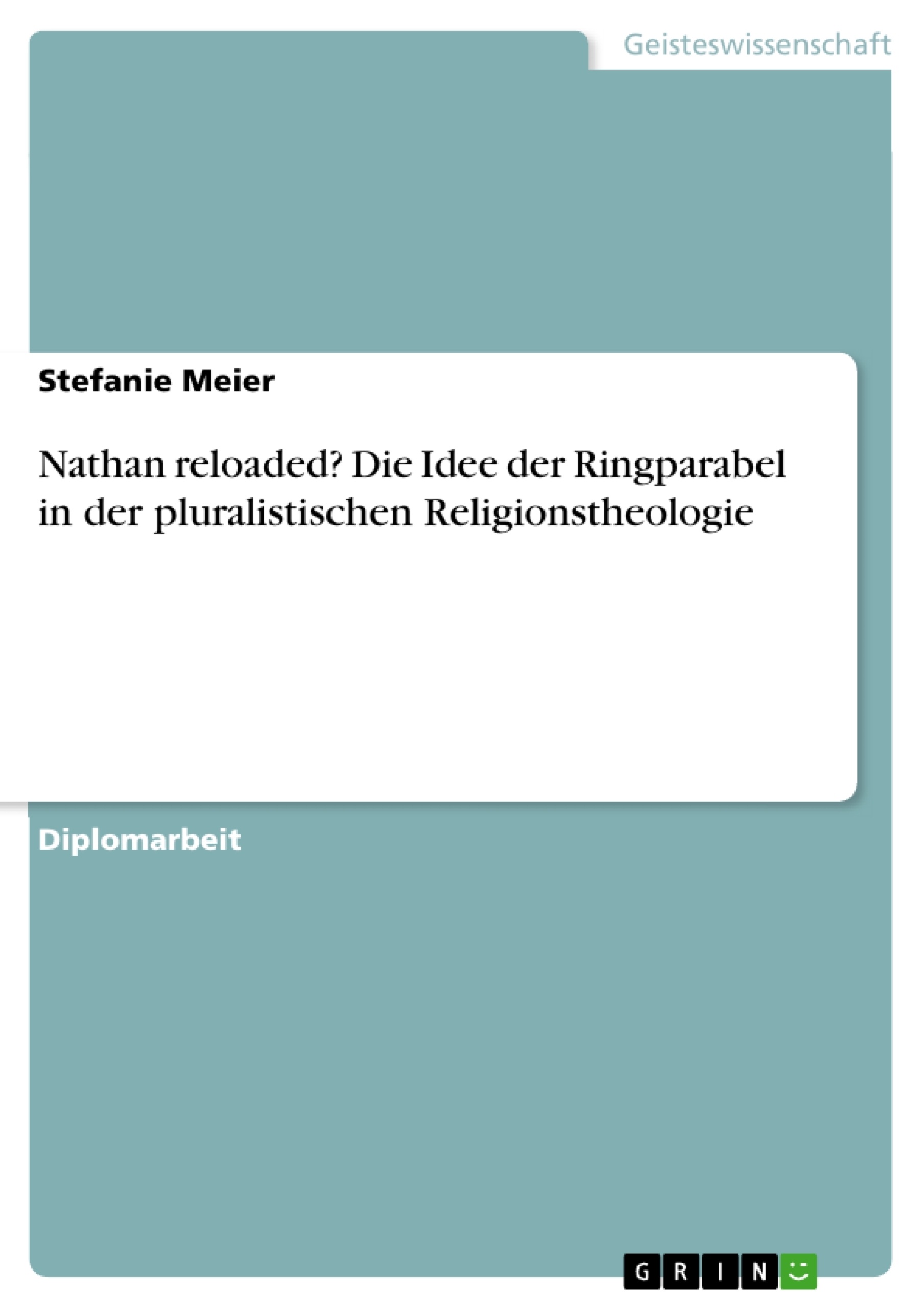"Mama, kommen alle Menschen in den Himmel?"
Als kleines Mädchen stellte ich diese Frage meiner Mutter. Was der Auslöser dieser Frage war, weiß ich leider nicht mehr, aber sie beschäftigte mich immer wieder. Ich fragte mich: Was passiert nach dem Tod mit Menschen, die Jesus nicht kennen lernen konnten, Menschen, die vor Jesus gelebt hatten oder auf einem fernen Kontinent so wie die Indianer? Was geschieht mit dem Dalai Lama oder meinem türkischen Nachbarmädchen, wenn sie sterben? Sind sie für ewig verdammt, obwohl sie ein Leben lang versucht hatten, gut zu leben? Die Vorstellung, dass Ureinwohner Australiens oder Chinesen nicht in den Himmel kommen sollten, nur weil sie Jesus nicht kannten, erschreckte mich zutiefst. Das wollte und konnte ich nicht akzeptieren und das passte auch überhaupt nicht in meine kindliche Vorstellung vom "Lieben Gott". Die diplomatische Antwort meiner Mutter damals, auf Gott zu vertrauen, weil er einen liebevollen Plan für alle Menschen hat, beruhigte mich - vorläufig.
Die weltpolitischen Entwicklungen seit dem 11. September 2001 zeigen, dass die Frage des Zusammenlebens der Religionen immer mehr zu einer Überlebensfrage der Menschheit wird. Extremistische religiöse Kleingruppen schüren ein Klima der Intoleranz und schrecken auch nicht davor zurück, im Namen der Religion Gewalttaten zu verüben.
Aber auch in der europäischen Politik werden religiöse Fragen immer drängender: Soll Gott in der Verfassung stehen? Dürfen Schülerinnen Kopftücher tragen? Soll es islamischen Religionsunterricht geben?
Diese Fragen und Problematiken, die ich kurz angeschnitten habe, sollen aufzeigen, dass ein konstruktiver Dialog mit den anderen Weltreligionen nötiger ist als je zuvor. Doch wie kann ein solcher Dialog aussehen, wenn wir Christen einen absoluten Wahrheitsanspruch vertreten? Artet dann der Dialog nicht in Mission aus? Oder bedeutet tolerant sein, nicht nur den eigenen Standpunkt zu hinterfragen, sondern auch ihn nicht mehr zu vertreten?
Die gesellschaftlichen Ereignisse weisen uns darauf hin, wie dringend wir uns der Frage stellen müssen, inwieweit Toleranz und Identität in einer multikulturellen Gesellschaft zu vereinbaren sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. LESSING UND DIE IDEE DER RINGPARABEL
- 1. WER WAR GOTTHOLD EPHRAIM LESSING?
- 1.1 EIN SCHRIFTSTELLER DES 18. JAHRHUNDERTS
- 1.2 EINBLICKE IN LESSINGS LEBEN
- 1.3 SEIN KAMPF UM TOLERANZ ODER DER FRAGMENTENSTREIT
- 2. NATHAN DER WEISE
- 3. LESSINGS ANSATZ
- II. ZUR EINORDNUNG DER PLURALISTISCHEN RELIGIONSTHEOLOGIE: DIE RICHTUNGEN EXKLUSIVISMUS UND INKLUSIVISMUS
- 1. DER EXKLUSIVISMUS
- 2. DER INKLUSIVISMUS - CHRISTUS ÜBER DEN RELIGIONEN
- 3. EINE GEGENPOSITION ENTSTEHT
- III. DIE PLURALISTISCHE RELIGIONSTHEOLOGIE
- 1. DER PLURALISTISCHE ANSATZ - CHRISTUS UND DIE RELIGIONEN
- 2. KRITIK AN DER PLURALISTISCHEN RELIGIONSTHEOLOGIE
- 3. GIBT ES EINE ALTERNATIVE?
- EXKURS: DER INTERIORISMUS
- 1. DER INTERIORISMUS - EINE NEUE RICHTUNG?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Idee der Ringparabel in Lessings "Nathan der Weise" im Kontext der pluralistischen Religionstheologie. Sie analysiert Lessings Leben und Werk, um seine Motivation für die Entwicklung dieser Parabel zu verstehen. Weiterhin wird die Arbeit die verschiedenen theologischen Positionen des Exklusivismus und Inklusivismus beleuchten und diese mit dem pluralistischen Ansatz vergleichen.
- Lessings Leben und Werk im Kontext der Aufklärung und Toleranzdebatte
- Die Bedeutung der Ringparabel in "Nathan der Weise"
- Der Vergleich von exklusivistischen, inklusivistischen und pluralistischen Religionstheologien
- Analyse der Kritik an der pluralistischen Religionstheologie
- Alternativen zur pluralistischen Religionstheologie
Zusammenfassung der Kapitel
I. LESSING UND DIE IDEE DER RINGPARABEL: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Leben und Werk Gotthold Ephraim Lessings, wobei der Schwerpunkt auf seinem Kampf für Toleranz und seinen Auseinandersetzungen mit den religiösen Strömungen seiner Zeit liegt. Es beleuchtet Lessings Kontext innerhalb der Aufklärung und der Toleranzdebatte des 18. Jahrhunderts, einschließlich der Lebenssituation der Juden und des Islambildes dieser Epoche. Die Analyse seines Theaterstücks "Die Juden" und der "Fragmente Reimarus", sowie die Auseinandersetzung mit Pastor Goeze, führt schließlich zur Präsentation von "Nathan der Weise" als Lessings Antwort auf die religiösen Konflikte seiner Zeit. Die Bedeutung von Lessings Engagement für Toleranz und seine philosophischen Ansätze werden detailliert untersucht und bilden die Grundlage für das Verständnis seiner Ringparabel.
II. ZUR EINORDNUNG DER PLURALISTISCHEN RELIGIONSTHEOLOGIE: DIE RICHTUNGEN EXKLUSIVISMUS UND INKLUSIVISMUS: Das Kapitel liefert einen detaillierten Überblick über den Exklusivismus und Inklusivismus in der Religionstheologie. Es untersucht die historische Entwicklung des Exklusivismus, seine Kritik im 20. Jahrhundert durch Denker wie Ernst Troeltsch und Karl Barth und seine heutige Relevanz. Im Anschluss wird der Inklusivismus, insbesondere der Ansatz Karl Rahners, ausführlich analysiert, unter Berücksichtigung theologischer Bausteine wie der Lehre vom Logos Spermatikos und der Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Kapitel beleuchten die Entwicklung des Inklusivismus von seinen historischen Wurzeln bis zu den lehrämtlichen Aussagen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und diskutiert die heutige Kritik an diesem Ansatz. Der Vergleich beider Positionen schafft ein differenziertes Verständnis der unterschiedlichen Perspektiven im Umgang mit religiöser Vielfalt.
III. DIE PLURALISTISCHE RELIGIONSTHEOLOGIE: Dieses Kapitel widmet sich der pluralistischen Religionstheologie, insbesondere dem Ansatz John Hicks. Es analysiert Hicks' Konzept des Glaubens, seine "Pluralistische Hypothese" als Antwort auf fundamentale Fragen des Glaubens und seine Verschiebung von der Christozentrik zur Soteriozentrik. Das Kapitel beleuchtet Hicks’ Argumentation für den Wert religiöser Vielfalt und sein modifiziertes Verständnis der Inkarnation. Die Arbeit analysiert die Kritik an der pluralistischen Religionstheologie, die sich unter anderem auf das Offenbarungsverständnis, christologische Fragen und die Behandlung von Absolutheitsansprüchen verschiedener Religionen konzentriert. Die lehrämtliche Kritik, etwa in "Dominus Jesus", wird ebenfalls einbezogen. Das Kapitel schließt mit einer kurzen Betrachtung möglicher Alternativen zum pluralistischen Ansatz.
EXKURS: DER INTERIORISMUS - EINE NEUE RICHTUNG?: Der Exkurs stellt den Interiorismus als alternative Richtung in der Religionstheologie vor. Er analysiert den Ansatz Gerhard Gädes und beleuchtet kritisch die Argumente und die Problematik dieses Ansatzes. Die Stärken und Schwächen des Interiorismus werden im Verhältnis zu den zuvor besprochenen Positionen gewürdigt, um ein umfassendes Bild der verschiedenen theologischen Perspektiven zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Ringparabel, Lessing, Nathan der Weise, Pluralistische Religionstheologie, Exklusivismus, Inklusivismus, Toleranz, Aufklärung, John Hick, Karl Rahner, Religiöse Vielfalt, Offenbarung, Christologie.
Häufig gestellte Fragen zu "Lessing und die Idee der Ringparabel im Kontext der Pluralistischen Religionstheologie"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ringparabel in Lessings "Nathan der Weise" im Kontext der pluralistischen Religionstheologie. Sie analysiert Lessings Leben und Werk, um seine Motivation für die Entwicklung dieser Parabel zu verstehen und vergleicht verschiedene theologische Positionen (Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Lessings Leben und Werk im Kontext der Aufklärung und Toleranzdebatte, die Bedeutung der Ringparabel, den Vergleich verschiedener Religionstheologien (Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus), Kritik an der pluralistischen Religionstheologie und mögliche Alternativen, wie den Interiorismus.
Welche theologischen Positionen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Exklusivismus, den Inklusivismus und die pluralistische Religionstheologie. Der Exklusivismus und der Inklusivismus werden detailliert dargestellt, inklusive ihrer historischen Entwicklung und Kritik. Der pluralistische Ansatz, insbesondere der von John Hick, wird analysiert und mit den anderen Positionen verglichen.
Wer ist Gotthold Ephraim Lessing und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
Gotthold Ephraim Lessing ist ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit. Seine Biographie, sein Kampf für Toleranz, seine Auseinandersetzung mit religiösen Strömungen seiner Zeit und vor allem sein Werk "Nathan der Weise" mit der Ringparabel bilden die Grundlage der Analyse. Sein Kontext innerhalb der Aufklärung und der Toleranzdebatte des 18. Jahrhunderts wird detailliert beleuchtet.
Was ist die Ringparabel und welche Bedeutung hat sie?
Die Ringparabel aus Lessings "Nathan der Weise" ist der zentrale Punkt der Arbeit. Sie dient als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen der Religionstheologie und dem Thema religiöser Toleranz und Pluralität. Die Arbeit untersucht Lessings Motivation für die Entwicklung dieser Parabel.
Welche Kritik wird an der pluralistischen Religionstheologie geübt?
Die Arbeit beleuchtet die Kritik an der pluralistischen Religionstheologie, die sich auf das Offenbarungsverständnis, christologische Fragen und die Behandlung von Absolutheitsansprüchen verschiedener Religionen konzentriert. Die lehrämtliche Kritik, zum Beispiel in "Dominus Jesus", wird ebenfalls einbezogen.
Wird eine Alternative zur pluralistischen Religionstheologie vorgestellt?
Ja, die Arbeit stellt den Interiorismus als eine mögliche Alternative vor. Der Ansatz von Gerhard Gäde wird analysiert und seine Stärken und Schwächen im Verhältnis zu den anderen besprochenen Positionen gewürdigt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ringparabel, Lessing, Nathan der Weise, Pluralistische Religionstheologie, Exklusivismus, Inklusivismus, Toleranz, Aufklärung, John Hick, Karl Rahner, Religiöse Vielfalt, Offenbarung, Christologie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptkapitel und einen Exkurs unterteilt. Kapitel I behandelt Lessing und die Idee der Ringparabel. Kapitel II ordnet die pluralistische Religionstheologie ein und vergleicht Exklusivismus und Inklusivismus. Kapitel III widmet sich der pluralistischen Religionstheologie selbst und ihrer Kritik. Der Exkurs behandelt den Interiorismus als alternative Richtung.
- Citar trabajo
- Stefanie Meier (Autor), 2004, Nathan reloaded? Die Idee der Ringparabel in der pluralistischen Religionstheologie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25301