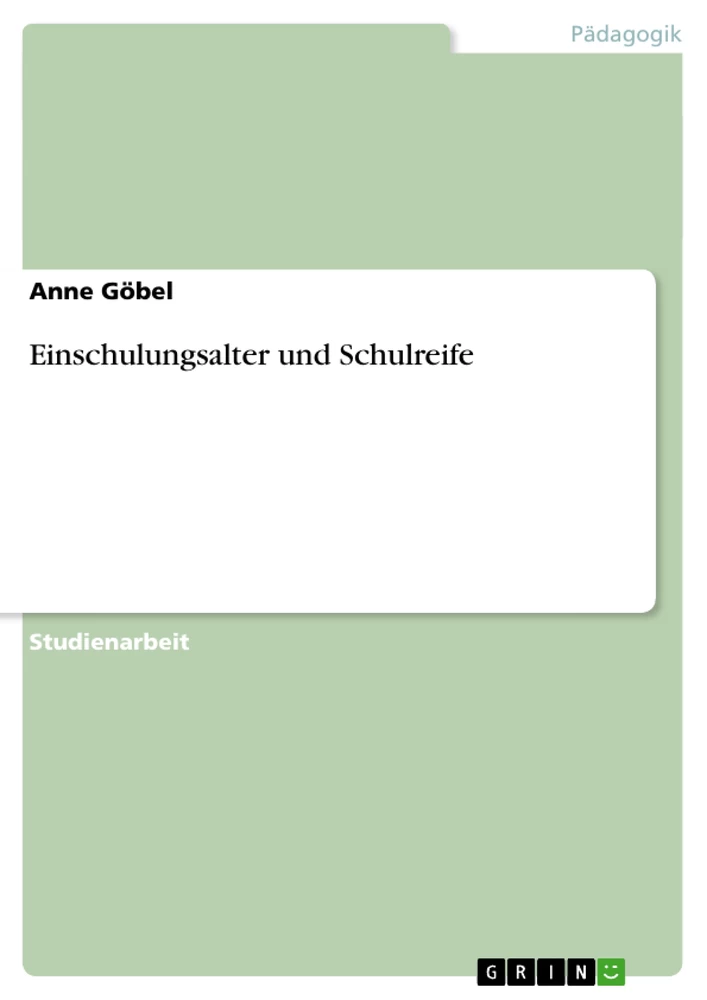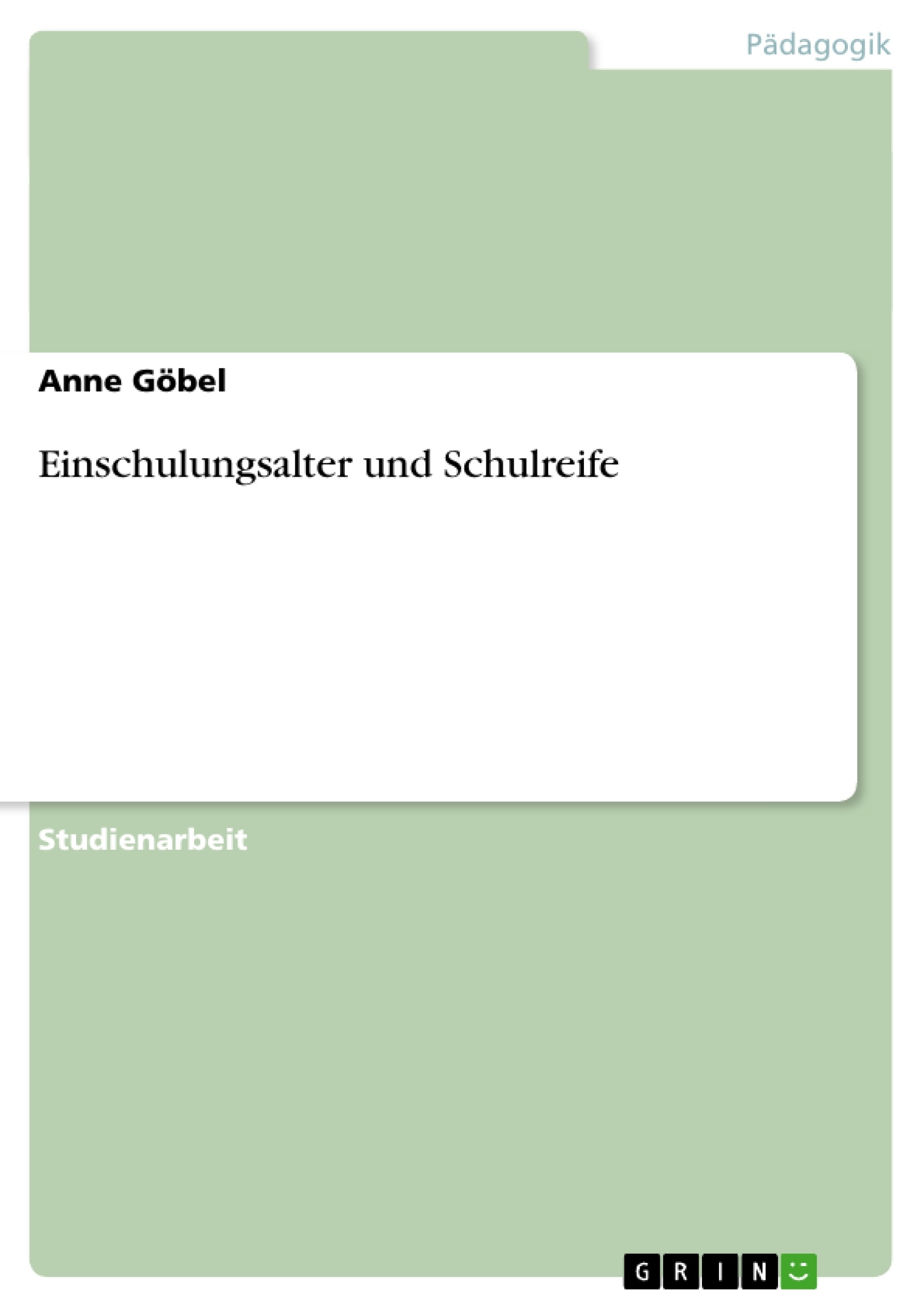Mein Praktikum machte ich an einer kleinen Gemeinschaftsgrundschule im Hochsauerland. Meine Wahl fiel auf diese Schule, da sie, anders als Schulen die ich kannte, nur ca. 100 Schüler hat. Was sie auch zu etwas Besonderem für mich machte war, dass sie zu einem großen Teil aus Holz gebaut ist und die meisten Klassen an mindestens zwei Seiten Fenster haben, die Schule also sehr hell ist. Der Schulhof wird an zwei Seiten von der Schule begrenzt, an der dritten Seite von der Turnhalle (die auch dem Vereinssport dient) und die vierte Seite wird von einer Hecke begrenzt, die ihn von einer Seitenstraße abgrenzt. Auf dem Schulhof ist ein großer Sandkasten, mit Kletterstangen, außerdem noch Holzpflöcke (zum Drüberspringen) und einige wenige Sitzplätze. Die Grenze zur Straße und Bushaltestelle bildet eine gelbe Linie, die alle Schüler bereitwillig akzeptieren, auch wenn sie nach Schulschluß auf ihre Busse warten.
In jeder großen Pause können die Schüle r auch Spielzeug, wie z.B. Springseile o.ä. mit in die Pause nehmen. Und jeweils eine Klasse hat die Erlaubnis, in der Turnhalle zu spielen. Dies wird durch einen immer wiederkehrenden Turnus geregelt. Zwischen den einzelnen Stunden, also in den kleinen Pausen schicken die LehrerInnen die Kinder 2-3 Runden um das Schulgebäude, damit sie Bewegung bekommen und in der nächsten Stunde konzentrierter sind.
Zur Zeit meines Praktikums gab es an der Schule ein erstes, zwei kleine zweite, ein drittes und ein viertes Schuljahr. Die Anzahl der Jungen und Mädchen war ungefähr gleich groß. Es wurden circa 10 ausländische Schüler unterrichtet, die aber kaum Integrationsschwierigkeiten hatten, da sie zum größten Teil schon in Deutschland geboren waren.
Ich war die meiste Zeit meines Praktikums in der ersten Klasse. Sie hatte eine Klassenlehrerin, die selber grade erst mit dem Referendariat fertiggeworden und daher noch sehr nah am Studium war. Die Direktorin der Schule meinte, dass mir das evtl. helfen könne. Aber auc h ohne diesen Grund gefiel es mir sehr gut in der Klasse
und meine Mentorin gab mir die Möglichkeit, sie mit den Erstklässlern zu unterstützen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Erlangen der Schulreife
- 2.1 Das Elternhaus
- 2.2 Die Stellung in der Geschwisterreihe
- 2.3 Schulreife aus Sicht der Schulärzte
- 2.3.1 Seh- und Hörschäden
- 2.3.2 Erkrankungen und Störungen im Bereich des zentralen Nervensystems
- 2.3.3 Das psycho-organische Syndrom als Ursache für das Zurückstellen von Kindern
- 2.4 Das Geschlecht
- 2.5 Der Einfluss des Kindergartens auf das Erlangen der Schulreife
- 2.6 Unterschiede auf dem Land und in der Stadt
- 3. Zurückstellung
- 3.1 Welche Kinder werden zurückgestellt?
- 3.2 Welche Alternativen zur Zurückstellung gibt es?
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess des Erlangens von Schulreife und die damit verbundenen Faktoren. Sie beleuchtet die Bedeutung des Einschulungsalters und die verschiedenen Aspekte, die die Schulbereitschaft eines Kindes beeinflussen. Die Arbeit analysiert auch die Praxis der Zurückstellung und mögliche Alternativen.
- Einflussfaktoren auf die Schulreife
- Das optimale Einschulungsalter
- Die Rolle des Elternhauses und des Kindergartens
- Zurückstellung von Kindern: Gründe und Alternativen
- Regionale Unterschiede im Einschulungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit anhand eines Praktikums an einer kleinen Grundschule im Hochsauerland. Der Fokus liegt auf der Beobachtung von Erstklässlern und den individuellen Unterschieden in Bezug auf Lernfähigkeit und Schulreife. Die persönliche Erfahrung der Autorin mit dem Thema Einschulung und ihre spätere Auseinandersetzung mit dem Thema werden als Motivation für die Arbeit genannt. Die individuelle Entwicklung des Kindes in Relation zum Einschulungsalter wird als zentraler Aspekt hervorgehoben.
2. Das Erlangen der Schulreife: Dieses Kapitel analysiert umfassend die Faktoren, die das Erlangen der Schulreife beeinflussen. Es werden verschiedene Perspektiven beleuchtet, beginnend mit dem Einfluss des Elternhauses und der Geschwisterkonstellation. Die Sichtweise der Schulärzte mit Fokus auf körperliche und geistige Aspekte wie Seh- und Hörschäden sowie neurologische Erkrankungen wird detailliert dargestellt. Der Einfluss des Geschlechts, des Kindergartenbesuchs und regionale Unterschiede (Stadt vs. Land) werden ebenfalls berücksichtigt. Die Zusammenfassung der verschiedenen Faktoren verdeutlicht die Komplexität der Schulreife und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung.
3. Zurückstellung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema der Zurückstellung von Kindern. Es werden detailliert die Kriterien und Gründe für die Zurückstellung von Kindern erörtert. Weiterhin werden mögliche Alternativen zur Zurückstellung diskutiert und deren Vor- und Nachteile abgewogen. Das Kapitel veranschaulicht die Herausforderungen bei der Entscheidung für oder gegen eine Zurückstellung und unterstreicht die Notwendigkeit individueller Betrachtungsweise, um die bestmögliche Förderung jedes Kindes sicherzustellen.
Schlüsselwörter
Schulreife, Einschulungsalter, Einschulungspraxis, Entwicklungsfaktoren, Elternhaus, Kindergarten, Schulärzte, Zurückstellung, Alternativen, regionale Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Erlangen der Schulreife
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend den Prozess des Erlangens von Schulreife und die damit verbundenen Faktoren. Sie beleuchtet die Bedeutung des Einschulungsalters und analysiert die verschiedenen Aspekte, die die Schulbereitschaft eines Kindes beeinflussen, einschließlich der Praxis der Zurückstellung und möglicher Alternativen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des Elternhauses, der Geschwisterkonstellation, die Sichtweise der Schulärzte (inklusive Seh- und Hörschäden und neurologischer Erkrankungen), den Einfluss des Geschlechts, des Kindergartenbesuchs und regionale Unterschiede (Stadt vs. Land) auf die Schulreife. Weiterhin wird detailliert auf die Kriterien und Gründe für die Zurückstellung von Kindern eingegangen und mögliche Alternativen dazu diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Das Erlangen der Schulreife, 3. Zurückstellung und 4. Zusammenfassung. Kapitel 2 analysiert detailliert die Einflussfaktoren auf die Schulreife, während Kapitel 3 sich mit der Zurückstellung von Kindern und alternativen Maßnahmen befasst. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit und die Motivation der Autorin, während die Zusammenfassung die zentralen Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den komplexen Prozess des Erlangens von Schulreife zu untersuchen und die verschiedenen Einflussfaktoren zu analysieren. Sie möchte ein umfassendes Verständnis der Thematik vermitteln und die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtungsweise bei der Einschulung von Kindern hervorheben. Die Analyse der Zurückstellungspraxis und ihrer Alternativen dient der Optimierung des Einschulungsprozesses und der bestmöglichen Förderung jedes Kindes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulreife, Einschulungsalter, Einschulungspraxis, Entwicklungsfaktoren, Elternhaus, Kindergarten, Schulärzte, Zurückstellung, Alternativen, regionale Unterschiede.
Wo findet man weitere Informationen zu einzelnen Aspekten der Arbeit?
Die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, welches die einzelnen Kapitel und Unterkapitel auflistet. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die jeweiligen Inhalte. Die Schlüsselwörter ermöglichen eine gezielte Suche nach relevanten Informationen.
Welche Methode wurde in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Kombination aus Literaturrecherche und der persönlichen Erfahrung der Autorin aus einem Praktikum an einer Grundschule. Die Analyse der Einflussfaktoren auf die Schulreife erfolgt aus verschiedenen Perspektiven (Elternhaus, Kindergarten, Schulärzte etc.), um ein umfassendes Bild zu erhalten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Schulärzte, Eltern und alle, die sich mit der Thematik der Schulreife und des Einschulungsprozesses auseinandersetzen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die verschiedenen Faktoren, die die Schulbereitschaft von Kindern beeinflussen, und kann als Grundlage für Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einschulung dienen.
- Citar trabajo
- Anne Göbel (Autor), 2002, Einschulungsalter und Schulreife, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25357