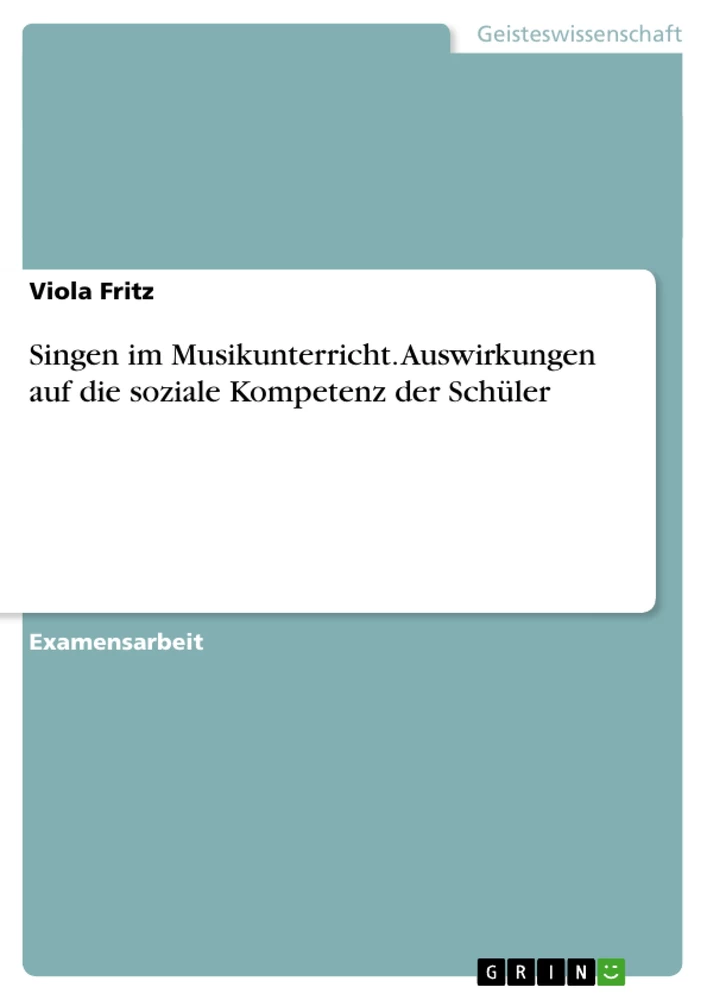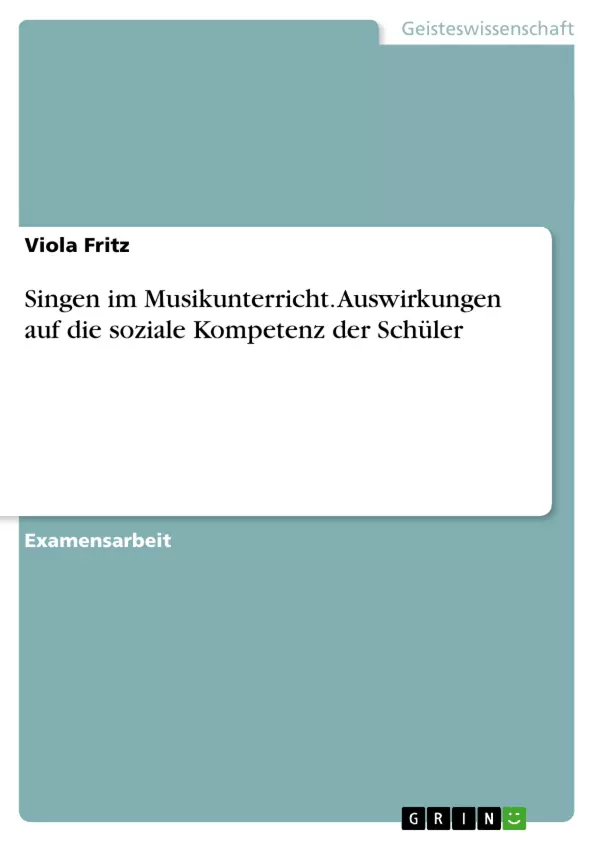Keine andere Lebensphase ist so sehr von Gewalt geprägt wie die des Erwachsenwerdens. Laut Statistik gehen die Gewalttaten in den letzten Jahren sogar zurück, aber Gewalt wird weniger toleriert als früher. Soziologen erforschen eher die gesellschaftlichen Ursachen für die Entstehung von Gewalt und Psychologen suchen nach individuellen Faktoren. Erst in jüngster Forschung wurde die Gewaltfahndung dort angepackt, wo sie entsteht: im Mutterleib. 15% aller Eltern können ihre Kinder nicht erziehen, da sie unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Alkohol- und Drogensucht leiden. Nicht jedes Kind verhält sich wie ein „Sonnenschein“. Viele Eltern haben von ihrem Wunschbaby geträumt und sind dann enttäuscht. Andere schenkten ihrem Kind zu wenig Aufmerksamkeit – sei es aus Desinteresse, Zeitmangel oder auch Stress. Oft mangelt es auch an Regeln und Strukturen, worauf gerade unruhige und impulsive Kinder angewiesen sind. Außerdem ist heutzutage weniger Unterstützung in der Nähe, zum Beispiel indem die Großeltern zu weit weg wohnen.
Kinder, die zu wenig Nähe, Trost oder wechselhaftes Verhalten von ihrer Mutter erfahren haben, haben ständig erhöhte Cortisolwerte und versuchen ihre Gefühle zu unterdrücken. Eine sichere Bindung schützt Kinder vor Stress. Wenn ein Kind nur dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn es schreit, geraten viele Familien in eine „Aggressionsspirale“, Eltern versuchen mit Aggression ihre Erziehungsziele zu verwirklichen. Aggression zahlt sich aber nur kurzfristig aus, langfristig muss sie sich immer weiter steigern und das Kind lernt nicht das Verhalten, das es außerhalb der Familie benötigt um sich zu integrieren.
Verhaltensprobleme hängen nicht nur von schlechten Vorbildern ab, sondern davon, wie die Kinder sich selbst fühlen und wie ihre empathische Verbindung zu anderen Menschen sind. Empathie entwickelt sich, indem das Kind seine Gefühle in denen des Gegenübers gespiegelt sieht. Das Kind verknüpft dann sein Gefühl mit dem Ausdruck des Gegenübers. Erst später lernt es, beides voneinander zu unterscheiden. Wenn ein Kind Schmerzen mit einem teilnahmslosen Ausdruck der Eltern erfährt, dann erkennt es auch später den schmerzenden Gesichtsausdruck bei anderen nicht, wenn es sich prügelt.
Eine weitere Gefahr besteht, wenn das Kind Zeuge von gewalttätigen Auseinandersetzungen der Eltern wird. Es erfährt ein Gefühl von Hilflosigkeit oder versucht die Eltern zu vereinen, indem es mit eigener Aggressivität die Aufmerksamkeit beider auf sich zieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Kompetenz
- 2.1 Was ist soziale Kompetenz?
- 2.2 Komponenten sozial kompetenter Verhaltensweisen
- 2.3 Ursachen für Defizite bei der sozialen Kompetenz
- 2.3.1. Die Familie
- 2.3.2 Die Medien
- 2.3.3 Die Schule
- 2.3.4 Der Arbeitsplatz
- 2.3.5 Persönliche Ursachen
- 2.3.6 Förderung der sozialen Kompetenz
- 2.4 Soziale Kompetenzen für Kinder
- 2.4.1 Primäre Sozialisation
- 2.4.2 Sekundäre Sozialisation
- 2.5 Auswirkungen für den Musikunterricht
- 3. Die Gesangsklassen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim
- 3.1 Population und Sozialstruktur des Einzugsgebiets
- 3.2 Der Musikunterrichts am DBG Eppelheim
- 3.3 Organisation des Musikunterrichts
- 3.4 Ziele des Musikunterrichts
- 3.4.1 Regelklassen
- 3.4.2 Gesangsklassen
- 4. Evaluation am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim
- 4.1 Struktur des Musikunterrichts: Die Gesangsklasse und die Regelklasse im Vergleich
- 4.2 Fragebögen mit den Schülern der 10. Klasse
- 4.2.1 Beteiligung
- 4.2.2 Musikalische (Vor-)Bildung der Schüler
- 4.3 Umfrage in den Klassen 10
- 4.3.1 Klassensoziogramm
- 4.3.2 Fragebogen zur sozialen Kompetenz
- 4.3.3 Fragebogen zum Unterrichtsklima
- 4.4 Interviews mit Lehrern der 10. Klasse
- 4.4.1 Interview mit dem Lehrer der Gesangsklasse 10
- 4.4.2 Interview mit dem Musiklehrer Klasse 10
- 4.4.3 Interview mit einer Klassenlehrerin der Klasse 10
- 4.5 Eigene Beobachtungen
- 4.6 Bemerkungen zur Evaluation
- 4.7 Gesamtergebnis der Evaluation
- 5. Ergebnisse anderer Studien im Bezug auf Musikunterricht und Auswirkungen auf die soziale Kompetenz
- 5.1 Langzeitstudie an Berliner Grundschulen
- 5.1.1 Ziele der Langzeitstudie
- 5.1.2 Der Lehrplan in den Modell- und Vergleichsschulen
- 5.1.3 Die Wirkung auf die soziale Kompetenz der Schule durch erweiterten Musikunterricht
- 5.2 Modellversuch in der Schweiz
- 5.2.1 Organisation
- 5.2.2 Ergebnisse aus dem Sozial- und Selbstbereich
- 5.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.3 Modellversuch in Hessen: Kooperation von Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen
- 5.3.1 Rahmenbedingungen
- 5.3.2 Teilnehmende Schulen
- 5.3.3 Organisation des Musikunterrichts an den Schulen
- 5.3.4 Auswirkungen auf die Integration in die Schule und Klasse
- 5.4 Bewertungen der Ergebnisse der Studien im Bezug auf die Soziale Kompetenz
- 5.4.1 Bewertungen der Berliner Studie von Maria Spychiger
- 5.4.2 Kritische Bewertung der Ergebnisse der drei Studien
- 6. Perspektiven und Konsequenzen für den Musikunterricht an allgemein bildenden Gymnasien
- 6.1 Perspektiven für den Musikunterricht
- 6.1.1 Lernziel,soziale Kompetenz“
- 6.1.2 Förderung der sozialen Kompetenz im Musikunterricht
- 6.1.3 Perspektiven für den Musikunterricht
- 6.2 Konsequenzen für die Ausbildung der Schulmusiker
- 6.3 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Gesangsunterricht auf die soziale Kompetenz von Schülern. Sie untersucht die Auswirkungen von Musik auf die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und die Förderung von Zusammenhalt und Kommunikation im Schulumfeld. Die Arbeit analysiert den Musikunterricht an einer Schule, insbesondere die Gesangsklassen, und untersucht verschiedene Studien, die sich mit dem Einfluss von Musik auf die soziale Kompetenz beschäftigen.
- Die Auswirkungen von Gesangsunterricht auf die soziale Kompetenz von Schülern.
- Die Analyse von sozialen Kompetenzdefiziten und deren Ursachen.
- Die Rolle des Musikunterrichts in der Förderung sozialer Kompetenzen.
- Die Ergebnisse verschiedener Studien, die den Einfluss von Musik auf die soziale Kompetenz untersuchen.
- Perspektiven und Konsequenzen für den Musikunterricht an allgemein bildenden Gymnasien.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Bedeutung von sozialer Kompetenz in der heutigen Gesellschaft. Die Einleitungen erläutert die aktuelle Relevanz des Themas und stellt die Forschungsfrage dar.
- Kapitel 2 definiert den Begriff der sozialen Kompetenz und beschreibt die Komponenten sozial kompetenten Verhaltens. Es untersucht die Ursachen für Defizite bei der sozialen Kompetenz und die Rolle von Familie, Medien, Schule, Arbeitsplatz und persönlichen Faktoren.
- Kapitel 3 fokussiert auf die Gesangsklassen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim. Es analysiert die Population, die Sozialstruktur des Einzugsgebiets und die Organisation des Musikunterrichts an dieser Schule.
- Kapitel 4 beschreibt die Evaluation am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim. Es vergleicht die Struktur des Musikunterrichts in Gesangsklassen und Regelklassen und präsentiert die Ergebnisse von Fragebögen und Interviews.
- Kapitel 5 analysiert verschiedene Studien, die den Einfluss von Musik auf die soziale Kompetenz untersuchen. Es beleuchtet Langzeitstudien an Berliner Grundschulen, Modellversuche in der Schweiz und Hessen.
- Kapitel 6 erörtert Perspektiven und Konsequenzen für den Musikunterricht an allgemein bildenden Gymnasien. Es betont die Bedeutung der sozialen Kompetenz als Lernziel und die Förderung sozialer Kompetenzen im Musikunterricht.
Schlüsselwörter
Soziale Kompetenz, Musikunterricht, Gesangsunterricht, Schule, Evaluation, Studien, Langzeitstudie, Modellversuch, Integration, Zusammenhalt, Kommunikation, Förderung, Lernziel.
- Arbeit zitieren
- Viola Fritz (Autor:in), 2004, Singen im Musikunterricht. Auswirkungen auf die soziale Kompetenz der Schüler, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25573