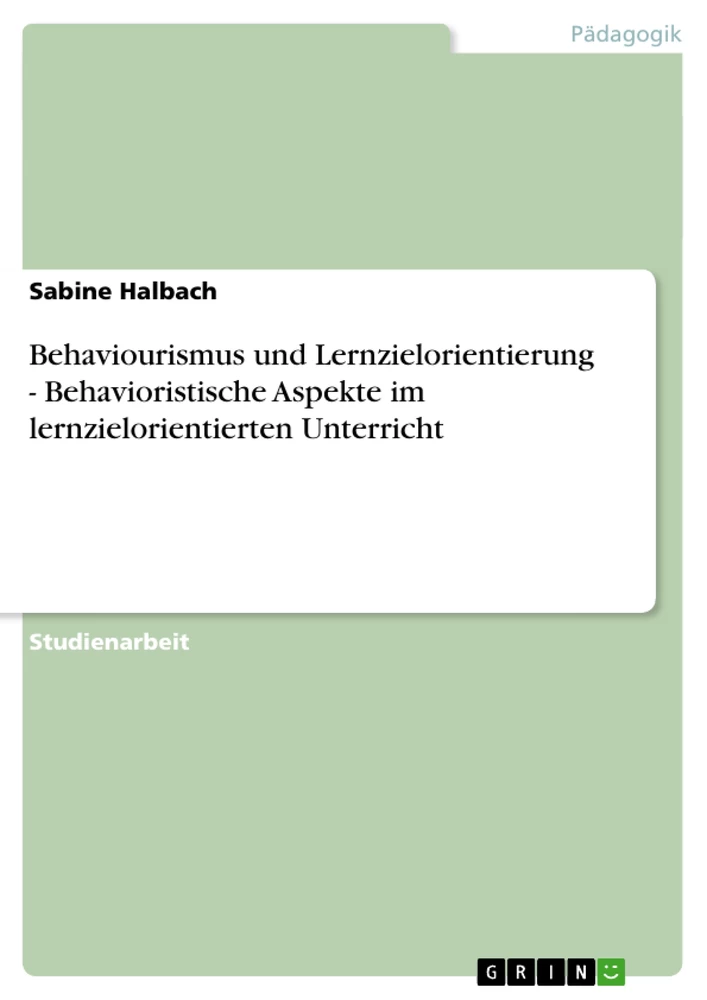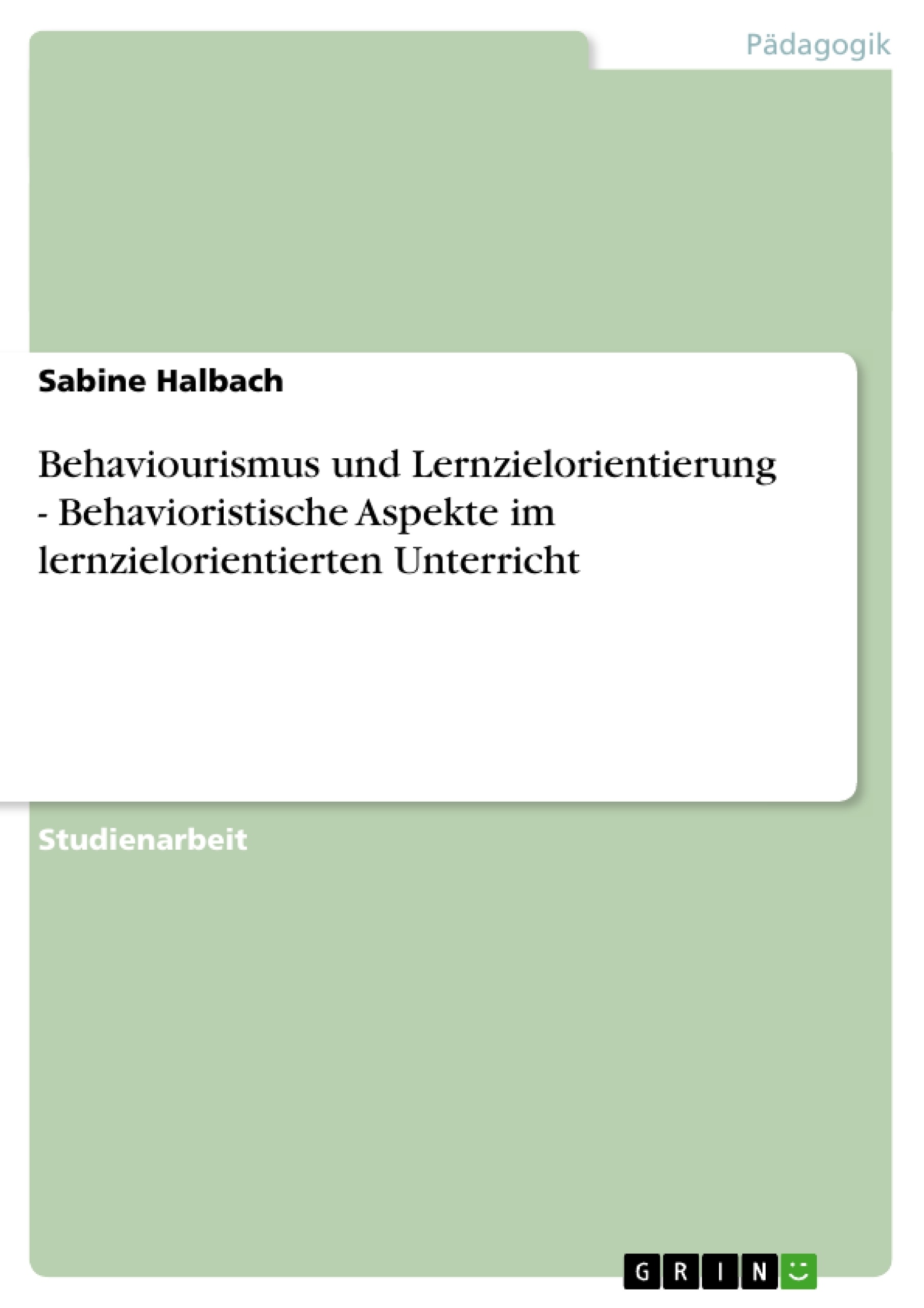Die Lerntheorie des Behaviorismus und die Methode des lernzielorientierten
Unterrichts liegen zeitlich gesehen weit auseinander, abgesehen davon, dass sie
auf unterschiedlichen Begriffsebenen, d.h. einerseits auf der psychologischlerntheoretischen,
andererseits auf der der Unterrichtsmethodik, zu fassen sind. In
den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, d.h. in den Anfängen der
behavioristischen Forschung, war noch nicht abzusehen, welche Einflüsse diese
auf zukünftige Lehr- und Lernprozesse in der Schule bzw. auf die nachfolgende
Lernpsychologie insgesamt nehmen würde. Aus dieser neu geborenen
wissenschaftlichen Strömung wurde unter anderem auch die Theorie der
Lernzielorientierung geboren, die sich in Deutschland ab der zweiten Hälfte der
60er Jahre in Teilen durchsetzte, um dann bis in den späten 80er Jahren wieder
aus dem didaktischen Blickfeld zu rücken: „Die Blütezeit der behavioristischen
Lerntheorien liegt inzwischen viele Jahrzehnte zurück [...]“1. Der Abstieg vollzog
sich nicht nur wegen auftretender Probleme in der Praxis, sondern überdies
aufgrund einer intensiven Diskussion und heftiger Kritik der heimischen
Erziehungswissenschaft (siehe Kap.5). Heute werden in der Praxis nur noch
einzelne Elemente der LZO übernommen, der Handlungsorientierte Unterricht
überwiegt bei weitem im aktuellen Unterrichtsgeschehen.
Die vorliegende Abhandlung soll zeigen, in welchem Maße sich die wichtigsten
Resultate der lernpsychologischen Schule des Behaviorismus als Grundlage für
die Lernzielorientierung in den 60er und 70er Jahren in der BRD erwiesen haben.
Zu diesem Zweck wird zunächst in den Kapiteln zwei und drei eine Übersicht
über Definition, Grundlagen und Struktur der behavioristischen Theorie als auch
der Lernzielorientierung gegeben. Im Anschluss daran wird im eigentlichen
Hauptteil, dem vierten Kapitel, dargestellt, inwiefern der Behaviorismus bzw.
seine Erkenntnisse über das menschliche Lernen bedeutsam waren für die
Entstehung und Begründung der Lernzielorientierung. In diesem Teil werden die
wichtigsten Aspekte analysiert und der Zusammenhang zwischen den beiden
Theorien aufgezeigt.
Schließlich werden im letzten Kapitel die am häufigsten vorgebrachten Einwände
gegen die behavioristische bzw. zielorientierte Lerntheorie erläutert, bevor in der
Schlussbemerkung ein kurzes Fazit gezogen wird.
1 Mietzel, Gerd, Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens, Weinheim 1972, S.178.
Inhaltsverzeichnis
- Behaviorismus und Lernzielorientierung – Hinführung
- Grundlagen des Behaviorismus
- Einführung - Watson
- Pawlow - Klassische Konditionierung
- Thorndike – Lernen durch Trial and Error
- Skinner-Operante Konditionierung und Programmierter Unterricht
- Lernzielorientierung – Die Anfänge
- Grundlagen und Begründung
- Formulierung der Lernziele
- Lernerfolgskontrolle
- Operationalisierung von Lernzielen
- Dimensionierung und Hierarchisierung von Lernzielen
- Behavioristische Ansätze im lernzielorientierten Unterricht
- Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Behaviorismus auf die Entwicklung der Lernzielorientierung im Unterricht. Sie beleuchtet die historischen Zusammenhänge und analysiert, inwieweit behavioristische Erkenntnisse die Grundlagen der Lernzielorientierung in den 60er und 70er Jahren in der BRD bildeten. Die Arbeit konzentriert sich auf die wichtigsten Ergebnisse der behavioristischen Lerntheorie und deren Bedeutung für die Entstehung und Begründung der Lernzielorientierung.
- Der Behaviorismus als Lerntheorie und seine zentralen Konzepte
- Die Entstehung und Entwicklung der Lernzielorientierung
- Der Zusammenhang zwischen Behaviorismus und Lernzielorientierung
- Analyse wichtiger behavioristischer Ansätze im Kontext des lernzielorientierten Unterrichts
- Kritik an der behavioristischen und lernzielorientierten Lerntheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Behaviorismus und Lernzielorientierung – Hinführung: Die Einleitung stellt den zeitlichen und konzeptionellen Abstand zwischen Behaviorismus und Lernzielorientierung heraus. Sie betont den unerwarteten Einfluss des Behaviorismus auf die Pädagogik und den Aufstieg und Fall der Lernzielorientierung in Deutschland. Die Arbeit skizziert ihren Fokus: die Analyse des Einflusses behavioristischer Erkenntnisse auf die Lernzielorientierung in den 60er und 70er Jahren der BRD.
Grundlagen des Behaviorismus: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die zentralen Konzepte des Behaviorismus, beginnend mit Watsons Definition und den methodischen Prinzipien der beobachtbaren Verhaltensweisen. Es beleuchtet kritische Punkte wie das "Black-Box-Modell", die Verallgemeinerung von Tierversuchen auf das menschliche Verhalten und den deterministischen Ansatz des Behaviorismus. Pawlows klassische Konditionierung wird als ein zentrales Beispiel behavioristischer Lerntheorie ausführlich beschrieben, einschließlich der experimentellen Methodik und der Unterscheidung zwischen unkonditionierten und konditionierten Reizen und Reaktionen.
Lernzielorientierung – Die Anfänge: Dieses Kapitel skizziert die Entstehung und die Grundprinzipien der Lernzielorientierung, einschließlich der Formulierung, Operationalisierung, und Hierarchisierung von Lernzielen sowie der Lernerfolgskontrolle. Obwohl die einzelnen Unterkapitel nicht einzeln zusammengefasst werden, wird der Schwerpunkt auf die grundlegenden Prinzipien und die Bedeutung einer systematischen Zielsetzung im Unterricht gelegt.
Behavioristische Ansätze im lernzielorientierten Unterricht: Dieses Kapitel, der Hauptteil der Arbeit, analysiert den konkreten Einfluss behavioristischer Lerntheorien auf die Praxis des lernzielorientierten Unterrichts. Es wird die Verbindung zwischen den beiden Theorien detailliert untersucht und die Relevanz behavioristischer Erkenntnisse für die Gestaltung des Unterrichts herausgestellt.
Schlüsselwörter
Behaviorismus, Lernzielorientierung, Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung, Reiz-Reaktionsschema, Lernpsychologie, Unterrichtsmethodik, Lernerfolgskontrolle, Verhaltensmodifikation, Kritik des Behaviorismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss des Behaviorismus auf die Lernzielorientierung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Behaviorismus auf die Entwicklung der Lernzielorientierung im Unterricht. Sie beleuchtet die historischen Zusammenhänge und analysiert, inwieweit behavioristische Erkenntnisse die Grundlagen der Lernzielorientierung in den 60er und 70er Jahren in der BRD bildeten. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Ergebnissen der behavioristischen Lerntheorie und deren Bedeutung für die Entstehung und Begründung der Lernzielorientierung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Konzepte des Behaviorismus (Watson, Pawlow, Thorndike, Skinner), die Entstehung und Entwicklung der Lernzielorientierung, den Zusammenhang zwischen beiden Theorien, die Anwendung behavioristischer Ansätze im lernzielorientierten Unterricht und abschließend eine kritische Auseinandersetzung mit beiden Ansätzen.
Welche behavioristischen Konzepte werden erläutert?
Die Arbeit erläutert die klassische Konditionierung (Pawlow), die operante Konditionierung (Skinner) und das Lernen durch Versuch und Irrtum (Thorndike). Watsons Beitrag zur Definition des Behaviorismus und methodische Prinzipien werden ebenfalls behandelt. Kritische Punkte wie das "Black-Box-Modell" und die Verallgemeinerung von Tierversuchen auf menschliches Verhalten werden angesprochen.
Wie wird die Lernzielorientierung dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Entstehung und Grundprinzipien der Lernzielorientierung, einschließlich der Formulierung, Operationalisierung und Hierarchisierung von Lernzielen sowie der Lernerfolgskontrolle. Der Schwerpunkt liegt auf den grundlegenden Prinzipien und der Bedeutung einer systematischen Zielsetzung im Unterricht.
Welchen Zusammenhang stellt die Arbeit zwischen Behaviorismus und Lernzielorientierung her?
Die Arbeit analysiert den konkreten Einfluss behavioristischer Lerntheorien auf die Praxis des lernzielorientierten Unterrichts. Sie untersucht detailliert die Verbindung zwischen beiden Theorien und die Relevanz behavioristischer Erkenntnisse für die Gestaltung des Unterrichts.
Gibt es eine kritische Auseinandersetzung?
Ja, die Arbeit beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit sowohl dem Behaviorismus als auch der Lernzielorientierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Hinführung, Grundlagen des Behaviorismus (inkl. Watson, Pawlow, Thorndike, Skinner), Lernzielorientierung – Die Anfänge, Behavioristische Ansätze im lernzielorientierten Unterricht und Kritik.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Behaviorismus, Lernzielorientierung, Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung, Reiz-Reaktionsschema, Lernpsychologie, Unterrichtsmethodik, Lernerfolgskontrolle, Verhaltensmodifikation, Kritik des Behaviorismus.
- Citar trabajo
- Sabine Halbach (Autor), 2002, Behaviourismus und Lernzielorientierung - Behavioristische Aspekte im lernzielorientierten Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25609