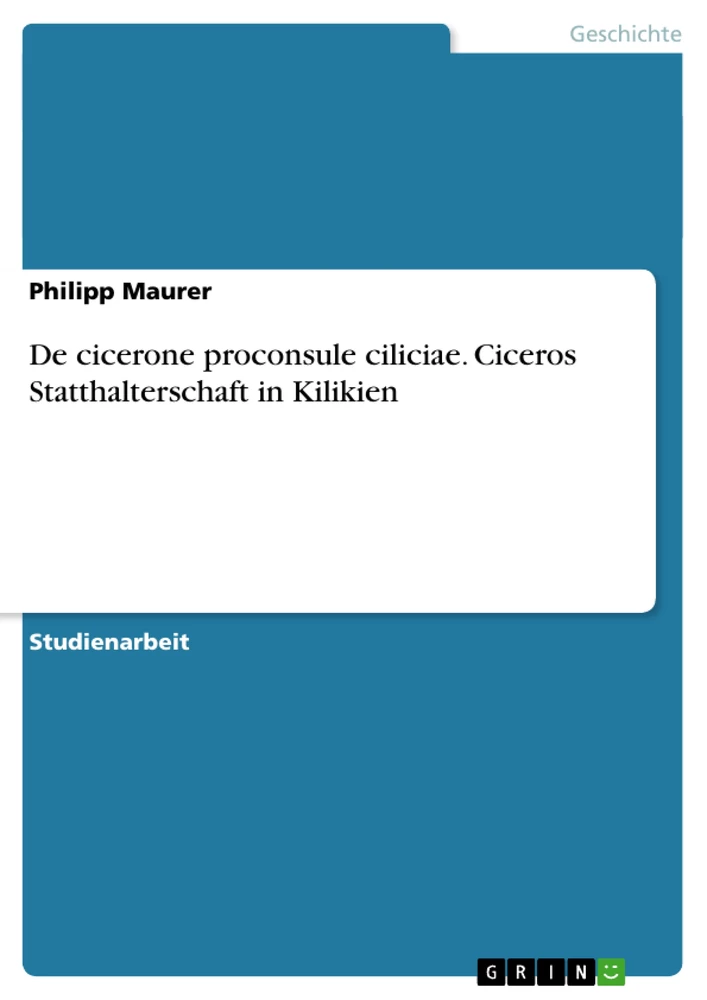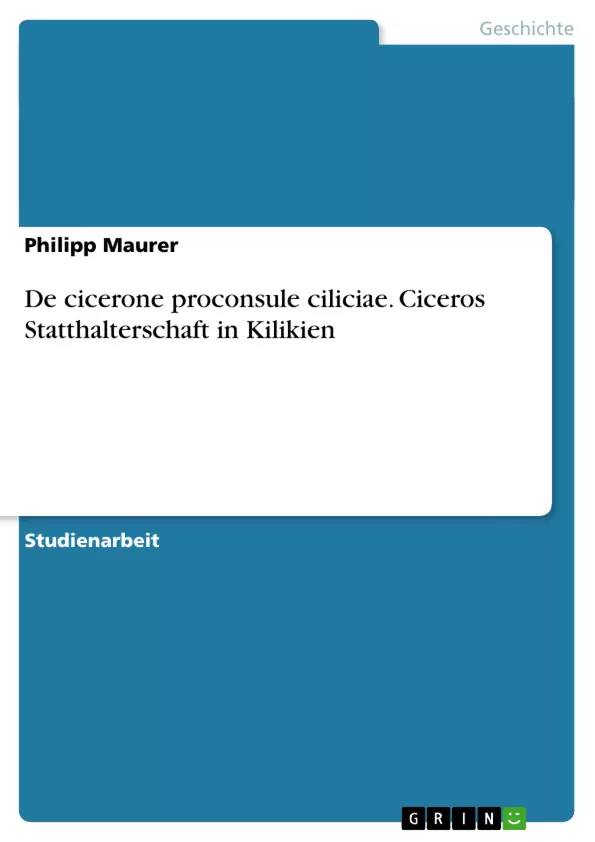I. Einleitung
Im Mittelpunkt der folgenden Arbeit steht der römische Politiker, Redner und Philosoph Marcus Tullius Cicero. Er erblickte am 3. Januar 106 v. Chr. in Arpium das Licht der Welt. Es gelang ihm, dank seiner rhetorischen Begabung und seines Ehrgeizes, in der Politik Karriere zu machen und durch die Wahl in verschiedene Magistraturen, in die Senatorenriege aufzusteigen. Den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn markiert das Konsulat im Jahr 63. Unter dem Druck der sich verändernden politischen Verhältnisse war er 58 gezwungen, ins Exil zu gehen, aus dem er, vor allem dank der Hilfe Milos, bereits 57 nach Rom zurückkehren konnte. In der Zeit danach entstanden seine Hauptwerke De oratore und De re publica. Im Jahr 51 wurde Cicero als Statthalter nach Kilikien geschickt.
Dieser Zeitraum der Statthalterschaft, d.h. vom Zeitpunkt der Abreise am 1. Mai 51, bis zur Rückkehr am 4. Januar 49, soll in der nun folgenden Arbeit unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Vorangestellt ist dem eine kurze Einordnung in den historischen Kontext dieser Zeit, verbunden mit der Vorgeschichte der Statthalterschaft Ciceros. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht neben einer umfassenden Chronologie der Ereignisse, die Frage, inwiefern sich Cicero tatsächlich an die von ihm entworfenen Grundsätze der Provinzpolitik hält und wie er diese realisiert.
Trotz der Tatsache, dass Ciceros prokonsularische Tätigkeit nur ein Jahr währte, sind aus dieser Zeit erstaunlich viele Briefe erhalten: zweieinhalb Bücher an Atticus, ferner eine umfangreiche Korrespondenz mit seinem jungen Freund und Ziehsohn Caelius, sowie das ganze 3. Buch der Sammlung Ad familiares, mit Briefen an seinen Amtsvorgänger Appius Claudius Pulcher und mit Briefen an den Senat und an Cato. Entscheidend für die Beant-wortung der Fragestellung ist außerdem die Korrespondenz mit seinem Bruder Quintus, in welcher er seine Vorstellungen von einer erfolgreichen Provinzpolitik und damit gleichsam deren Grundsätze formuliert.
In diesem Zusammenhang stehen eine Reihe von Kommentaren und Biographien, darunter insbesondere die Cicero-Biographien von Manfred Fuhrmann, Matthias Gelzer und Wilhelm K. Drumann, sowie der Textkommentar von Otto Eduard Schmidt (komplette Auflistung im Literaturverzeichnis ). Sämtliche zitierte Textstellen aus den Originaltexten, mit Ausnahme der Briefsammlung ad Q. Fratem und den Plutarch-Zitaten, stammen aus der Übersetzung von K. L. F. Mezger, Stuttgart, 1862. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ciceros Statthalterschaft in Kilikien
- 1.0 Die politischen Konstellationen der Jahre 52/51 und die Lex pompeia de provinciis
- 2.0 Chronologie der prokonsularischen Tätigkeit 51/50
- 2.1 Die Reise in die Provinz
- 2.2 Situation der Provinz bei Ankunft Ciceros
- 2.3 Militärische Aktivitäten bis Herbst 51
- 2.4 Der Triumph
- 2.5 Das Provinzialedikt – Die Gesetzgebung und Verwaltung betreffenden Festlegungen bis Sommer 50
- 2.6 Die Heimreise nach Rom
- 3.0 Ciceros Grundsätze in der Provinzpolitik und deren Verwirklichung
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der prokonsularischen Tätigkeit des römischen Politikers, Redners und Philosophen Marcus Tullius Cicero in Kilikien von 51 bis 49 v. Chr. Ziel ist es, Ciceros Statthalterschaft in den historischen Kontext der Zeit einzuordnen und seine Handlungen und Entscheidungen im Hinblick auf seine selbst formulierten Grundsätze der Provinzpolitik zu analysieren.
- Die politische Situation in Rom in den Jahren 52/51 und die Lex Pompeia de provinciis
- Die Chronologie der prokonsularischen Tätigkeit Ciceros in Kilikien
- Die militärische und administrative Situation in Kilikien während Ciceros Statthalterschaft
- Ciceros eigene Vorstellungen von Provinzpolitik und deren Umsetzung in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt Marcus Tullius Cicero und seine politische Karriere vor, mit Fokus auf seinen Aufstieg ins Konsulat im Jahr 63 v. Chr. und seine Verbannung im Jahr 58. Sie führt den Leser in den historischen Kontext der Statthalterschaft Ciceros in Kilikien ein und hebt die Bedeutung der erhaltenen Korrespondenz für die Analyse seiner prokonsularischen Tätigkeit hervor.
II. Ciceros Statthalterschaft in Kilikien
Dieses Kapitel beleuchtet zunächst die politische Situation in Rom im Vorfeld von Ciceros Statthalterschaft, insbesondere das Triumvirat von Pompeius, Caesar und Crassus, und den Einfluss der Lex Pompeia de provinciis auf die Vergabe von Provinzmandaten. Der Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Chronologie der prokonsularischen Tätigkeit Ciceros, beginnend mit seiner Reise nach Kilikien im Frühjahr 51 bis zu seiner Rückkehr nach Rom im Januar 49 v. Chr. Es werden seine militärischen Aktivitäten, die Verwaltung der Provinz, seine Gesetzgebung und seine Beziehung zu verschiedenen Persönlichkeiten und Institutionen thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Provinzpolitik, Statthalterschaft, römische Republik, politische Konstellationen, Lex Pompeia de provinciis, Cicero, Kilikien, militärische Aktivitäten, Verwaltung, Gesetzgebung, Korrespondenz.
- Arbeit zitieren
- Philipp Maurer (Autor:in), 2003, De cicerone proconsule ciliciae. Ciceros Statthalterschaft in Kilikien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25803