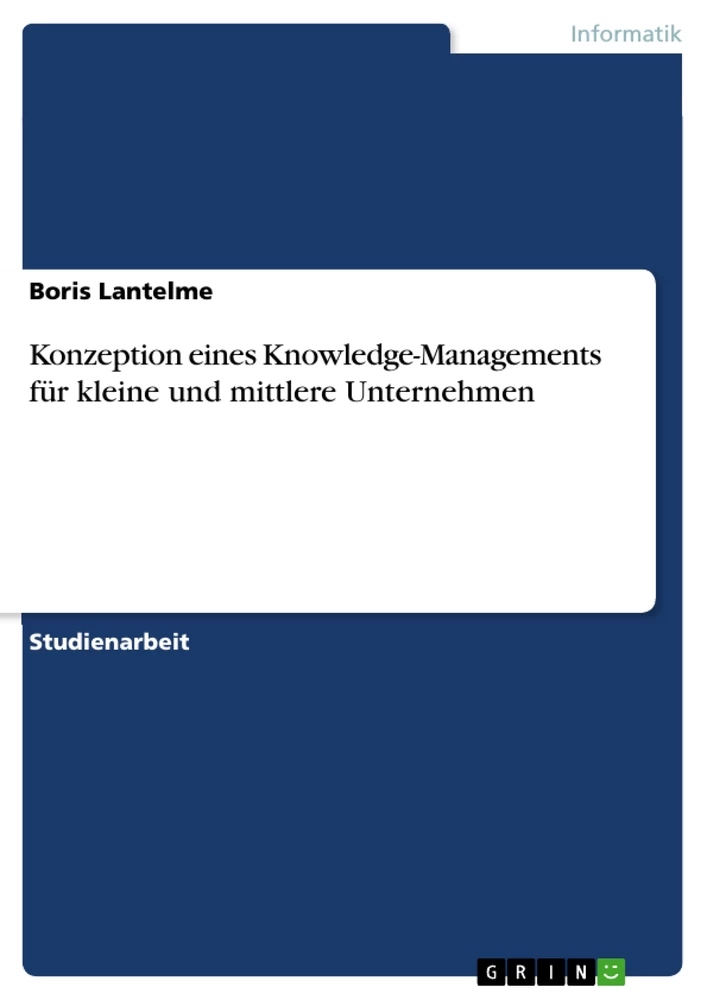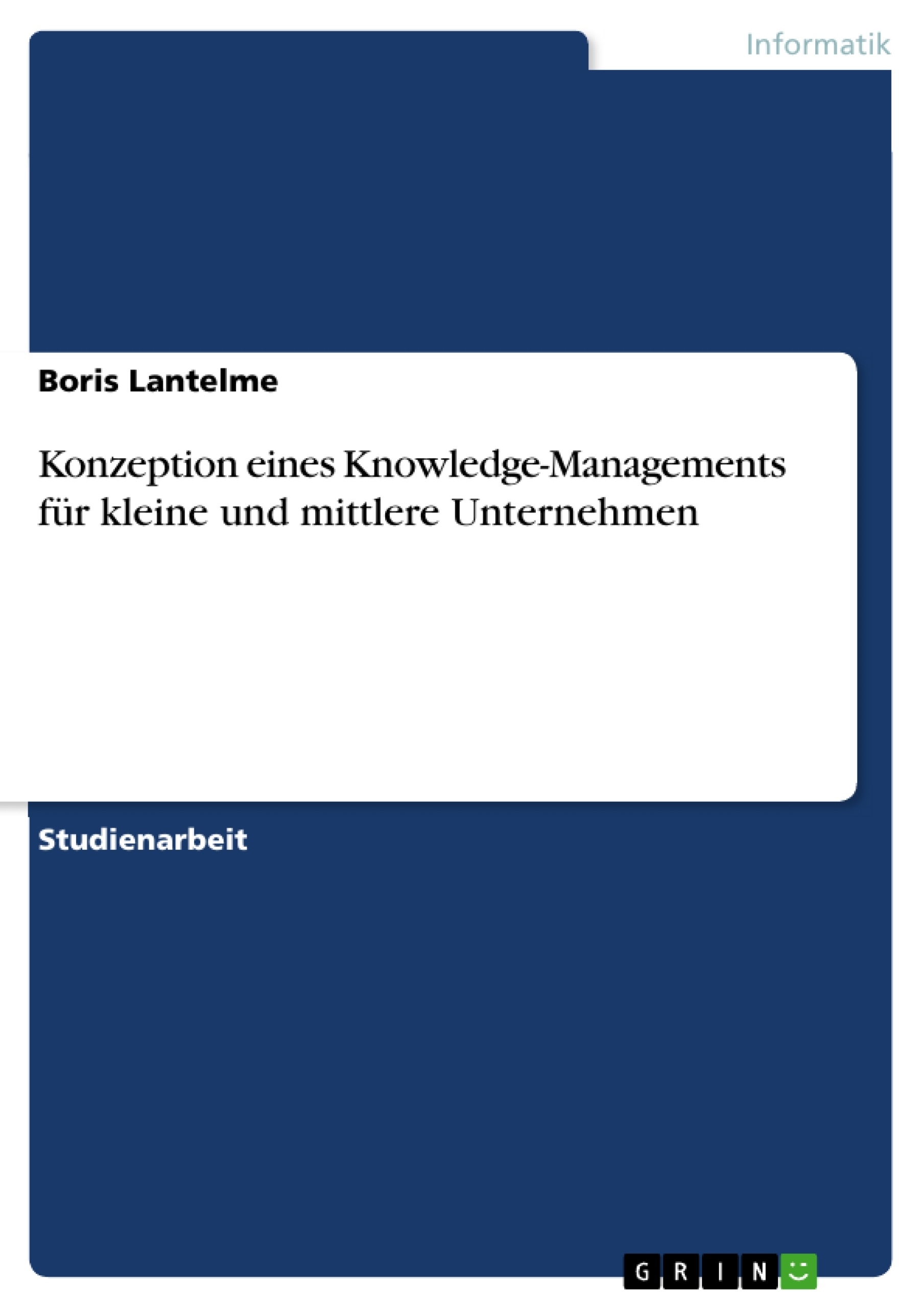In dieser Arbeit soll das Konzept eines Wissensmanagementsystems entwickelt werden, dass an den spezifischen Belangen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ansetzt. Im Unterschied zu Großunternehmen bieten KMU andere Rahmenbedingungen für ein derartiges System, die sich in einem anderen Anforderungsportfolio niederschlagen. Ein solches wird im Rahmen dieser Arbeit zunächst entwickelt und hierauf basierend schließlich ein Konzept für ein Wissensmanagementsystem in kleinen und mittleren Unternehmen erstellt.
Hierbei soll das Fachgebiet "Datenverarbeitung in der Konstruktion" (DiK) der Technischen Universität Darmstadt exemplarisch als mittelständisches Unternehmen aufgefasst werden. Damit gehen die spezifischen Belange, der hier beschäftigten Mitarbeiter, die hierzu im Rahmen dieser Arbeit befragt wurden, in die Anforderungsspezifikation ein. Ein weitergehendes Wissensmanagement baut stets auf einer derartigen unternehmensspezifischen Umfeldanalyse auf. In diesem Zusammenhang zeigt diese Arbeit das grundsätzliche Vorgehen bei der Konzeption eines Wissensmanagementsystems.
Abschließend wird eine Softwarelösung in Bezug auf die erarbeiteten Ansprüche untersucht und hinsichtlich der Eignung zum Einsatz als IT-Werkzeug zur Unterstützung eines Wissensmanagement am Fachgebiet DiK beurteilt.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung in das Wissensmanagement
- 2.1 Grundbegriffe des Wissensmanagements
- 2.1.1 Abgrenzung von Daten, Informationen und Wissen
- 2.1.2 Klassifikation von Wissensarten
- 2.1.3 Mechanismen der Wissensveränderung
- 2.2 Wissen in Unternehmen
- 2.3 Wissenskreislauf in Unternehmen
- 2.3.1 Entstehung und Beschaffung von Wissen
- 2.3.2 Speicherung und Wandel von Wissen
- 2.3.3 Verteilung und Nutzung von Wissen
- 2.3.4 Schutz von Wissen
- 2.4 Wissensmanagementsysteme als Wissensmarkt
- 2.5 Operationalisierung von Wissensmanagement-Systemen
- 2.5.1 Operative Prozesse des Wissensmanagements
- 2.5.2 Betriebliche Steuerprozesse für Wissensmanagement
- 2.6 Werkzeuge für Knowledge-Management im Unternehmen
- 2.6.1 Betriebsorganisation
- 2.6.2 Informationstechnologische Werkzeuge
- 2.7 Grundlegende Anforderungen an Wissensmanagementsysteme
- 3 Allgemeine Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an Wissensmanagementsysteme
- 3.1 Merkmale von KMU
- 3.1.1 Abgrenzung von KMU und Großunternehmen
- 3.1.2 Spezifische Besonderheiten von KMU
- 3.1.3 Stärken und Schwächen von KMU
- 3.1.4 Organisationsstruktur kleiner und mittlerer Unternehmen
- 3.2 Bestimmung der Anforderungen von KMU an ein Wissensmanagement
- 3.2.1 Entstehung und Beschaffung von Wissen
- 3.2.2 Speicherung und Sicherung von Wissen
- 3.2.3 Verteilung und Nutzung von Wissen in KMU
- 3.2.4 Anforderungen an ein Gesamtsystem
- 3.2.5 Anforderungskatalog von KMU an Wissensmanagementsysteme
- 4 Anforderungsanalyse innerhalb eines konkreten Anwendungsfeldes
- 4.1 Das Fachgebiet DiK als KMU
- 4.1.1 Quantitative und führungsspezifische Merkmale
- 4.1.2 Struktur und Arbeitsabläufe
- 4.1.3 Besonderheiten der Sichtweise des DiK als KMU
- 4.2 Anforderungen des DiK an ein Wissensmanagementsystem
- 4.2.1 Entstehung und Beschaffung von Wissen
- 4.2.2 Speicherung und Sicherung von Wissen
- 4.2.3 Verteilung und Nutzung von Wissen
- 4.2.4 Befragung der Mitarbeiter des DiK
- 4.2.5 Anforderungen an ein Gesamtsystem
- 4.2.6 Anforderungskatalog des DiK an ein WMS
- 5 Entwicklung eines Konzepts für Wissensmanagement in KMU
- 5.1 Klassifikation der Anforderungen eines KMU
- 5.2 Konzeption eines Wissensmanagements für das Fachgebiet DiK
- 5.3 Erweiternde Elemente eines Wissensmanagementsystems
- 5.4 Konzeption der Kernaspekte eines Wissensmanagements für KMU
- 5.4.1 Anforderungsklassifikation
- 5.4.2 Konzeption des Kernsystems
- 5.4.3 Erweiternde Systemelemente
- 6 Exemplarische Realisierung eines Wissensmanagementsystems
- 6.1 Anforderungen an ein IT Tool zur Verwendung am DiK
- 6.2 Funktionsumfang der Software
- 6.2.1 Installation in Testumgebung
- 6.2.2 Beschreibung der Programmnutzung
- 6.2.3 Funktionsumfang
- 6.3 Bewertung der Eignung
- 7 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Konzeption eines Wissensmanagements für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) am Beispiel des Fachgebiets Datenverarbeitung in der Konstruktion (DiK) an der Technischen Universität Darmstadt. Ziel ist es, die spezifischen Anforderungen von KMU an ein Wissensmanagement zu analysieren und ein praktikables Konzept zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse des DiK zugeschnitten ist.
- Anforderungen von KMU an Wissensmanagement
- Konzeption eines Wissensmanagementsystems für KMU
- Anforderungsanalyse am Beispiel des Fachgebiets DiK
- Entwicklung eines praktikablen Konzepts für Wissensmanagement im DiK
- Bewertung der Eignung eines exemplarischen IT-Tools
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Dieses Kapitel führt in die Grundlagen des Wissensmanagements ein, definiert zentrale Begriffe und beleuchtet die verschiedenen Arten von Wissen, Mechanismen der Wissensveränderung und den Wissenskreislauf in Unternehmen. Es beleuchtet die Rolle von Wissensmanagementsystemen als Wissensmarkt und erläutert die Operationalisierung von Wissensmanagement-Systemen.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Anforderungen von KMU an ein Wissensmanagementsystem. Es analysiert die Merkmale von KMU, ihre Stärken und Schwächen sowie die Besonderheiten ihrer Organisationsstrukturen und diskutiert die Herausforderungen und Chancen von Wissensmanagement in diesem Kontext.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel untersucht die Anforderungen des Fachgebiets DiK als KMU an ein Wissensmanagementsystem. Es analysiert die quantitative und führungsspezifische Struktur des DiK, die Besonderheiten seiner Arbeitsabläufe und die spezifischen Anforderungen an ein Wissensmanagement in diesem Umfeld.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel entwickelt ein Konzept für Wissensmanagement in KMU, basierend auf den zuvor analysierten Anforderungen. Es klassifiziert die Anforderungen, konzeptioniert das Kernsystem und erweitert dieses durch zusätzliche Elemente, die den Bedürfnissen von KMU gerecht werden.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, KMU, Fachgebiet DiK, Anforderungsanalyse, Konzeption, Wissensmanagementsystem, IT-Tool, Wissenskreislauf, Wissensarten, Operationalisierung, Organisationsstrukturen, Arbeitsabläufe.
Häufig gestellte Fragen
Warum brauchen KMU ein spezielles Wissensmanagement?
KMU haben oft weniger Ressourcen als Großunternehmen und benötigen daher schlankere, praxisnahe Systeme, die auf ihre flachen Hierarchien zugeschnitten sind.
Was ist der Unterschied zwischen Daten, Informationen und Wissen?
Daten sind Zeichen, Informationen sind Daten im Kontext, und Wissen ist die Verknüpfung von Informationen mit Erfahrung und Anwendung.
Welche Rolle spielt das Fachgebiet DiK in der Arbeit?
Das Fachgebiet DiK der TU Darmstadt dient als exemplarisches Anwendungsfeld für ein KMU, um Anforderungen direkt bei Mitarbeitern zu erheben.
Was sind die Kernphasen des Wissenskreislaufs?
Der Kreislauf umfasst die Entstehung, Speicherung, Verteilung, Nutzung und den Schutz von Wissen im Unternehmen.
Wie wichtig sind IT-Werkzeuge für das Wissensmanagement?
Sie sind unterstützende Werkzeuge, die den Austausch und die Archivierung erleichtern, müssen aber zur Unternehmenskultur passen, um genutzt zu werden.
- Quote paper
- Boris Lantelme (Author), 2002, Konzeption eines Knowledge-Managements für kleine und mittlere Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2593