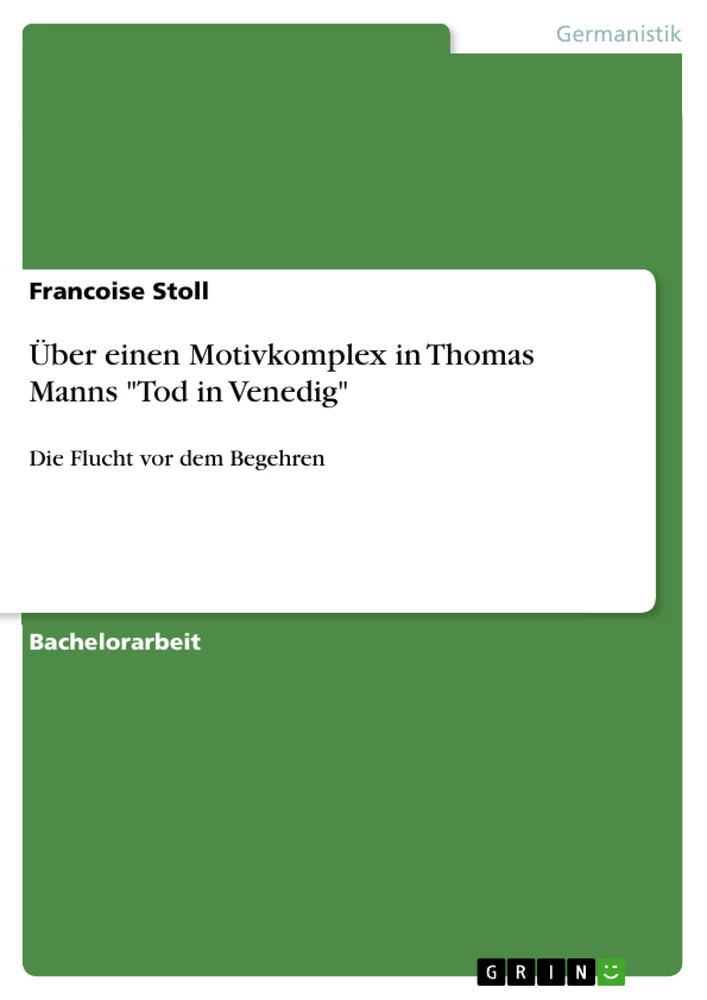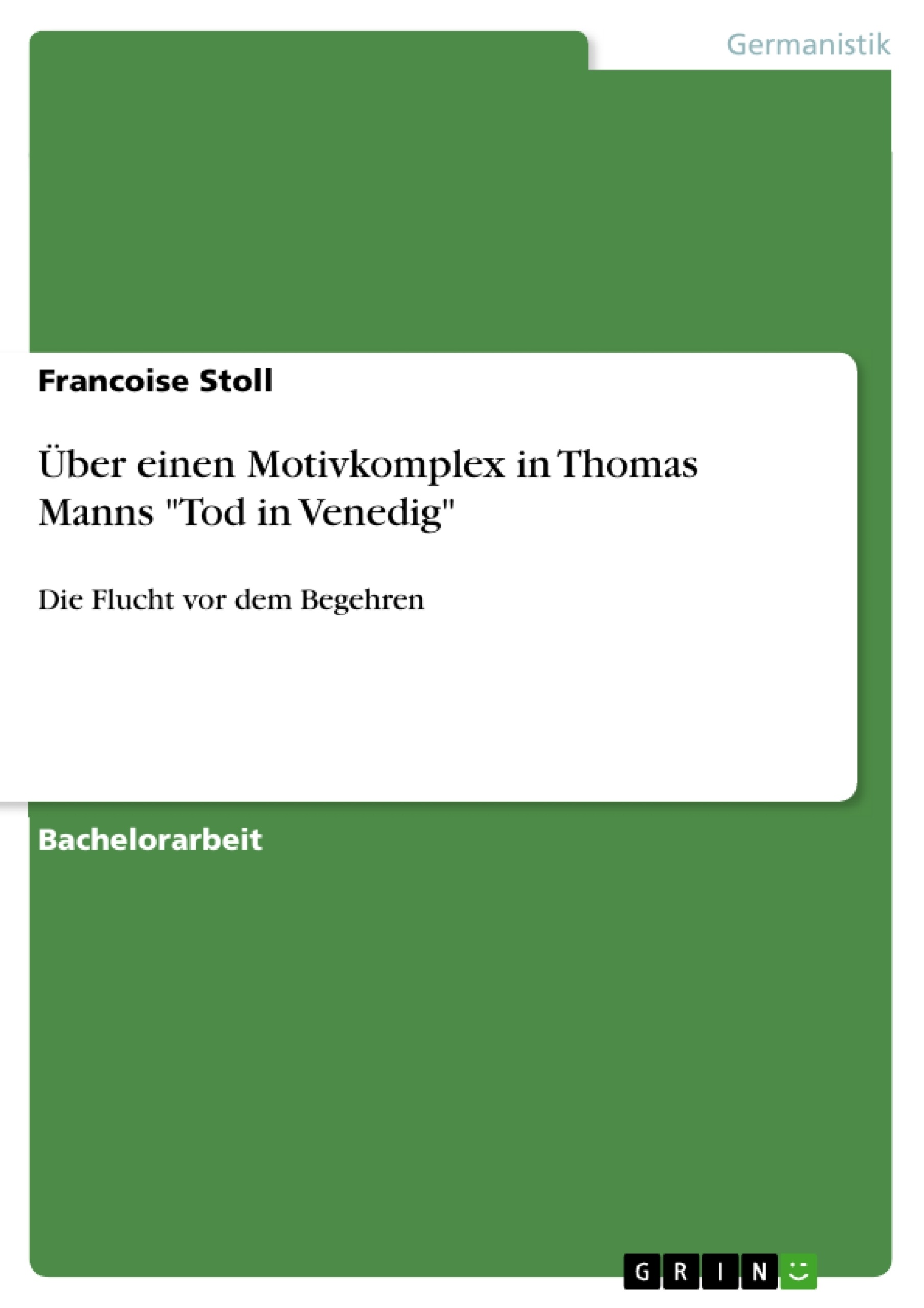Thomas Mann (06.06.1875 – 12.08.1955) ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. 1929 gewann er den Nobelpreis für Literatur. Neben den Romanen „Die Buddenbrocks“ (1901) und „Der Zauberberg“ (1924) gilt die Novelle „Der Tod in Venedig (1913) als einer seiner größten Erfolge. Die Erzählung entfachte, aufgrund der heiklen Beziehung zwischen dem Protagonisten Gustav Aschenbach und dem polnischen Knaben Tadzio, zahlreiche Diskussionen. Mann musste sich immer wieder gegen „de[n] Vorwurf der Unmoral oder Obszönität“ verteidigen.
Seit seinem Erscheinen wurde „Der Tod in Venedig“ reichlich in Briefen und Rezensionen besprochen und kritisiert. Auch in der Forschung wurde Manns Werk bis ins kleinste Detail behandelt. „Kaum eine der Novellen Thomas Manns erfreut sich unter den Interpreten so großer Beliebtheit wie ‚Der Tod in Venedig‘“. Die unterschiedlichsten Interpretationen wurden aufgestellt und es gibt wohl keinen Bereich oder Motivkomplex, der noch nicht untersucht wurde. Dennoch befasst man sich in der Sekundärliteratur häufig nur oberflächlich mit der Erzählung und basiert sich zu sehr auf bereits erschienene Kritiken – anstatt sich mit dem primären Text zu beschäftigen. Trotz des „Überschusses“ an Forschungsliteratur und der Tatsache, dass „Der Tod in Venedig“ zu einer sehr verbreiteten Schullektüre wurde, mangelt es an Aktualität. Die meisten Werke sind anfangs des 20. Jahrhunderts oder zwischen den 1970er und Ende der 1990er Jahren erschienen. In den letzten 13 Jahren wurde weitere – aber kaum nennenswerte – Sekundärliteratur publiziert. Denn es handelt sich überwiegend um Lektüreschlüssel und Schülerhilfen.
Die vorliegende Arbeit soll nicht nur zur Aktualität beitragen, sondern auch zwei wichtige Motive des „Tod in Venedig“ verbinden, nämlich die Flucht und das Begehren. Selbstverständlich sind beide Themen bereits erforscht und behandelt worden, allerdings noch nicht in der hier genannten Kombination. Die körperliche Flucht des Protagonisten, also die tatsächliche Reise (von München nach Italien), wird thematisiert. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf Aschenbachs geistiger Flucht.
Inhaltsverzeichnis
A Einleitung
B Aschenbachs Flucht vor dem Begehren
I Zwischen Dienst und Verlangen
II Der Wunsch nach Entbürdung
III Fluchtdrang
IV Die Sehnsucht nach dem Ort der Bestimmung
V Der Ausbruch des Verlangens
1. Ästhetische Reize
2. „Väterliche“ Empfindungen
3. Fluchtversuche
VI Der Triumph der Begierde
VII Die Auflösung im Begehren
C Fazit
D Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Thomas Manns Novelle "Der Tod in Venedig"?
Die Erzählung handelt von dem alternden Schriftsteller Gustav Aschenbach, der nach Venedig reist und dort eine obsessive Leidenschaft für den polnischen Knaben Tadzio entwickelt.
Welche zwei Motive verbindet diese Arbeit?
Die Arbeit verbindet die Motive der Flucht (physisch und geistig) mit dem des Begehrens.
Was wird unter "Aschenbachs geistiger Flucht" verstanden?
Es beschreibt seinen inneren Rückzug von bürgerlicher Disziplin und Dienstpflicht hin zu den entfesselten Emotionen und dem Rausch der Schönheit.
Warum war das Werk bei seinem Erscheinen umstritten?
Aufgrund der heiklen Thematik der Knabenliebe sah sich Thomas Mann Vorwürfen der Unmoral oder Obszönität ausgesetzt.
Was symbolisiert Venedig in der Novelle?
Venedig dient als Ort der Bestimmung, der einerseits für ästhetische Schönheit steht, aber durch die grassierende Cholera auch für Verfall und Tod.
- Citar trabajo
- Francoise Stoll (Autor), 2013, Über einen Motivkomplex in Thomas Manns "Tod in Venedig", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262080