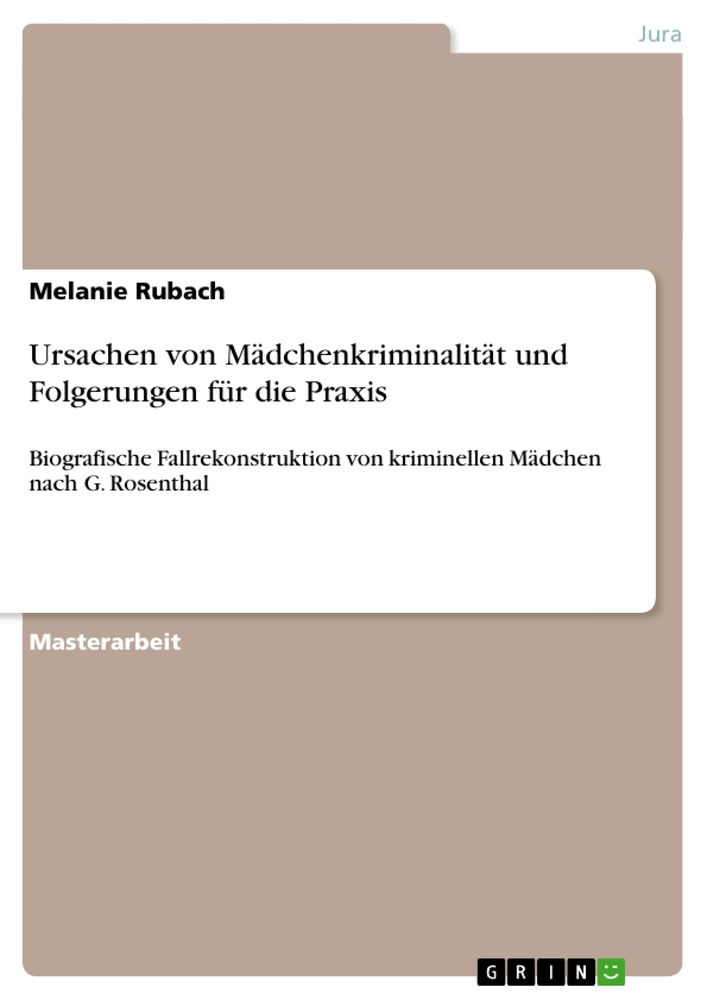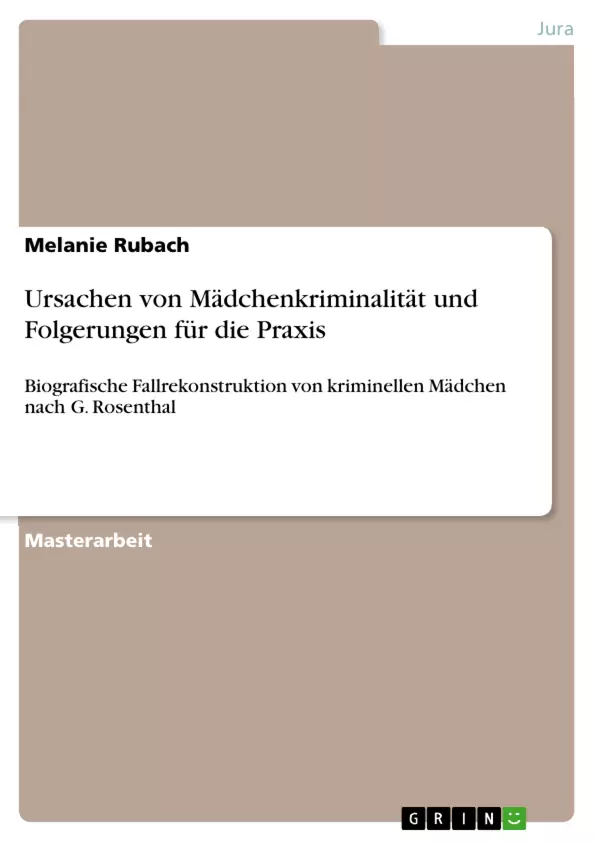Polarisierende Zeitungsartikel, wie „Aggressive Mädchenbanden: Pöbeln, rauben, drohen rund um den Hauptbahnhof“ oder Fernsehsendungen, wie „die Mädchenbanden von L.A.“ und „die Mädchen Gang“ , fordern indirekt zu der Behandlung einer eher unbeachteten Thematik, der Kriminalität von Mädchen und jungen Frauen, auf. In aktuellen Forschungsansätzen gewinnt dieses Thema wieder zunehmend an Beachtung. Auf der einen Seite um mögliche Erklärungsansätze für die Unterschiede von Jungen- und Mädchenkriminalität zu finden und auf der anderen Seite, um feministische Strömungen zu kontrastieren und den Bereich der weiblichen Kriminalität als eine eigene Kriminalitätsform zu erkennen und in ihrer Ganzheit zu betrachten.
In der Vergangenheit wurde meistens das delinquente Verhalten von männlichen Jugendlichen in den Fokus genommen, begründet in der vermeintlichen Unterrepräsentanz von weiblicher Kriminalität. So wurden im Jahr 2011 in Deutschland 214.736 Personen als tatverdächtige Jugendliche im Alter von 14 – 18 Jahren ermittelt, von denen 69,4 Prozent männlich und 30,6 Prozent weiblich waren. Der geringe Anteil von Mädchen- und Frauenkriminalität wird in aktuellen Forschungsansätzen, erklärt durch mögliche gesellschaftlich gebilligte Tarnmechanismen oder selektiver Sanktionierung und Kriminalisierung, bezweifelt. Bruhns/Wittmann weisen darauf hin, dass die Mädchenkriminalität bei einem Vergleich von Hell- und Dunkelfeld ein höheres Niveau als gedacht erreicht hat und dass es essenziell ist, das Phänomen Mädchenkriminalität nicht nur unter dem Gesichtspunkt ihrer geringen Häufigkeit zu untersuchen, sondern es „als einen eigenständigen Aspekt“ zu betrachten.
Studien über Mädchenkriminalität versuchen Erklärungsansätze in Auflehnungsmechanismen gegen eine Unterordnung im Geschlechterverhältnis und eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten sowie den Ausbruch aus Stereotypisierungen zu finden. In neueren Auflagen Göppingers kommt dieser auch zu dem Schluss, dass Mädchenkriminalität, entgegen der vorherigen Annahme, bestimmte weibliche Lebensentwürfe miteinschließt und nicht hauptsächlich mit männlich dominierten Theorien erklärt werden kann. Dieser kurze Abriss zeigt auf der einen Seite, inwieweit sich die Forschung hinsichtlich der Erklärungsansätze spaltet, und auf der anderen Seite, wie wichtig es ist, die Kriminalität von Mädchen nicht nur unter dem Aspekt ihrer „statistischen“ Unterrepräsentanz zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorieteil
- 2.1 Begriffsbestimmungen
- 2.2 Häufigkeit von Mädchenkriminalität
- 2.3 Aktueller Forschungsstand
- 2.3.1 Klassische Ansätze
- 2.3.2 Feministische Theorien
- 2.3.3 Aktuelle Ansätze
- 2.3.4 Zusammenfassung
- 3 Ziele und Fragestellung für die eigene Studie
- 4 Methodik der Studie
- 4.1 Forschungsdesign - Qualitativ vs. Quantitativ
- 4.2 Methodenauswahl
- 4.3 Stichprobe
- 4.4 Durchführung der Datenerhebung und -erfassung
- 4.5 Datenauswertung
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Ausgangspunkt der Untersuchung
- 5.2 Fallrekonstruktion
- 5.2.1 Fallrekonstruktion Susi
- 5.2.2 Fallrekonstruktion Nadine
- 5.2.3 Fallrekonstruktion Anja
- 5.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fallrekonstruktionen und Typenbildung
- 5.3.1 Typenbildung 1: Die handlungsleitende Mutter-Tochter-Beziehung
- 5.3.2 Typenbildung 2: Sucht nach Anerkennung – Doppelrolle im Selbstbild
- 6 Folgerungen für die Praxis
- 7 Zusammenfassung
- 8 Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Ursachen von Mädchenkriminalität und deren Auswirkungen auf die Praxis. Ziel ist es, bestehende Forschungsergebnisse zu analysieren und Lücken in der bisherigen Forschung zu identifizieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Fallbeispielen und die Entwicklung von Typologien, um ein umfassenderes Verständnis des Phänomens zu ermöglichen.
- Analyse des aktuellen Forschungsstandes zur Mädchenkriminalität
- Untersuchung der Rolle von Mutter-Tochter-Beziehungen
- Bedeutung des Bedürfnisses nach Anerkennung im Jugendalter
- Entwicklung von Typologien delinquenter Verhaltensweisen bei Mädchen
- Ableitung von praxisrelevanten Folgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die bisherige Unterbeachtung von Mädchenkriminalität in der Forschung und Praxis, verweist auf mediale Darstellungen, die das Thema zwar aufgreifen, aber oft vereinfachend oder stereotypisierend wirken. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, Mädchenkriminalität als eigenständige Form zu betrachten und nicht allein im Vergleich zu männlicher Delinquenz zu untersuchen. Die Einleitung begründet die Relevanz der Thematik und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit.
2 Theorieteil: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Mädchenkriminalität. Es definiert den Begriff, beleuchtet die Häufigkeit weiblicher Delinquenz im Vergleich zu männlicher und diskutiert kritisch unterschiedliche theoretische Ansätze. Klassische, feministische und aktuelle Ansätze werden kritisch beleuchtet und miteinander verglichen. Die Zusammenfassung des Theorieteils leitet über zur eigenen Forschungsfrage.
3 Ziele und Fragestellung für die eigene Studie: Dieses Kapitel formuliert die Forschungsfragen und -ziele der Arbeit präzise. Es benennt die Lücken im bisherigen Forschungsstand und erläutert, welche Forschungsfragen die Arbeit zu beantworten sucht, um ein fundiertes Verständnis der Ursachen von Mädchenkriminalität zu erlangen und praxisrelevante Konsequenzen zu ziehen.
4 Methodik der Studie: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise der Studie. Es erläutert die Wahl eines qualitativen Forschungsdesigns, die Auswahl der Methoden (z.B. Fallrekonstruktionen), die Zusammensetzung der Stichprobe, sowie die Durchführung der Datenerhebung und -auswertung. Die Begründung der gewählten Methoden wird ausführlich dargelegt und die methodischen Grenzen aufgezeigt.
5 Ergebnisse: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Fallrekonstruktionen und die daraus abgeleiteten Typologien. Die detaillierte Darstellung der einzelnen Fälle beleuchtet die individuellen Hintergründe und die vielschichtigen Ursachen des delinquenten Verhaltens. Die gewonnenen Erkenntnisse werden sorgfältig analysiert und zu zwei übergreifenden Typologien verdichtet: handlungsleitende Mutter-Tochter-Beziehung und Sucht nach Anerkennung.
Schlüsselwörter
Mädchenkriminalität, Forschungsstand, Feministische Theorien, Mutter-Tochter-Beziehung, Anerkennung, Fallrekonstruktion, Qualitative Forschung, Typologien, Praxisrelevanz.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Mädchenkriminalität
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Ursachen von Mädchenkriminalität und deren Auswirkungen auf die Praxis. Sie analysiert bestehende Forschungsergebnisse, identifiziert Forschungslücken und konzentriert sich auf die Analyse von Fallbeispielen, um ein umfassenderes Verständnis des Phänomens zu ermöglichen und Typologien delinquenter Verhaltensweisen bei Mädchen zu entwickeln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse des aktuellen Forschungsstandes zur Mädchenkriminalität, Untersuchung der Rolle von Mutter-Tochter-Beziehungen, Bedeutung des Bedürfnisses nach Anerkennung im Jugendalter, Entwicklung von Typologien delinquenter Verhaltensweisen bei Mädchen und die Ableitung von praxisrelevanten Folgerungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theorieteil (mit Begriffsbestimmungen, Häufigkeit von Mädchenkriminalität, aktuellem Forschungsstand inklusive klassischer, feministischer und aktueller Ansätze), Ziele und Fragestellung für die eigene Studie, Methodik der Studie (Forschungsdesign, Methodenauswahl, Stichprobe, Datenerhebung und -auswertung), Ergebnisse (Ausgangspunkt, Fallrekonstruktionen mit detaillierten Fallbeispielen und anschließender Typenbildung), Folgerungen für die Praxis, Zusammenfassung und Literatur- und Quellenverzeichnis.
Welche Methodik wird in der Studie verwendet?
Die Studie verwendet ein qualitatives Forschungsdesign mit Fallrekonstruktionen als zentrale Methode. Die Auswahl der Methode, die Zusammensetzung der Stichprobe und die Durchführung der Datenerhebung und -auswertung werden detailliert im entsprechenden Kapitel beschrieben. Die methodischen Grenzen werden ebenfalls aufgezeigt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse präsentieren detaillierte Fallrekonstruktionen, die die individuellen Hintergründe und Ursachen des delinquenten Verhaltens beleuchten. Aus diesen Fallbeispielen werden zwei übergreifende Typologien abgeleitet: handlungsleitende Mutter-Tochter-Beziehung und Sucht nach Anerkennung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mädchenkriminalität, Forschungsstand, Feministische Theorien, Mutter-Tochter-Beziehung, Anerkennung, Fallrekonstruktion, Qualitative Forschung, Typologien, Praxisrelevanz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, bestehende Forschungslücken zu schließen und ein umfassenderes Verständnis der Ursachen von Mädchenkriminalität zu ermöglichen. Sie will praxisrelevante Folgerungen ableiten und Typologien delinquenter Verhaltensweisen bei Mädchen entwickeln.
Wie wird der aktuelle Forschungsstand zur Mädchenkriminalität behandelt?
Der Theorieteil bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Klassische, feministische und aktuelle Ansätze werden kritisch beleuchtet und miteinander verglichen.
Welche Rolle spielen Mutter-Tochter-Beziehungen und das Bedürfnis nach Anerkennung?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Mutter-Tochter-Beziehungen und die Bedeutung des Bedürfnisses nach Anerkennung im Jugendalter als potentielle Einflussfaktoren auf delinquentes Verhalten bei Mädchen. Diese Aspekte werden in den Fallrekonstruktionen und der anschließenden Typenbildung deutlich.
- Citar trabajo
- M.A Melanie Rubach (Autor), 2013, Ursachen von Mädchenkriminalität und Folgerungen für die Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262093