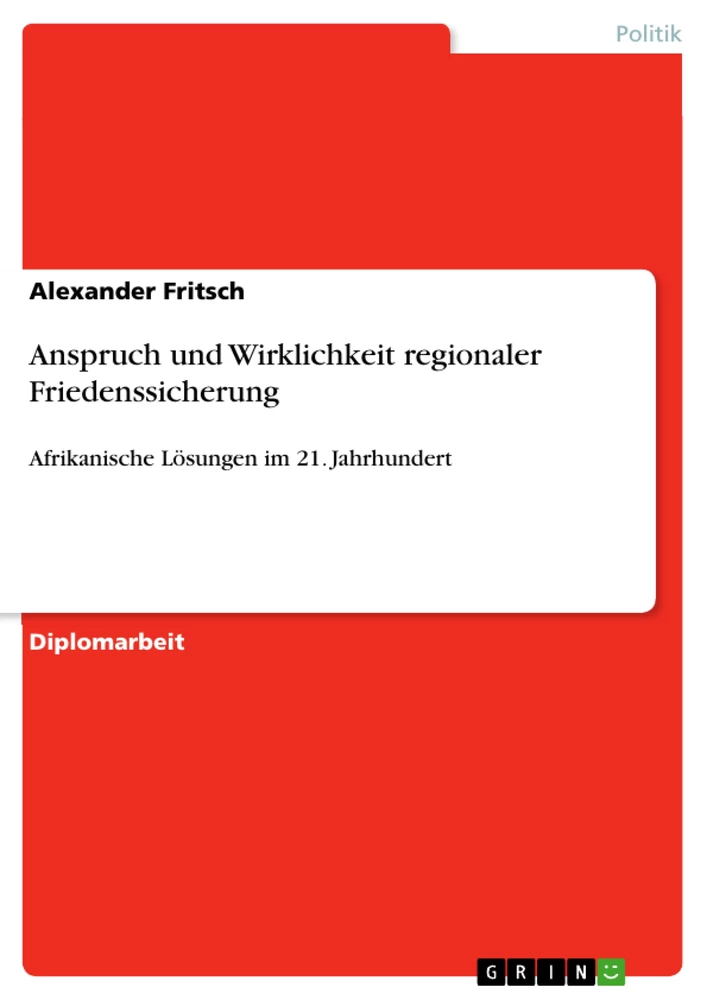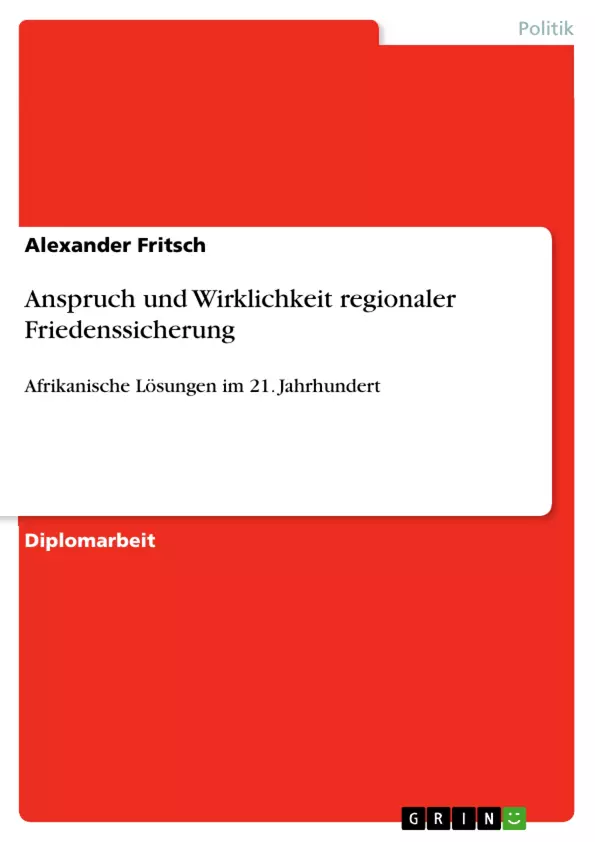Mit der Ausweitung des Zuständigkeitsbereiches der Vereinten Nationen mit immer umfassenderen Mandaten und komplexeren Missionen geriet das UN-Peacekeepiong immer mehr unter Druck. Konzepte wie R2P (responsibility to protect) ließen die internationale Staatengemeinschaft einem postwestphälischen Souveränitätsverständnisses entsprechend immer öfter intervenieren, auch außerhalb des UN-Rahmens.
Regionalorganisationen kommt dabei eine tragende Rolle zu, doch wo sie für Befürworter eines regionalen Ansatzes der Friedenssicherung einen verlängerten operativen Arm der Vereinten Nationen darstellen, sehen Kritiker wie u. a. der ehemalige UN-Generalsekretär Boutros-Ghali darin eine potenzielle Aushöhlung des UN-Gewaltmonopols.
Die Stärkung der Regionalorganisationen innerhalb der Friedenssicherung hat enormes Potenzial, birgt aber auch Risiken.
Zum einen werden ohnehin schon starke Regionalorganisationen, wie die Europäische Union und die NATO, gestärkt. Sie sind es auch, die das Gewaltmonopol des UN-Sicherheitsrats potenziell schwächen können, da sie auch, aber nicht im selben Ausmaß, von Ressourcenzuflüssen der internationalen Staatengemeinschaft abhängig sind und daher auch die Frage der Legitimation seitens des UN Sicherheitsrates eine andere Gewichtung hat. Es besteht die Befürchtung, "great powers would engage in neoimperial activities within their regions".
Parallel dazu passiert auf der anderen Seite das Gegenteil: Schwache Regionalorganisationen haben zwar nun mehr Spielraum betreffend ihrer Mandate, allerdings bleibt dieser theoretisch, da ihre Kapazitäten stark beschränkt sind, sodass sie weiterhin bei der Erfüllung ihrer Mandate abhängig von der internationalen Gebergemeinschaft bleiben. Diese sieht sich gemäß einem regionalen Ansatz immer weniger zuständig.
Gegenwärtig entsteht dadurch insbesondere für Afrika der Eindruck, als würden jene Probleme, die die Vereinten Nationen in die Krise schlittern ließen, regionalisiert und ausgelagert, um damit die internationale Staatengemeinschaft aus der Verantwortung zu lassen, ohne aber Lösungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Die Arbeit geht diesen Entwicklungen nach und spannt dabei einen Bogen von der theoretischen Auseinandersetzung des Konzeptes Peacekeeping, über die praktischen Implikationen anhand von Fallbeispielen bis hin zu konkreten Lösungsvorschlägen, wie ein Zusammenspiel von internationalen und regionalen Akteuren bei der Friedenssicherung im afrikanischen Kontext funktionieren kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Was will die Arbeit?
1.2. Wie gehe ich vor?
2. Theorizing Peacekeeping - Konzepte und Definitionen
2.1. Theoretischer Rahmen
2.1.1. Liberal Peace Theory
2.1.2. Global Culture
2.1.3. Cosmopolitanism
2.1.4. Kritische Theorie
2.2. Begriffe, Definitionen und Konzepte
2.2.1. Preventive Diplomacy
2.2.2. Peacemaking
2.2.3. Peacekeeping
2.2.4. Peacebuilding
2.2.5. Peaceenforcement
2.3. Peacekeeping Generationen
2.3.1. Erste Generation: Traditionelles (klassisches) Peacekeeping
2.3.2. Zweite Generation: Multidimensionales (erweitertes) Peacekeeping
2.3.3. Dritte Generation: Peace enforcement (robustes) Peacekeeping
2.4. Neuorientierung anhand von Peacekeeping Zielsetzungen
3. Die Krise des UN-peacekeeping in Afrika
3.1. Neue Kriege
3.1.1. Ökonomie und Finanzierung - local capacity
3.1.2. Art und Zielrichtung der Gewalt - Level of hostility
3.1.3. Akteure
3.1.4. Peacebuilding Triangle der „New Wars“
3.2. Strukturell begrenzte Belastbarkeit des UN Peacekeeping
3.2.1. Offensive Rhetorik und passives Handeln
3.2.2. Wer spring ein?
3.2.3. Die Motivation zu handeln
3.2.4. Zusammenfassung - Kein „Scramble for Africa“
4. Regionalorganisationen - Problemlösung oder Outsourcing der Probleme?
4.1. Vorteile regionaler Friedenssicherung
4.1.1. Schnellere Reaktions- und Handlungsfähigkeit
4.1.2. Höhere Bereitschaft zum Eingreifen
4.1.3. Bessere Kenntnis der Konfliktstruktur und höhere Akzeptanz
4.1.4. Geringe Kosten der Einsätze
4.2. Die Schattenseiten der Regionalisierung
4.2.1. Mangelnde Kapazitäten und zweifelhafte Professionalität
4.2.2. Gefahr der Instrumentalisierung durch regionale Hegemonialmächte
4.2.3. Gd
4.2.3.1. Endorsement im Gegensatz zu Autorisierung
4.3. Fazit
5. African Solutions
5.1. Die Afrikanische Union
5.2. .. .ihre subregionalen Partner
5.3. .und warum sie nicht genügen
5.3.1. Nichtbeachtung der Gegebenheiten in Afrika
5.3.2. Die Probleme sind nicht ausschließlich afrikanisch
5.3.3. Afrika ist nicht einheitlich
6. Partnerships
6.1. Operational Partnerships
6.1.1. co-deployment
6.1.2. preceeding operation
6.1.3. follow on operation
6.1.4. joint operation
6.2. Institutional Partnerships
6.3. Operational vs. Institutional partnership - der Networking Ansatz
6.4. UNAMID - Quadratur des Kreises
6.4.1. historischer Abriss
6.4.2. Von UNAMIS zur UNAMID
6.4.3. Sonderfall UNAMID
7. Conclusio
Abkürzungsverzeichnis
Quellenverzeichnis
Anhang A (Abstract deutsch)
Anhang B. (Abstract englisch)
Einleitung
„We the peoples of the United Nations (...) unite our strength to maintain international peace and security and (...) ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest (...).”
Charter of the United Nations, preamble[1]
Seit seinem Bestehen wird von Experten immer wieder die „Krise des UN-Peacekeeping“ beschworen, verbunden mit einer periodisch wiederkehrenden Forderung nach einer Reform dieses Instruments. Dabei muss man sich allerdings vor Augen führen, ''peacekeeping itself is an act of reform on the UN’s formal collective security system by generations of UN leaders and concerned diplomats.”[2]
Als solches ist Peacekeeping konstant Veränderungen unterworfen, die als Reaktion auf reale Krisen und globalpolitische Trends zu verstehen sind.
War es in der zweiten Hälfte des 20. Jh. durch die bipolare Weltordnung des kalten Kriegs hauptsächlich machtpolitisches Kalkül, so wurden unmittelbar nach 1989 humanitäre Gründe[3] für Friedensmissionen angeführt, die im 21. Jahrhundert in Kombination mit dem Konzept „human security“[4] in weiterer Folge auch sicherheitspolitische Überlegungen in Erscheinung treten lassen.
Die Misserfolge der vorletzten Dekade, wie etwa in Somalia (UNOSOM I und UNOSOM II), das folgenschwere Nichteingreifen in Ruanda oder auch ein verändertes strategisches Interesse durch neue Konflikte wie etwa den Balkankonflikt, ließen nach der anfänglichen Euphorie in den frühen 90er Jahren die Unterstützung für weitere UN-Missionen generell schwinden, auf dem afrikanischen Kontinent aber im Besonderen.[5]
Entwicklungen im neuen Jahrtausend, wie u.a. etwa Teilerfolge in Sierra Leone und Liberia, Migrationsströme von West und Nordafrika nach Europa, Angst vor regionaler Destabilisierung etc. haben in den letzten Jahren wieder zu einem gesteigerten internationalen Engagement auf dem Kontinent geführt. So sind heute etwa 98.000 Männer und Frauen in UN Missionen eingesetzt, die überwiegende Mehrheit davon, etwa 71 % der weltweit eingesetzten Peacekeeper, in Afrika[6].
Neu allerdings ist, dass sich darüber hinaus aber auch neue Akteure in Form von Regionalorganisationen und ihren subregionalen Ablegern verstärkt an der Friedenssicherung in Afrika beteiligt haben, die das Instrument des UN-Peacekeeping von Grund auf verändern und sowohl neue Chancen als auch Risiken mit sich bringen, in Afrika, aber auch andernorts.
1.1. Was will die Arbeit?
Ziel dieser Arbeit ist es, Peacekeeping als breites Konzept greifbar zu machen, aktuelle Entwicklungen aufzuzeigen und in den afrikanischen Kontext zu stellen. Dabei möchte ich mich vor allem auf die Rolle von Regionalorganisationen in Afrika konzentrieren und orientiere mich daher an folgenden Forschungsfragen:
- Was ist die „Krise des UN-Peacekeeping“?
- Ist die verstärkte Einbindung von Regionalorganisationen und ihren subregionalen Ablegern wirklich ein Weg aus dieser Krise?
- Welche Form der Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Regionalorganisationen und der UN scheint geeignet, um Friedenssicherung in Zukunft effizienter zu ermöglichen?
Darauf aufbauend möchte ich folgende Hypothesen verifizieren: Die Auslagerung der Verantwortung für Friedensmissionen an Regional organisationen führt zwar theoretisch zu einem aktiveren und rascheren Krisenmanagement aufgrund der geographischen Nähe, führt aber bei knappen, und im Falle afrikanischer Regionalorganisationen unzureichend vorhandenen Kapazitäten zu ineffizienten Missionen, für dessen humanitäre Folgen sich die internationale Staatengemeinschaft nicht mehr verantwortlich fühlt.
Zum Zweiten, die Zurückhaltung der internationalen Staatengemeinschaft einerseits, der politische Wille afrikanischer Regionalorganisationen andererseits, auf dem eigenen Kontinent aktiv zu intervenieren, gepaart mit dem Mangel an logistischen, militärischen und zivilen Kapazitäten, macht eine möglichst enge Zusammenarbeit, etwa nach dem Muster der UNAMID notwendig, in welcher eine genuin afrikanische Mission, mithilfe der Unterstützung der UN aktiv werden kann.
1.2. Wie gehe ich vor?
Die vorliegende Arbeit setzt methodologisch einen eher theoretischen Schwerpunkt. Eine Auseinandersetzung mit Problematiken innerhalb von Friedensmissionen kann nicht ernsthaft erfolgen, ohne sich zuerst mit Peacekeeping als solches in konzeptioneller Hinsicht auseinanderzusetzen.
So wird zu Beginn eine begriffsgeschichtliche Auseinandersetzung mit den mit Peacekeeping zusammenhängenden Begriffen unternommen. Ziel der Arbeit ist es aber nicht, aus den unzähligen Definitionsversuchen der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte eine bestimmte herauszugreifen. Vielmehr sollen im ersten theoretischen Teil die konzeptionelle und historische Entwicklungen überblicksartig nachgezeichnet, gängige Einteilungskriterien aufgezeigt und der Versuch eines neuen Erklärungsansatzes vorgestellt werden, der sich auf weiten Strecken an Bellamy und Williams orientiert.
In einem zweiten Schritt möchte ich das empirische Umfeld klären, in dem Friedensoperationen heute in Afrika operieren. Dabei möchte ich insbesondere auf die Art der Konflikte in Afrika eingehen und einige strukturelle Schwierigkeiten des UN Peacekeeping beleuchten. Das soll mithilfe intensiver Recherche sowohl von Primär- als auch Sekundärquellen erarbeitet werden.
Diese Quellen, insbesondere offizielle Dokumente der Vereinten Nationen, sind auch in den darauf folgenden Kapiteln primäre Bezugspunkte. Aufbauend auf den ersten beiden Teilen werde ich den oben genannten Forschungsfragen nachgehen, indem ich das Potenzial zur Lösung dieser „Krise des UN-Peacekeeping“ von Regionalorganisationen allgemein, und afrikanischen Organisationen im Speziellen betrachte.
Daraus ergibt sich insgesamt ein stark hermeneutisch geprägter wissenschaftlicher Zugang meiner in der Arbeit entwickelten Argumentation.
2. Theorizing Peacekeeping - Konzepte und Definitionen
„Unsere Theorien sind unsere Erfindungen. Sie sind nie mehr als kühne Vermutungen, Hypothesen; von uns gemachte Netze, mit denen wir die wirkliche Welt einzufangen versuchen“[7]
Sir Karl R. Popper
Peacekeeping als Idee und Konzept ist nur von Bedeutung, wenn sie in einen theoretischen Rahmen eingebettet ist. Dieses Kapitel versucht genau dies zu tun, indem es zuerst einen konzeptionellen Rahmen entwickelt und in weiterer Folge die bisherigen Definitionsversuche nachzeichnet.
2.1. Theoretischer Rahmen
Peacekeeping für eine Analyse greifbar zu machen, gestaltet sich deshalb so schwierig, weil dem Verständnis von Friedensoperationen unterschiedliche theoretische und praktische Konzeptionen der internationalen Politik zugrunde liegen. Jegliche Definition wird durch diese Konzepte maßgeblich beeinflusst.
Viele Debatten im Sicherheitsrat, als auch von Experten innerhalb und außerhalb der UNO lassen sich darauf zurückführen. „It is precisely because theory, broadly understood, is so important in guiding the questions we ask and the answers we reach that the UN has been unable to define peace operations.“[8] In dieser Arbeit möchte ich einige herausgreifen, die meiner Meinung nach für das Thema der Arbeit von Relevanz sind, da sie massgeblich die Diskussion formen, die die Art und Weise von Friedensmissionen auf dem afrikanischen Kontinent betreffen.
2.1.1. Liberal Peace Theory
Diese Theorie ist für Friedensoperationen sicherlich die einflussreichste, wie ich weiter unten noch belegen werde.
Auf der zwischenstaatlichen Ebene basiert die Theorie des liberalen Friedens auf der Beobachtung, dass “democratic states do not wage war on states they regard as beeing democratic. ”[9] Auch die Gefahr eines Bürgerkriegs ist tendenziell geringer.
Grundsätzlich werden dafür zwei Erklärungen angeführt:
Zum einen begrenzen die institutionellen Vorbedingungen, wie etwa die Gewaltenteilung die nationalen Entscheidungsträger in demokratischen Systemen in ihren Möglichkeiten, Krieg zu führen. Dieser Effekt wird durch internationale Institutionen, wie etwa die UN, bzw. internationale Konventionen, in die Demokratien üblicherweise eingebettet sind, weiter verstärkt. Eine Garantie der Grundrechte, sowie die Möglichkeit politische Konflikte zu artikulieren und gewaltlos zu lösen, bieten keinen Nährboden und Anreiz für bürgerkriegsähnliche Gewalteruptionen.
Die zweite Erklärung beruht auf der Annahme, dass Demokratien ihre jeweilige Legitimität untereinander anerkennen, und oft auch gemeinsame Interessen haben, allen voran den (internationalen) Handel, dem kriegerische Auseinandersetzungen nicht zuträglich wären.
Die Legitimität, die demokratischen Institutionen innerhalb ihres Einflussgebietes zuerkannt wird, macht es schwierig, Waffengewalt gegen die bestehende Ordnung zu mobilisieren und damit auch Bürgerkriege weniger wahrscheinlich.[10]
Die Theorie ist vor allem insofern relevant, als Theorie und Praxis von Friedenmissionen in ihrer Zielsetzung, nachhaltigen Frieden zu schaffen, oft von einem unausgesprochenen Bekenntnis zum demokratischen Frieden geleitet sind. Bellamy und Williams meinen dazu, “In arguing that peace operations are informed by liberal peace theory, we mean - by and large - that peace operations have tried to create stable peace by promoting and defending the principles that underpin liberal peace.”[11]
Es herrscht ein breiter Konsens unter westlichen NGOs, aber auch wichtigen internationalen Organisationen und Personen, dass die Förderung von demokratischen Institutionen das Risiko von Kriegen minimiert. So sprach etwa Bill Clinton in seiner State of the Union Address im Jänner 1994 “Ultimately the best strategy to insure our security and to build a durable peace is to support the advance of democracy elsewhere. ”[12], der ehemalige UNGeneralsekretär Kofi Anan betont, dass “The right to choose how they are ruled, and who rules them, must be the birthright of all people, and its universal achievement must be a central objective of an Organization [the UN] devoted to the cause of larger freedom”[13] bzw. schlägt eine Reihe von Argumentations- und Legitimationsversuchen der Kriege in Afghanistan und Irak in die selbe Kerbe.
Obwohl tatsächlich eine Verbindung zwischen Liberalismus, Demokratie und Frieden besteht, sind die Implikationen für Friedensmissionen nicht unumstritten.
Von Realisten wie beispielsweise Mearsheimer wird hingewiesen, dass “the values underpinning liberal peace are not universal or causally connected to peace but reflect the ideological preferences of the world’s most powerful actors. ”[14]
Ein empirisches Problem stellt der Umstand dar, dass ein schneller Übergang zur Marktwirtschaft und eine rasche Demokratisierung oft eine destabilisierende Wirkung in Nachkriegsgesellschaften haben können und damit einen negativen Effekt für langfristig nachhaltigen Frieden haben können.
China und der globale Süden argumentieren daher, dass Missionen sich darauf beschränken sollten, Differenzen zwischen Staaten und Akteuren zu lösen, anstatt eine bestimmte Ideologie umzusetzen und zu implementieren. “From this perspective, stable peace can only be built on the maintenance ofpeace between states, and this requires respect for the sanctity of national sovereignty.”[15]
Diese Sichtweise beschränkt das Aufgabenspektrum von Friedensoperationen allerdings lediglich auf die Friedensschaffung zwischen Staaten.
2.1.2. Global culture
Roland Paris führt an, dass eine Art Weltkultur sowohl formale als auch informelle Richtlinien festlegt, die für Peace Operations als akzeptabel erachtet werden, ungeachtet ihrer Effektivität.[16] “Peacekeeping agencies seem willing to rule out normatively unacceptable strategies a priori without even considering the potential effectiveness of theses strategies as techniques for fostering peace, which is the stated goal of peacekeeping; and concerns about international propriety appear, at least on some occasions, to take precedence over considerations of operational effectiveness.”[17]
Paris führt dabei als Beispiel das Trusteeship der Nachkriegsjahre an, das trotz seiner relativ guten Erfolgsbilanz aufgrund der neokolonialen Konnotationen in Misskredit kam. Gleichzeitig hat die Dominanz der Liberal Peace Theory dazu geführt, dass heutige Friedensmissionen auf eine rasche Demokratisierung, Wahlen und die Implementierung einer liberalen Marktwirtschaft drängen, ungeachtet des destabilisierenden Potenzials, dass sie auf Post-Konflikt Regionen und fragile Staaten haben könnten.
2.1.3. Cosmopolitanism
Die Vorstellung eines Weltbürgertums, basierend auf gemeinsamen, universell gültigen moralischen Grundsätzen, spiegelt sich in der Forderung wider, zukünftige Friedensmissionen nach diese kosmopolitischen Gesichtspunkgen im Sinne von Global Governance zu gestalten. Vertreter dieser Idee wie etwa Tom Woodhouse oder Oliver Ramsbotham sprechen sich in diesem Zusammenhang dafür aus, dass kosmopolitische Friedensmissionen von einer stehenden UN Emergency Unit durchgeführt werden sollen, die in der Lage sein soll, das gesamte Spektrum der UN Sicherheitsagenda abzudecken.
Die Idee einer derartigen Einheit ist so alt wie die UN selbst und hat in periodischen Abständen immer wieder ihren Weg in die öffentliche Debatte gefunden.
Bereits ein paar Jahre vor Ramsbotham und Woodhouse wurde das von Mary Kaldor in Zusammenhang mit den „New Wars“ unter dem Label „Cosmopolitan law enforcement“ diskutiert: Nach ihrer Idee erfordern kosmopolitische Friedensoperationen eine völlig neue Art von Experten, die fachliche Kompetenzen sowohl auf polizeilichen als auch militärischen Gebieten vorweisen können.[18] Dem ist allgemein kaum etwas entgegenzuhalten, und diese Überlegung ist auch seit längerem in diverse Trainingsporgramme im Kontext von Peacekeeping eingeflossen.
2.1.4. Kritische Theorie
Ausgehend von der Annahme der Kritischen Theorie, dass Theorie nie neutral, sondern immer für jemanden und für einen Zweck benutzt wird, stellen sich in Bezug auf Friedensmissionen zwei Fragen:[19]
1. Welche Theorien, Werte, Ideologien und Interessen definieren unser Verständniss von Friedensmissionen und wessen Theorien, Werte Ideologien und Interessen ist durch die momentane Paxis der Friedensoperation am meisten gedient?
2. Welche Theorien und Praktiken von Friedensmissionen sind am ehesten dazu geeignet, Selbstbestimmung zu fördern?
Kritische Theoretiker sehen in den Friedensmissionen ein Instrument, eine Ordnung aufrechterhalten, die der momentanen kapitalistischen politischen Ökonomie am ehesten entgegen kommt.
Gemäss einem Zentrum-Peripherie Modell kreiert der globale Kapitalismus periphere Regionen, in denen diese Ordnung zusammenbricht. Da der Wohlstand des Zentrums vom globalen Handel abhängig ist, besteht ein Interesse, zu verhindern, dass Regionen sich durch ein Zurückfallen in Anarchie dem Handel und Zugriff auf Rohstoffe entziehen. Dieses Interesse wird dabei zur treibenden Kraft für Friedensmissionen. „In most cases, the global centre is unwilling to sacrifice men and materiel to bring peace to peripheral regions of the world and uses a range of proxies instead - including the UN, regional organizations and humanitarian agencies - in order to maintain peace.”[20]
Der zweiten Frage versucht die kritische Theorie dadurch nachzugehen, in dem sie ihr Augenmerk auf Gruppen richtet, deren Anliegen oft ungehört bleiben (marginalisierte Gruppen, Frauen, Kinder, etc.), ein Ansatz der seit 2000 beginnend mit der „Resolution on Woman, Peace and Security“ verstärkt auch von der UN aufgegriffen wird.[21]
Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale in den Konzeptionen ist die Unterscheidung zwischen einem westphälischen Verständnis der internationalen Politik, und einem post- westphälischen. Die UN-Charter bezieht sich in ihrer Ausrichtung und den Instrumenten, die sie anbietet, auf ein System souveräner Staaten, deren Souveränität unter allen Umständen zu schützen und zu respektieren ist. Es ist nicht zuletzt deshalb auch keine Erwähnung bzw. völkerrechtliche Verankerung von Peacekeeping oder Peacebuilding etc. im Allgemeinen, und bei innerstaatlichen Konflikten im Besonderen, in ihr zu finden.
Mit dem Ende der Bipolarität des Kalten Krieges hat sich das Verständnis von Souveränität grundsätzlich gewandelt und entwickelte sich systematisch von einer engen Vorstellung hin zu einer breiteren Definition, die Souveränität als Verantwortung gegenüber den Bürgern betrachtet. Der Ansatz „Responsibility to protect (R2P)“, erstmals von der kanadischen Regierung 2001 vorgestellt, definiert Souveränität folgendermaßen: „Wenn ein Staat nicht willens oder in der Lage ist, seine Bevölkerung vor Genozid, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen, geht die Verpflichtung zum Schutz auf die anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft über.“[22] Es liegt auf der Hand, dass aufgrund unterschiedlicher kultureller und historischer Erfahrung diese Vorstellung von Souveränität unterschiedlich aufgenommen wird.
Ehemalige Kolonien, die ihre Unabhängigkeit und Souveränität erst erkämpft haben, sehen sich durch ein post-westphälisches Verständnis bedroht: „ Hier setzt die Kritik vieler Entwicklungsländer an: Man fürchtet einen humanitär verkleideten Neokolonialismus, in dem humanitär verbrämte militärische Interventionen ein legitimes Mittel der Machtausübung der Starken werden.“[23]
Im Gegenzug, große Staaten des Zentrums, allen voran die USA, aber auch die Gruppe der G 8, die mittlerweile zur G-20 angewachsen ist, sind in sich stabil und haben auch bei einem sehr weitgehenden post-westphälischen Souveränitätsverständniss kaum internationale Intervention im selben Ausmaß zu befürchten, wie das eventuell Staaten der Dritten Welt wahrnehmen. Sie würden dadurch vielmehr eine Ausweitung ihres außenpolitischen Spielraums erfahren, zum Preis eines neuerlichen Vorwurfs des Neoimperialismus, getarnt durch das Label der „humanitären Intervention“.
„Die an Einfluss gewinnenden Mächte, allen voran China und Russland, beharren dagegen bisher auf dem völkerrechtlichen Status quo mit seinem Vorrang staatlicher Souveränität. Die Gegensätzlichkeit der Argumentationen wird aktuell an den konkurrierenden Resolutionsentwürfen zur Endstatusfrage des Kosovo deutlich.“[24]
Einer der Hauptwegbereiter für den neuen Interventionismus war sicher die zunehmende Sensibilisierung durch die Terroranschläge vom 11.September und den darauf folgenden Krieg gegen den Terror.
Es hat sich innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft durchgesetzt, dass Konfliktbearbeitung insbesondere bei innerstaatlichen Konflikten und Bürgerkriegen grundsätzlich mit der Stärkung oder in vielen Fällen auch der (Neu)Schaffung demokratischer Institutionen verbunden wird. Das erfordert eine spezifische Herangehensweise auch was den Einsatz bestimmter Instrumente angeht, die, da nicht in der Charter erwähnt, erst nach und nach entwickelt werden mussten.
2.2. Peacekeeping - Begriffe, Definitionen und Konzepte
Das Konfliktbewältigungsinstrumentarium der Vereinten Nationen ist sehr weitreichend, und umfasst mehrere Tools, die durch ihre Interdependenz in der Praxis kaum getrennt voneinander Anwendung finden und sich über ein weites Betätigungsfeld erstrecken, das von politischer Mediation, wirtschaftlichen und politischen Sanktionen über militärische Zwangsmaßnahmen bis hin zu Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekten reicht. In seiner Agenda for Peace legte der damalige UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali im Frühjahr 1992 sein Augenmerk neben den drei Kernbereichen der internationalen Zusammenarbeit im Krisenmanagement, Preventive Diplomacy, Peacemaking, Peacekeeping auch auf den umfassenden Bereich des Post-conflict-peacebuilding und Peaceenforcement oder generell Enforcement Actions[25] und umreißt damit grob das Aufgabenfeld also solches.
Aus analytischen Gründen macht es durchaus Sinn, in der Begriffsarbeit die unterschiedlichen Kernpunkte und Abgrenzungen der jeweiligen Tools zueinander herauszustellen, zumal diese Einteilung nach wie vor als gängiger Maßstab von den Vereinten Nationen gebraucht wird, zuletzt 2007 in der als "Capstone Doctrine” bekannten Veröffentlichung des DPKO (Departement for Peace Keeping Operations) „United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines“.[26]
2.2.1. Preventive Diplomacy
Die Terminologie der Vereinten Nationen kennt präventive Diplomatie seit 1959, als der damaligen UN-Generalsekretär Dag Hammerskjöld in einem Bericht sein Augenmerk erstmals auf Prävention richtete. “Preventive diplomacy is defined here as the range of peaceful dispute resolution methods mentioned in Article 33 of the UN Charter when applied before a dispute crosses the threshold to armed conflict.”[27]
Das ursprüngliche Konzept beschränkte sich im Kontext der bipolaren Weltordnung allerdings mehr darauf, die Ausweitung von kleinen regionalen Konflikten zu verhindern und damit auch einer möglichen Eskalation zwischen den beiden Supermächten entgegenzuwirken. In diesem Umfeld kam auch dem Aufbau umfassender Frühwarnsysteme große Bedeutung zu.
Nach 1989 bot sich nicht nur die Möglichkeit zu einer Ausweitung des Konzepts, auch das Interesse war enorm angestiegen, da man verstärkt gewaltsame Konflikte, die im Zuge der Transformation der neu entstandenen Staaten der ehemaligen Sowjetunion sowie damit verbunden, hohe Kosten der Konfliktbearbeitung befürchtete.[28] Von der Euphorie durch erste Erfolge in Namibia und Kambodscha getragen, steht Boutros-Ghalis Agenda for Peace vor allem im Zeichen der Prävention, die er eingangs grob subsummiert: „Preventive diplomacy is action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of the latter when they occur“[29]
Preventive Diplomacy als Konzept gliedert sich in unterschiedliche Maßnahmenpakete:
1. Measures to build confidence: Dieser Bereich kann als „internationale Kooperation“ umschreiben werden, und bezieht sich auf den Austausch von Militärdelegationen, freier Informationsaustausch, die Überwachung regionaler Rüstungsübereinkünfte, sowie der Aufbau regionaler oder auch subregionaler Zentren zur Risikominimierung. Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die Einbeziehung von Regionalorganisationen gelegt: „I [Boutros-Ghali] ask all regional organizations to consider what further confidence-building measures might be applied in their areas and to inform the United Nations of the results. “[30]
2. Fact-finding: Effiziente Vorbeugung kann nur auf umfangreicher und rechtzeitiger Information beruhen. Dabei wird die Bandbreite dieser Information stark ausgeweitet: „ The information needed by the United Nations now must encompass economic and social trends as well as political developments that may lead to dangerous tensions.“[31]
3. Early warning: Darunter fallen die zahlreichen Instrumente im Bereich Monitoring der Vereinten Nationen, die potenzielle Risiken wie massive Bevölkerungsverschiebungen, drohende Hungersnöte, Naturkatastrophen oder auch die Verbreitung von Krankheiten, sowie jede andere mögliche Bedrohung für den Weltfrieden rechtzeitig zu erkennen.[32]
4. Preventive Deployment: Boutros-Ghali setzte einen gewagten Schritt, indem er präventive Intervention für möglich und in manchen Fällen notwendig erachtet. Dabei sollen je nach Anforderung eine Vielzahl an UN-Instrumenten, militärischer, polizeilicher und ziviler Art zum Einsatz kommen. Vorbeugende Einsätze sind insofern umstritten, da sie ein grundsätzliches Problem aufwerfen, jenes der Souveränität. „In these situations of internal crisis the United Nations will need to respect the sovereignty of the State.“[33] In der Agenda for Peace wird das Problem in der Art umschifft, als dass sie sich auf die Zustimmung der Konfliktparteien stützen: „Bei einer zwischenstaatlichen Krisensituation darf eine Präsenz beiderseits der Grenze nur dann erfolgen, wenn beide Staaten ihre Zustimmung erteilen. “[34] Auch innerstaatliche Konflikte bedürfen der Zustimmung aller involvierten Parteien, wodurch die Grundsätze der Vereinten Nationen, insbesondere jener der Souveränität unangetastet ist, wohl aber die Anwendbarkeit dieses Instruments beschränkt bleibt: „Clearly the United Nations cannot impose ist preventive and peacemaking services on Member States who do not want them“[35]
5. Entmilitarisierte Zonen: Die Errichtung dieser Zonen ist unter denselben Vorgaben wie ein vorbeugender Einsatz möglich und erfolgt auch meist in Zusammenhang mit diesem.
2.2.2. Peacemaking
Entsprechend des Verständnisses der Vereinten Nationen entspricht die Kategorie des Peacemakings im Großen und Ganzen den Instrumenten der friedlichen Streitbeilegung entsprechend Kapitel VI der UN Charter, mit dem Ziel einer friedlichen Streitbeilegung zwischen den Konfliktparteien, bzw. einen einmal erreichten Frieden zu stärken und zu erhalten. Die Wahl der Mittel dafür obliegt dabei ausschließlich den betroffenen Parteien, Empfehlungen und Verfahrensvorschläge können allerdings von Außenstehenden, insbesondere dem Sicherheitsrat, eingebracht werden. Besonderes hervorgehoben wird dabei auch die Bedeutung von regionalen Bündnissen und Organisationen.[36]
Bei Vermittlungsversuchen solcher Art greifen internationale Organisationen häufig auf das Prestige und den Ruf sogenannter „Elder Statesman“ zurück, die ihre Reputation zur Förderung von Friedensprozessen einsetzen. Innerhalb der Vereinten Nationen ist es der Generalsekretär selbst, der diese good services anbietet. Neben der traditionellen Mediation durch die Beauftragten internationaler Organisationen fallen jedoch auch andere Maßnahmen und Institutionen unter diesen Begriff. Besondere Bedeutung kommt im Zusammenhang mit dem Peacemaking auch der Schlichtungs- und Streitbeilegungsfunktion des internationalen Gerichtshofes in Den Hague zu. Begelitende Hilfsmaßnahmen zielen auf die humanitären Konsequenzen eines Konfliktes ab und begünstigen solcherart eine Deeskalation. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass damit im Kontext des Konfliktmanagements humanitäre Hilfe als solches gemeint ist. Boutros-Ghali hebt als Beispiel Hilfe für Vertriebene als besonders wichtig hervor: „Assistance to displaced persons within a society is essential to a solution“[37]
Militärische Zwangsmaßnahmen und wirtschaftliche Sanktionen, sowie die Etablierung von peace enforcement units, sind weitere Punkte, die in der Agenda unter der Rubrik des Peacemaking behandelt werden, sind aber unter Chapter VII der Charta anzusiedeln und grundsätzlich als enforcement measures zu betrachten.[38] In der weiteren Entwicklung des Konfliktmangagementinstrumentariums der UN wurde, beginnend mit dem „Supplement der Agenda for Peace“ das Mandat in Richtung Enforcement immer weiter ausgebaut.
2.2.3. Peacekeeping
„Peace-keeping is a technique that expands the possibilities for both the prevention of conflict and the making of peace.“[39] Dies wird üblicherweise durch eine militärische Präsenz im betreffenden Konfliktgebiet erreicht, die Konfliktparteien trennen und weitere Kampfhandlungen damit unterbinden soll.
„The standard definition of peacekeeping refers to a United Nations presence in the field (normally involving civilian and military personnel) that, with the consent of the conflicting parties, implements or monitors arrangements relating to the control of conflicts and their resolution, or ensures the safe delivery of humanitarian relief.”[40]
Oft haben Peacekeeping Operationen allerdings einen anderen Hintergrund. Sie werden oft beschlossen und eingesetzt, um einen vereinbarten Friedensprozess durchzusetzen. Solche Operationen haben als multifunktionale Peacekeeping Operationen zur Erfüllung ihres Mandats ein wesentlich weiteres Aufgabenspektrum zu erfüllen.[41]
2.2.4. Peacebuilding
Von Boutros-Ghali in der Agenda erstmalig hervorgehoben und von seinem Nachfolger Kofi Annan weiterentwickelt, wurde das Instrument des Peacebuildings in einer Reihe von Resolutionen unterstützt und zu einer umfassenden Architektur ausgebaut.[42] Generell kann man Peacebuilding als Friedenskonsolidierung nach einem Konflikt definieren. Das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, vor allem hinsichtlich der Frage wie weit in die Souveränität des betreffenden Landes eingegriffen wird, beginnend von einfacher Beratung bis hin zu kompletten Übergangsregierungen, die die staatliche Autorität als solche vorübergehend ganz ersetzen.[43]
2.2.5. Peaceenforcement
Im Supplement der Agenda unter enforcement actions subsummiert, versteht sich darunter “a range of instruments for controlling and resolving conflicts between and within States”[44] Diese Einsätze sollen in der Lage sein, den Willen der Staatengemeinschaft durch Zwangsmaßnahmen, sowohl militärischer als auch ziviler Natur, durchzusetzen.
So betrachtet wäre Peacekeeping nur eines von mehreren Instrumenten der Vereinten Nationen im Bereich der Friedensschaffung und -erhaltung. Entwicklungen, insbesondere nach dem Ende des Kalten Krieges haben Peacekeeping aber in einen breiteren Kontext gestellt, dem sinnvollerweise ein so enges Verständnis nicht mehr gerecht wird. Vielmehr werden mittlerweile viele der genannten Instrumente aus der Agenda for Peace unter dem Label von Peacekeeping subsummiert, was dann in Bezeichnungen wie wider peacekeeping, mulitidemensional bzw. integrated approach zum Ausdruck kommt.
Faktisch ist eine klare Trennung der einzelnen Instrumente der Agenda for Peace kaum möglich, da sie in der Regel sehr stark ineinandergreifen. Peacebuilding wird kaum ohne eine gewisse Peacekeeping Kapazität möglich sein, ebenso wenig wäre Peaceenforcement sinnvoll und nachhaltig ohne begleitende diplomatische Bemühungen im Rahmen des Peacemakings.
2.3. Peacekeeping Generationen
Im internationalen Kontext ist es zwischen Experten, Nationalstaaten, NGOs, und internationalen Organisationen alles andere als unumstritten, was mit Peace Operations gemeint ist, oder wie genau die Unterschiede zwischen den Begriffen Peacemaking, Peacebuilding und Peacekeeping zu definieren sind.
Eine Definition von Peace Operations gestaltet sich auch deshalb schwierig, weil eine Vielzahl an Begriffen und Kategorisierungen, wie Peace Operations, Peacekeeping, Peace Support Operations, Peacebuilding Operations etc. simultan verwendet wird, die allesamt allerdings weniger Klarheit schaffen, als vielmehr Verwirrung stiften. Zum andern ist es auch nicht hilfreich, dass keine der oben genannten Begriffe in der UN Charter niedergeschrieben ist.
Das Konzept des Peacekeepings hat sich, seit seiner „Erfindung“ 1956 bis zum heutigen Zeitpunkt nicht nur theoretisch in seiner Perzeption sondern auch praktisch in seiner Anwendung stark gewandelt.
Die erste Peacekeeping Operation war die United Nations Emergency Force (UNEF), die während der Suezkrise 1956 eingesetzt wurde und mithalf, „to define the four principles of traditional peacekeeping: consent, impartiality, neutrality and use of force only in self- defense“[45] Das Aufgabenfeld umfasste die Trennung verfeindeter Streitparteien, Monitoring und Überwachung von Waffenstillständen, die Sicherung von demilitarisierten Zonen oder sogenannten safe areas, die militärische Sicherung und Unterstützung humanitärer Operationen.
In ihrem Aufgabenspektrum bedient sich das UN-Peacekeeping Instrumenten sowohl nach Chapter VI als auch fallweise Chapter VII, sodass sie vom damaligen UN-Generalsekretär Hammerskjöld als „Einsatz nach Kapitel 6 1/2“[46] bezeichnet wurden. In den vergangenen Jahren wurden die zuvor angesprochenen Grundsätze zunehmend in Frage gestellt, und die Einsätze mit sogenannten robusten Mandaten ausgestattet und zu multifunktionalen PK- Operationen umgestaltet. Der Aufgabenbereich hat sich dadurch massiv erweitert, und umfasst neben dem militärischen Bereich der Unterstützung auch zivile Aufgaben die eher in den Bereich des Peacebuilding aber auch der Prävention fallen würden.
Unabhängig von jeglichen Kategorisierungsversuchen ist es Fakt, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Peacekeeping Operationen parallel nebeneinander bestehen, die ihrerseits über unterschiedliche Mandate verfügen, unterschiedliche personelle Zusammensetzungen aufweisen, nicht vergleichbare Schwerpunktsetzungen entweder im militärischen oder politisch-zivilgesellschaftlichen Bereich aufweisen und somit vollkommen unterschiedliche Aufgabengebiete abdecken. Immer wieder wird darauf Bezug genommen, „dass sich die Friedensoperationen seit 1948 von der („klassischen“) ersten über die (erweiterte) zweite bis hin zur (robusten) dritten „ Generation “ weiter entwickelt haben, (...) “[47]. Ich werde weiter unten erklären, warum ich mit dieser chronologischen Sichtweise nicht übereinstimme, halte es aber durch aus für zweckmäßig, diese Entwicklung überblicksmäßig nachzuvollziehen:
2.3.1. Erste Generation: Traditionelles (klassisches) Peacekeeping
In die erste Kategorie fällt das klassische Peacekeeping, dass nicht nur das Monitoring eines Waffenstillstands umfasst, sondern durch ihre (militärische) Präsenz es den verfeindeten Parteien ermöglicht, „ to pull back to a safe distance, where an atmosphere conducive to negotiations may be created.”[48] Grundsätzlich geht es bei dieser Art von Operation darum das geeignete Umfeld zu schaffen, um (prinzipiell) verhandlungswilligen politischen Führern Zeit und Möglichkeit zur Lösung des Konfliktes zu bieten, indem mit den Peacekeepern eine Art Puffer zwischen den Konfliktparteien installiert wird. „Traditional peacekeeping operations referred to the deployment of a United Nations presence in the field, with the consent of all the parties concerned, as a confidence building measure to monitor a truce while diplomats negotiated a comprehensive peace.“[49] Essentiell dabei ist das Einverständnis der Konfliktpartien, eine Friedensmission der Vereinten Nationen zuzulassen. „Drawing upon judical settlement, mediation, and other forms of negotiation, UN peacemaking initiatives would seek to persuade parties to arrive at a peaceful settlement of their differences. “[50] Daraus ergibt sich auch die rechtliche Nähe zu den Maßnahmen der friedlichen Streitbeilegung nach Chapter VI. Als Paradebeispiel für derartige Friedensmissionen gilt der eingangs schon erwähnte Einsatz im ägyptisch-israelischen Grenzkonflikt der UNEF 1956. Allgemein können für die Peacekeeper der traditionellen ersten Generation einige grundlegende Aufgaben unterschieden werden:[51] Diese Missionen weisen oft nur sehr kleine, nur leicht bewaffnete Kontingente auf, die zu großen Teilen von neutralen Staaten wie unter anderem auch Österreich[52] entsendet werden. Das Mandat des Sicherheitsrates ist klar definiert und baut auf dem Konsens der betroffenen Konfliktparteien auf. Die Hauptaufgabe der Truppen liegt in der Überwachung bestehender Waffenstillstände und daher halten sie sich strikt an die Neutralität und setzen Gewalt lediglich zu Selbstverteidigung ein.
Diesem klassischen Muster entsprechen unter anderem die Missionen in Uganda und Rwanda von 1993-1994 (UNOMUR -UN Observer Mission Uganda-Rwanda). Eine in jeder Hinsicht klassische Peacekeeping Mission stellt die 1944 im Grenzgebiet zwischen Libyen und Tschad stationierte UNASOG (UN Aouzou Strip Observer Group) dar.
Viele Missionen der ersten Generation wurden jedoch ausgeweitete und können auch schon zur zweiten Generation gezählt werden. So half Beispiel die zweite UN Angola Verification Mission (UNAVEM II) neben ihrem Hauptaufgabengebiet, der Überwachung des Friedensabkommens zwischen Regierung und der Rebellenorganisation UNITA auch bei der Durchführung und Überwachung von Wahlen. Auch im Fall von MINURSO (UN Mission for the Referendum in Western Sahara), blieb die UN nach der Durchführung als stabilisierender Faktor im Land. Beobachter Missionen wie UNOMIL (UN Observer Mission in Liberia) weiteten ihr Mandat aus und ermöglichten nicht nur humanitäre Hilfsmaßnahmen, sondern halfen ebenfalls auch bei der Durchführung von Wahlen.
Der Fokus auf reines Monitoring führte in der Vergangenheit[53] öfters dazu, dass „“Theprice of first generation peacekeeping, (...) was sometimes paid in conflicts delayed rather than resolved.“[54] Das, und der Umstand, dass schwindender Konsens bei den beteiligten Fraktionen Peacekeeping Operationen einem hohen Risiko aussetzen, führen dazu, dass sich das Peacekeeping von einer reinen Monitoring Funktion weg hin zu einem breiter gefassten und multidimensionalen Zugang hinbewegt, der die Kooperation der Beteiligten stärken und weiter ausbauen sollte.
2.3.2. Zweite Generation: Multidimensionales (erweitertes) Peacekeeping
Multi-dimensionales Peacekeeping als zweite Kategorie konnte sich erst im geänderten Umfeld mit dem Ende der bipolaren Weltordnung etablieren. „The emphasis, the UN gave to a broader definition of peace operations towards peace-building is highlighted in the UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali’s Agenda for Peace, launched in 1992. Postconflict peace-building became an instrument of strategic importance of modern multidimensionalpeace operations”[55]
Als eine der ersten Missionen, die man als multi-dimensional bezeichnen kann, gilt die Operation in Namibia (UNTAG)[56] 1989/1990.
“In providing a wider range of civilian experts to serve in such areas as human rights, local security, elections, and the re-integration of combatants to civilian life, the United Nations has been able to assist in the strengthening of national institutions at their very core.”[57] Viele dieser Operationen wurden im Umfeld einer Post-conflict Situation etabliert, wie etwa die Missionen in Kambodscha (UNTAC), El Salvador (ONUSAL) und Mozambique (ONUMOZ). Diese Missionen zeichnen sich durch eine komplexere Rolle der UNPeacekeeper aus, welche über eine traditionelle militärische Funktion hinausgeht, und aktiv Einflussnahme in politische und zivile Prozesse beinhaltet. Im Gegensatz zum knappen Zeithorizont dieser Übergangslösungen der ersten Kategorie wird hier ein mittel- bis langfristiger Lösungsansatz verfolgt, der den ökonomischen sozialen und politischen Grundstein für einen langfristigen und nachhaltigen Frieden schaffen soll.
“The concept of peace-building as the construction of a new environment (...) to deal with underlying economic, social, cultural and humanitarian problems can place an achieved peace on a durable foundation.”[58]
Das beinhaltet unter anderem folgende zentrale Punkte: “Supporting the delivery of humanitarian assistance, (...) Supervising and conducting elections, (...) Assisting withpost- conflict recovery and rehabilitation, (. ) Setting up a transitional administration of a territory as it moves towards independence, (. ) Assisting with the disarmament, demobilization and reintegration (DDR) offormer combatants“[59]
Diese nicht-militärischen Komponenten, die das traditionelle Aufgabenspektrum ergänzen, sind das wesentliche Merkmal dieser Generation an Friedensoperationen. Die Überwachung der Parteien bei der Einhaltung der Menschenrechte nimmt eine ganz zentrale Position ein. DDR (Disarmament Demobilisation Reintegration) und Demining Programme, begleiten die gesamte Mission und sollen eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität ermöglichen und „to rebuild the capabilities of a society to resolce conflict without fighting“[60]. Dabei spielt der Wiederaufbau staatlicher Strukturen wie Verwaltungs- und Polizeiapparat eine wichtige Rolle, ebenso wie der Aufbau neuer Streitkräfte.
Wie die erste, baut auch die zweite Generation auf der Zustimmung und dem Einverständnis der Konfliktparteien auf.[61] Dieses Einverständnis ist allerdings fragil und kann im Verlauf einer Friedensmission dahinschwinden, wie die UN beispielsweise in Angola lernen musste als die Rebellenorganisation UNITA die allgemein als fair eingestufte Wahl nicht zu Kenntnis genommen und ihre Kampfhandlungen wieder aufgenommen hatte.
Zudem ist es in Post-conflict Situationen, die oft von ethnischen Spannungen, fortschreitendem Staatszerfall oder auch dem vollkommenen Fehlen staatlicher Autorität gekennzeichnet sind, oft schwierig, einen konsensualen Entschluss über die Etablierung von multilateralen Truppenkontingenten zu erzielen. Daraus resultiert ein potenzielles Risiko für die Friedenstruppen, nur als ein weiterer Akteur in den Konflikt hineingezogen und demnach auch selbst Opfer von neu entflammten Gewaltausbrüchen zu werden. Dies war unter anderem auch bei der US-dominierten Mission in Somalia (UNOSOM II) der Fall. Post-conflict-peacebuilding, wie in Boutros-Ghalis Agenda for Peace beschrieben, ist unter solchen Umständen schwer durchführbar und stellt die Vereinten Nationen vor das Problem, entweder ihr Mandat nicht erfüllen zu können und sich demnach vom Einsatzraum zurückzuziehen, oder aber das Mandat in Richtung „Peaceenforcement“ auszuweiten. Letzteres hat Mitte der 1990er Jahre zur dritten Generation von UN-Friedensmissionen geführt.
2.3.3. Dritte Generation: Peaceenforcement (robustes Peacekeeping)
Die Agenda for Peace hat den Zuständigkeitsbereich der Vereinten Nationen in völkerrechtlicher Hinsicht stark erweitert. Peacemaking, und explizit darin zentral Enforcement, setzt sich über den bis dahin gültigen Grundsatz des Konsenses hinweg. “The defining characteristic of ,third generation‘ operations is the lack of consent by one or more of the parties to some or all of the UN mandate.”[62] Das Supplement zur Agenda for Peace spricht demnach auch von multidimensional robust peace support operations, die explizit auch die Anwendung von militärischer Gewalt beinhalten kann.
Kennzeichnend dafür ist, dass die rechtliche Basis für Peacekeeping dieser Art Mandate nach Kapitel VII der UN-Charta darstellen. Insbesondere Kapitel VII Artikel 42 der UN-Charta ermächtigt den Sicherheitsrat, „to take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security“[63] und verpflichtet nach Kapitel VII Artikel 43 die Mitgliedsstaaten, “to make available to the Security Council, on its call, ... armed forces assistance and facilities.[64] ”
Damit sollen Peacekeeper vor Ort in der Lage sein, aufgrund des weiten Mandats rasch auf die Situation und mögliche Eskalationsstufen reagieren zu können, ohne nochmals einen zeitintensiven Verhandlungsprozess innerhalb des Sicherheitsrats durchlaufen zu müssen.
Auf diese Weise wird einer Friedensoperation sehr hohe Flexibilität eingeräumt, um, wie der Brahimi Report im Jahr 2000 hervorhebt, den Peacekeepern zu ermöglichen, „to carry out their mandates professionally and successfully and be capable of defending themselves, other mission components and the mission’s mandate, with robust rules of engagement, against those who renege on their commitments to a peace accord or otherwise seek to undermine it by violence“.[65] Ein wesentlicher Bestandteil dieser Mandate bezieht sich daher auf den Selbstschutz der entsendeten Kontingente, UN-Personals und UN-Einrichtungen, ebenso wie der Schutz humanitärer Transporte oder installierten safe areas[66].
Ebenso wichtig wird im Zusammenhang mit dem Post-conflict-peacebuidling die Infrastruktur der jeweiligen Region. Neben der Absicherung der Bevölkerung wird daher auch der Schutz von zivilen Einrichtungen wie Staudämmen, Kraftwerken, Flughäfen und anderen Versorgungseinrichtungen zu einer Hauptaufgabe.[67]
Die militärischen Maßnahmen gegen diese sogenannte „Spoilers“, die bereits geschlossene Friedensabkommen brechen, oder Friedensprozesse bewusst sabotieren, müssen verhältnismäßig sein, was allerdings von Fall zu Fall jeweils neu definiert werden muss.
Die wichtigste Unterscheidung zu den zuvor genannten Generationen liegt darin, dass hier ein Konsens zwischen Konfliktparteien über eine Intervention von außen nicht gegeben sein muss.
Der UN-Einsatz in Somalia im Rahmen von UNOSOM II ist einer der ersten robusten Einsätze der Blauhelme. Resolution S/RES/814 (1993) klassifizierte die Situation in Somalia als Bedrohung für den Weltfrieden und legte in ihrem Mandat auch das Aufgabenspektrum fest.[68] Neben „monitoring that all factions (...) respect (...) agreements,(...) preventing any resumption of violence ” lag ein wesentlicher Focus auf “seizing small arms, securing all ports, airports and lines for the delivery of humanitarian assistance, protecting the personnel, installations and equipment of the United nations and its agencies, ICRC as well as NGOs”[69], der durch einen weiteren Passus verstärkt wurde: “(...) if necessary, taking appropriate action”[70]. Die Mission war geplant worden, “toprovide humanitarian and other assistance to the people of Somalia in rehabilitating their political institutions and economy and promoting political settlement and national reconciliation.”[71]
Enforcement Einsätze fanden aber auch im Kosovo statt, ebenso wie in Haiti, Kongo, Ost Timor etc., teilweise durch die UN geführt, teilweise von spontanen Koalitionen der Willigen. ”It was the missions in Bosnia, Somalia, and Rwanda that caused those who attended the 50th Anniversary to say the UN could not do peace enforcement.(...) In Bosnia, Haiti, Kosovo, East Timor, and most recently Afghanistan, coalitions of the willing, usually led by a single nation, came forward to ensure peace in these more complex operations.”[72]
2.4. Neuorientierung an Peacekeeping Zielsetzungen
Mark Malan hat den Bedarf nach einer neuen ,Generation‘ des Peacekeeping geortet. „The seemingly ineffective nature of 'third generation'peacekeeping has led to a growing number of calls for a reinvention of the concept of UN peacekeeping (...) the continuing process of reflection and analysis on this question will result in a consensus among [UN] member states on what peacekeeping is and is not.[73]
Damit wird nicht nur die Frage angesprochen, was Peacekeeping idealerweise tun soll und realistischerweise tun kann, sondern auch welche Rolle die Akteure, seien es die UN, die Mitgliedsstaaten, aber auch regionale Bündnisse dabei spielen wollen.
Die meisten Konzepte, Kategorisierungen und Definitionen basieren auf der Nennung, Beschreibung und Auflistung der eingesetzten Mittel oder Aufgaben und sind in den meisten Fällen auf eine UN-zentrierte Darstellung bezogen, wie ich bis jetzt zu zeigen versucht habe. Die letzten beiden Jahrzehnte haben jedoch gezeigt, dass Friedensmissionen auch außerhalb des Rahmens der Vereinten Nationen stattfinden und Erfolg haben können.
Zudem wird die oben angeführte Kategorisierung der Realität nicht gerecht, da sie eine chronologische Abfolge von Entwicklungen impliziert, die nicht den Tatsachen entspricht. Die unterschiedlichen Mandate und Aufgabengebiete der verschiedenen Generationen von Friedensmissionen reflektieren (im Idealfall) die jeweiligen Anforderungen im Einsatzraum. Es ist daher nur logisch, dass sie vielmehr parallel nebeneinander bestehen. Wo es in einem Fall genügen mag, lediglich Militärbeobachter zu entsenden, mag gleichzeitig andernorts eine massive Intervention von Nöten sein. So umfasste das Ende 2010 ausgelaufene Mandat der MINURCAT lediglich den Schutz der Zivilbevölkerung und keinerlei politische Aufgaben, während hingegen die in unmittelbarer Nähe operierende UNAMID eine multidimensionale Mission darstellt.
Es wird daher auch immer wieder hervorgehoben, dass diese konzeptionellen Unterscheidungen unscharf von einander abzugrenzen sind. Dabei stellt sich aber die Frage, ob es an sich sinnvoll ist, Peacekeeping durch die Schablone von Peacekeeping-Generationen zu untersuchen. So wurden die Missionen in Somalia sowohl als Beobachtermission (UNOSOM I), als humanitäre Mission ebenso wie als Enforcement Mission (UNOSOM II) bezeichnet und hätte damit eigentlich alle drei Generationen „absolviert“.
Rahmenbedingungen allein können kein Kriterium für eine adäquate Zuordnung sein, da sie sich in der Realität sprichwörtlich jede Sekunde ändern können und sich dementsprechend auch ihre Mandate ändern (können), und so Friedensmissionen im Laufe ihrer Arbeit wohl jede Generation einmal darstellen bzw. wieder darstellen können.
So ist es auch nicht unüblich, dass eine Mission, die anfangs einer bestimmten Generation zugeordnet werden kann, im Laufe ihres Einsatzes ihren Aufgabenbereich der Situation angemessen entweder einschränkt, oder bei aufkeimenden Eskalationen weiter ausdehnt.
Die eingesetzten Mittel passen sich den gegebenen Bedingungen an und ändern sich mit diesen, wohingegen das Ziel der Mission sich nicht notwendigerweise ebenfalls wandelt. Es erscheint mir daher sinnvoller, vom Ziel, welches eine Friedensmission zu erreichen hofft, auszugehen. Dabei kann das Ziel zum Beispiel lediglich das Trennen von Konfliktparteien, die Durchsetzung eines Beschlusses des Sicherheitsrates durch Zwangsmassnahmen, oder sogar der Aufbau demokratischer Strukturen innerhalb eines Staates sein.
Ich schlage daher vor, in Anlehnung an Bellamy und Williams,[74] Friedensmissionen nicht mehr ausgehend von den eingesetzten Mitteln, politischen Rahmenbedingungen oder historischen Entwicklungssprüngen zu analysieren, als vielmehr den Zweck, bzw. das Ziel das sie erreichen sollen, als Bezugspunkt zu nehmen.
Demnach kann man sieben Typen von Friedensmissionen unterscheiden: Preventive Deployments, Traditional Peacekeeping, Wider Peacekeeping, Peaceenfor cement, Assisting Transitions, Transitional Administrations, und Peace Support Operations;
- Preventive Deployments setzen in der Regel das Einverständnis des jeweiligen Landes voraus und stellen eine präventive Maßnahme dar, gewaltsamen Eskalationen vorzubeugen
- Traditional Peacekeeping: entspricht im Wesentlichen dem klassischen Verständnis von Peacekeeping wie es bereits in der Agenda for Peace genannt wird, und soll in erster Linie eine Trennung der Konfliktparteien und damit politischen Dialog ermöglichen.
[...]
[1] Charter of the United Nations, preamble, http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml. Download 27.04.2011;
[2] Yamashita, Hikaru (2009): “Peace Operations 2010 and the Future of UN Peacekeeping: The issue of partnership and its implications”, working paper presented at the ISA conference, New York, Seite 11;
[3] Vgl. Weber, Mathias (1997): „Der UNO-Einsatz in Somalia - Die Problematik einer ,humanitären Intervention’“, M.-W.-Verlag, Frankfurt, Seite 40 ff;
[4] Erstmals erwähnt und ausformuliert wird die Idee im “Humand Development Report 1994” und wurde in weiterer Folge schrittweise von der internationalen Staatengemeinschaft übernommen, so etwa auch von der EU im sogenannten „Barcelona Report“.
[5] In der Zeitspanne von 1989 bis 1993 autorisierte der Sicherheitsrat zehn UN Peacekeeping Missionen in Afrika, innerhalb der nächsten fünf Jahre sollten es dann nur noch fünf sein, sodass die Anzahl der Friedensmissionen von sieben im Jahr 1993 auf insgesamt drei im Jahr 1999 sank. Viel deutlicher wird dieser Rückgang, betrachtet man die Zahlen der eingesetzten Blauhelme: 1993 waren noch 75.000 Blauhelme in Friedensmissionen der Vereinten Nationen im Einsatz, Mitte 1999 waren es weniger als 12.000. Auf dem Afrikanischen Kontinent fiel diese Reduktion besonders drastisch aus, von 40.000 im Jahr 1993 auf nicht einmal 1.600 im Juni 1999. Zahlen genommen aus: Bergman, Eric G./Sams, Katie E. (2000): Keeping the Peace in Africa, http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art129.pdf, Download 31.05.2010;
[6] Vgl. Tull, Denis M. (2010): „Die Peacekeeping-Krise der Vereinten Nationen“, Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin, Seite 7 ff;
[7] Popper, Karl R. (1979): „Objective knowledge: an evolutionary approach“, Oxford: Oxford University Press, Seite 80;
[8] Bellamy, Alex J./ Williams, Paul D. (2010): “Understanding Peacekeeping”, Polity Press Cambridge, Seite 20;
[9] Ebd., Seite 23;
[10] Vgl. Bellamy, Alex J./ Williams, Paul D. (2010): “Understanding Peacekeeping”, Polity Press Cambridge, Seite 24;
[11] Ebd.
[12] Ebd.
[13] A/59/2005 (2005), 21. Marz 2005, „In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All“, § 148,, http://www.un.org/largerfreedom/chap4.htm, Download 14.11.2010;
[14] Bellamy, Alex J./ Williams, Paul D. (2010): Understanding Peacekeeping, Polity Press Cambridge, Seite 25;
[15] Ebd.
[16] Vgl. Paris, Roland (2003): Peacekeeping and the Constraints of Global Culture“, European Journal of International Relations, 9(3) Seite 441-473;
[17] Ebd. Seite 451;
[18] Vgl. Kaldor, Mary (2006): “New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era”, Polity Press, Cambridge, Seite 132;
[19] Vgl. Bellamy, Alex J./ Williams, Paul D. (2010): “Understanding Peacekeeping”, Polity Press Cambridge,
[20] Seite 28;
[21] Vgl. S/RES/1325 (2000), 31. Oktober 2000, http://www.un.org/events/res 1325e.pdf.. Download 13.01.2011;
[22] Gruppe Friedensentwicklung (2007): „Responsibility to Protect - Vom Konzept zur angedandten friedens- und sicherheitspolitischen Doktrin?“, http://www.frient.de/downloads/FriEnt Briefing%200607 R2P.pdf. Download 02.07.2010;
[23] Ebd.
[24] Ebd.
[25] Vgl. A/47/277-S/24111 (1992), 17. Juni 1992, Agenda for Peace: http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html, Download 01.12.2009;
[26] Vgl. DPKO (2008): United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, New York, http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Capstone Doctrine ENG.pdf, Download 19.12.2009;
[27] Igarashi, Masahiro (2001): Preventive Diplomacy and Conflict Resolution, http://www.unu.edu/hq/Japanese/gs-i/gs2001i/kanazawa1/Lec3-full-e.pdf. Download 08.03.2010;
[28] Vgl. Häcker, Eleonore T. (2003): „Präventive Diplomatie - Vom re-aktiven zum pro-aktiven Engagement, http://www.dissertationen.unizh.ch/2004/guzy/diss.pdf, Download 13.02.2010;
[29] A/47/277-S/24111 (1992), 17. Juni 1992, Agenda for Peace, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html. Download 01.12.2009, Absatz 20;
[30] Ebd. Absatz 24
[31] Ebd. Absatz 25
[32] Vgl. Ebd. Absatz 26
[33] Vgl. ebd. Absatz 30
[34] Bukovec, Nicholas (2001): „Politisches, ziviles und militärisches Krisenmanagment der OSZE und der Partnerschaft für den Frieden im Vergleich“, Universität Wien, Seite 9;
[35] A/50/60-S/1995/1 (1995), 03. Jänner 1995, Supplement to the Agenda for Peace, http://www.un.org/Docs/SG/agsupp.html#INSTRUMENT; Download 23.06.2010, Absatz 28;
[36] Vgl. Charter oft he United Nations, Chapter VI, http://www.un.org/en/documents/charter/, Download 20.06.2010, Article 33;
[37] A/47/277-S/24111 (1992), 17. Juni 1992, Agenda for Peace: http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html. Download 01.12.2009, Absatz, Abs 40;
[38] Vgl. Bukovec, Nicholas (2001): „Politisches, ziviles und militärisches Krisenmanagment der OSZE und der Partnerschaft für den Frieden im Vergleich“, Universität Wien, Seite 11;
[39] A/47/277-S/24111 (1992), 17. Juni 1992, Agenda for Peace: http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html, Download 04.02.2010, Absatz, Abs 20;
[40] United Nations Department for Peacekeeping Operations www.un.org/Depts/dpko/dpko/field/wpkF.htm, Download 25.03.2010;
[41] Vgl. Bukovec, Nicholas (2001): „Politisches, ziviles und militärisches Krisenmanagment der OSZE und der Partnerschaft für den Frieden im Vergleich“, Universität Wien, Seite 12;
[42] Vgl. A/RES/65/7 (2010), 23 November 2010, Review of the United Nations Peacebuilding Architecture, http://www.un.org/ga/search/view doc.asp?svmbol=A/RES/65/7&Lang=E. Download 14.03.2011;
[43] Vgl. Schneckener, Ulrich (2007): „Frieden bauen: - Peacebuilding and Peacebuilder” http://www■bpb■de/themen/B0OSKM.0.Frieden bauen%3A Peacebuilding und Peacebuilder.html, Download. 19.03.2011;
[44] A/50/60-S/1995/1 (1995), 03. Jänner 1995, Supplement to the Agenda for Peace, http://www.un.org/Docs/SG/agsupp.html#INSTRUMENT: Download 23.06.2010, Absatz 23;
[45] Doyle, Michael W./ Samanis, Nicholas (2006): “Making war and building peace - United Nations peace Operations”, Princeton University Press, Seite 12;
[46] Eisele, Manfred (2000): Die Vereinten Nationen und das internationale Krisenmanagment, Josef Knecht Verlag, Frankfurt am Main, Seite 140;
[47] Schmidl, Erwin A: “Der ‘Brahimi-Report’ und die Zukunft der UN-Friedensoperationen“ http://www.bmlv.gv.at/pdf pool/publikationen/03 jb01 08 sch.pdf, Download 23.08.2010;
[48] Ebd.
[49] Doyle, Michael W./ Sambanis Nicholas (2006): “Making war and building peace - United Nations Peace Operations”, Princeton University Press, Seite 13;
[50] Ebd. Seite 13;
[51] Vgl, Schweiger, Martin (2002): Die UN-Friedensmissionen - Fallbeispiele in Afrika, Hamburg, Diplomica GmbH, Seite 28
[52] Vgl. u.a. die österreichische Beteiligung bei UNDOF (seit 1974), UNFICYP (1964- 2001);
[53] Hier wäre zum Beispiel die 1974 beginnende und bis zur Fertigstellung dieser Arbeit andauernde Zypernoperation UNFICYP zu nennen, siehe aber auch UNDOF (Syrien), UNIKOM (Kuwait), etc; deren Passivität einer Konfliktaufarbeitung eherimWeg stand, statt sie zu begünstigen.
[54] Doyle, Michael W., Sambanis Nicholas (2006): “Making war and building peace - United Nations peace Operations”, Princeton University Press, Seite 14;
[55] Fritsch, Alexander (2007): „The remaining security gap - peacebuilding in Sierra Leone“, GRIN - Verlag, Seite 5;
[56] Die UNTAG (United Nations Transition Assistance Group) gilt durch ihr weitreichendes Mandat auch allgemein als erste Peacebuilding Mission und wird nicht zuletzt auch wegen ihres Erfolges für nachfolgende Peacebuilding-Einsätze zum Bezugspunkt.
[57] United Nations Department for Peacekeeping Operations (UNDPKO), http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/field/body pkeep.htm, Download 03.02.2010;
[58] A/47/277-S/24111 (1992), 17.Juni 1992, Agenda for Peace, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html. Download 04.02.2010, Absatz, Abs 57;
[59] Vgl. Handbook of United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations, http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/Pbps/librarv/Handbook%20on%20UN%20PKOs.pdf, Download 20.12.2009;
[60] Kühne, Winrich (2001): “From Peacekeeping to Post-conflict Peace-building”, in “Peace-building - a field guide”, Lynne Rienner Publishers, Seite 383;
[61] Vgl, Schweiger, Martin (2002): „Die UN-Friedensmissionen - Fallbeispiele in Afrika“, Hamburg, Diplomica GmbH, Seite 30;
[62] Doyle, Michael W., Sambanis Nicholas (2006): “Making war and building peace - United Nations peace Operations”, Princeton University Press, Seite 15;
[63] Charter of the United Nations, Kapitel VII, Artikel 42, http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml. Download 14.12.2010;
[64] Ebd. Artikel 43;
[65] Report of the Panel on United Nations Peace Operations - Summary of Recommendations, Ziffer 3. www.un.org/peace/reports/peace operations/docs/recommend.htm. Download 21.08.2010;
[66] Das Massaker von Srebrenica 1995, bei dem etwa 8000 Bosniaken durch bosnischen Serben unter der Führung des Kriegsverbrechers Ratko Mladic ums Leben kamen, hat in diesem Zusammenhang maßgeblich zu diesen umfassenden Mandaten beigetragen, da es den eingeschränkten Nutzen von sogenannten Schutzzonen offenbart, wenn Peacekeeper vor Ort nicht in der Lage sind, diesen Schutz auch gegen einen möglichen Angriff auf die Zone aufrecht zu erhalten.
[67] Vgl, Schweiger, Martin (2002): „Die UN-Friedensmissionen - Fallbeispiele in Afrika“, Hamburg, Diplomica GmbH, Seite 31;
[68] Mandat der UNOSOM II, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2mandate.html. Download 22.03.2010;
[69] Ebd., Download 22.03.2010;
[70] Ebd., Download 22.03.2010;
[71] Ebd., Download 22.03.2010;
[72] Oliver, George F.: „The Other Side of Peacekeeping - Peace Enforcement and Who should do it?”, in Journal of international Peacekeeping, Vol 8, Seite 104, http://www.internationalpeacekeeping.org/pdf/04.pdf· Download 02.03.2011;
[73] Malan, Mark: “Peacekeeping in the New Millennium - Towards ‘Fourth Generation’ Peace Operations”, in African Security Review Vol 7, No. 3, 1998, http://www.issafrica.org/Pubs/ASR/7No3/Malan.html. Download 03.03.2010;0
[74] Vgl. Belamy, Alex J./ Williams, Paul D. (2010): “Understanding Peacekeeping”, Polity Press Cambridge, Seite 7-10;
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die „Krise des UN-Peacekeeping“?
Sie beschreibt den Druck auf die Vereinten Nationen durch immer komplexere Missionen, schwindende internationale Unterstützung und strukturelle Grenzen der Belastbarkeit.
Welche Rolle spielen Regionalorganisationen in Afrika?
Organisationen wie die Afrikanische Union (AU) übernehmen verstärkt Friedensmissionen vor Ort, oft aufgrund geografischer Nähe und schnellerer Reaktionsfähigkeit.
Was sind die Risiken der Regionalisierung von Friedenseinsätzen?
Kritiker befürchten ein „Outsourcing“ von Problemen, mangelnde Professionalität schwacher Organisationen oder die Instrumentalisierung durch regionale Hegemonialmächte.
Was ist das Konzept „Responsibility to Protect“ (R2P)?
Es ist ein postwestphälisches Souveränitätsverständnis, das Eingriffe der Weltgemeinschaft erlaubt, wenn ein Staat seine Bevölkerung nicht vor Massenverbrechen schützt.
Was zeichnet die Mission UNAMID aus?
UNAMID ist ein Beispiel für eine hybride Mission, bei der eine enge Zusammenarbeit zwischen der UN und afrikanischen Akteuren stattfindet.
- Quote paper
- Magister Bachelor Alexander Fritsch (Author), 2011, Anspruch und Wirklichkeit regionaler Friedenssicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262140