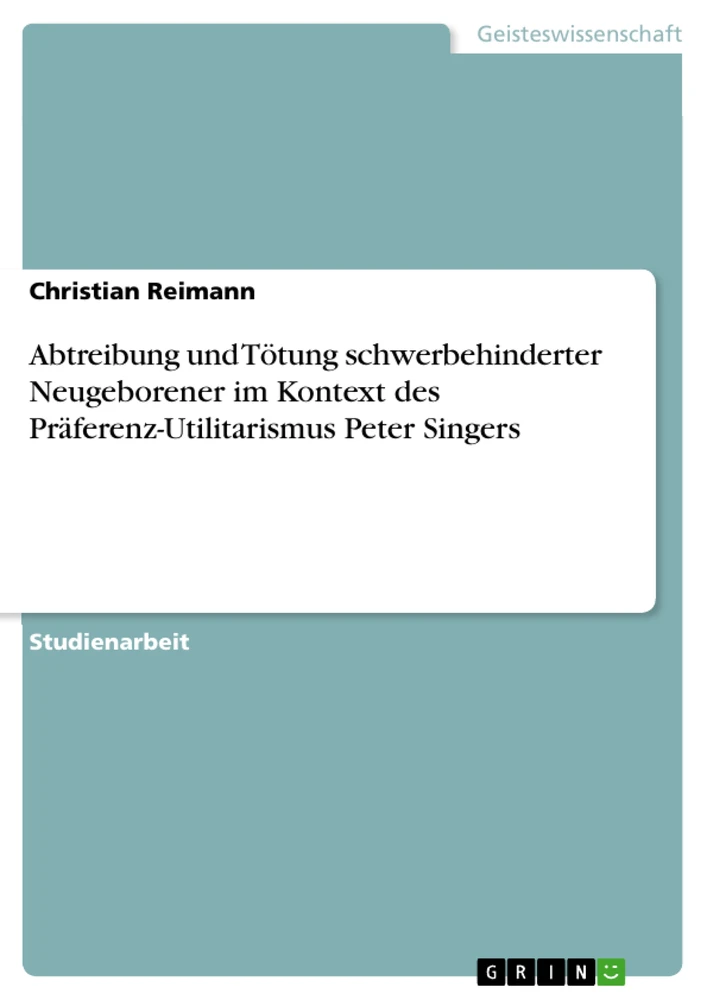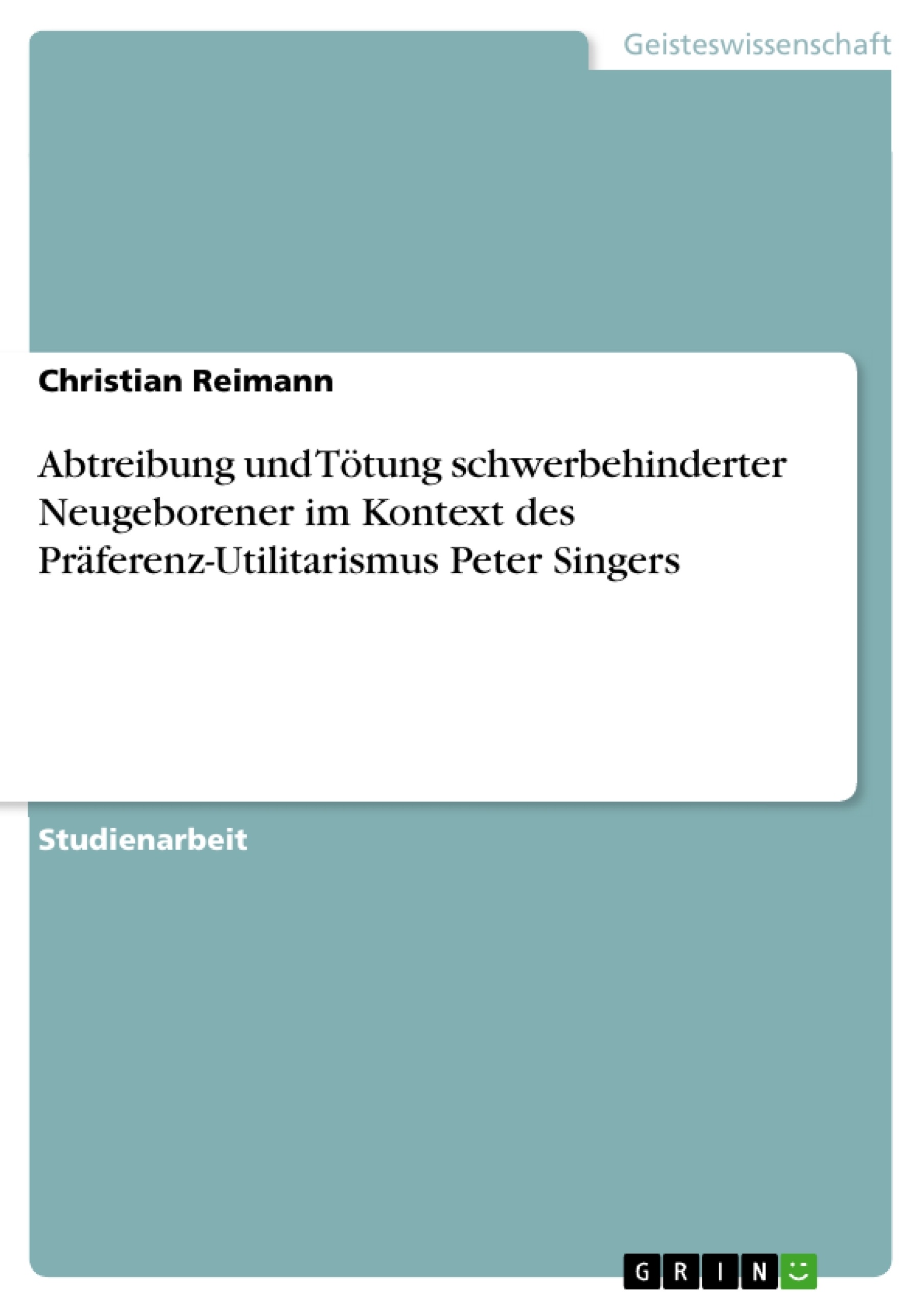Der australische Philosoph Peter Singer zählt zu den kontroversesten Autoren im bio- und medizinethischen Diskurs. In Deutschland entstand die Kontroverse um Singer Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Sie manifestierte sich u.a. darin, dass Vorträge des Bioethikers zu erheblichen Protesten, Ausladungen zu Folgevorträgen sowie zu Tagungsverlegungen führten (vgl. Geißendörfer 2009, S. 44). Was Singer bis heute so umstritten macht, sind insbesondere seine Auffassungen zum moralischen Status und Wert des frühen menschlichen Lebens, die er in seinem Werk Praktische Ethik (dritte Auflage: 2013; erste Auflage: 1984) formuliert.
Singers argumentativer Ausgangspunkt in diesem Werk bildet die kritische Auseinandersetzung mit der seiner Ansicht nach „tief verwurzelten westlichen Überzeugung“ (2013, S. 145), menschliches Leben besitze ein intrinsisches Recht auf Leben und genieße daher kategorischen moralischen Schutz (vgl. Schramme 2002, S. 98). Da für Singer diese so genannte Lehre von der „Heiligkeit“, d.h. Unantastbarkeit menschlichen Lebens letztlich ein Dogma christlich-religiöser Provenienz konstituiert, spricht er dem Menschen einen An-sich-Anspruch auf Leben und moralische Schutzwürdigkeit ab; der Wert menschlichen Lebens hat nach Singer damit keine absolute Geltung, sondern ist relativierbar. Vor diesem Hintergrund diskutiert der Moralphilosoph die moralische Vertretbarkeit der Tötung menschlichen Lebens im Kontext der ethischen Frage nach der moralischen Bewertung von Abtreibung und Infantizid. Singers Absicht besteht hierbei darin, zugunsten der moralischen Zulässigkeit der Tötung von Embryonen bzw. Föten sowie von Euthanasie an schwerbehinderten Neugeborenen zu argumentieren.
Wie jedoch in der vorliegenden Arbeit dargelegt werden soll, erweist sich Singers Argumentation aus mehreren Gründen als nicht überzeugend. Deshalb besteht das Ziel der nachstehenden Ausführungen darin, zum einen zu untersuchen, welche Argumente Singer für die moralische Vertretbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen und die Tötung schwerbehinderter Säuglinge anführt und, zum Zweiten, wie sich seine Argumentation aus philosophischer Sicht beurteilen lässt. Entsprechend geht es zur Beantwortung dieser Frage in einem ersten Schritt darum, Singers Argumente für Abtreibung und Euthanasie an schwerbehinderten Neugeborenen zu eruieren (vgl. 2), um sie anschließend zu problematisieren (vgl. 3). Zuletzt erfolgt eine Zusammenfassung der generierten Ergebnisse (vgl. 4).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Abtreibung und Tötung schwerbehinderter Neugeborener im Kontext des Präferenz-Utilitarismus Peter Singers
- 2.1 Voraussetzungen der Singer'schen Ethik
- 2.2 Singers moralische Bewertung von Schwangerschaftsabbrüchen
- 2.3 Singers moralische Bewertung von Euthanasie im Kontext schwerbehinderter Neugeborener
- 3 Kritische Beurteilung der Position Singers
- 4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Peter Singers Positionen zur Abtreibung und zur Tötung schwerbehinderter Neugeborener im Kontext seines Präferenz-Utilitarismus. Das Ziel ist die Analyse von Singers Argumenten und deren philosophische Beurteilung. Die Arbeit beleuchtet die ethischen Implikationen seiner Theorie und deren Anwendung auf die genannten Themen.
- Präferenz-Utilitarismus als ethische Grundlage
- Singers moralische Bewertung von Abtreibung
- Singers moralische Bewertung der Tötung schwerbehinderter Neugeborener
- Kritische Auseinandersetzung mit Singers Argumentation
- Das Prinzip der gleichen Interessenabwägung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt Peter Singer als kontroversen Bioethiker vor und skizziert die Debatte um seine Positionen zum moralischen Status des frühen menschlichen Lebens. Sie beschreibt Singers Kritik an der Vorstellung eines intrinsischen Rechts auf Leben und kündigt die Analyse seiner Argumente für die moralische Zulässigkeit von Abtreibung und Infantizid an. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Singers Argumenten und ihrer philosophischen Beurteilung, um die ethischen Implikationen seiner Theorie für Abtreibung und Tötung schwerbehinderter Neugeborener zu beleuchten.
2 Abtreibung und Tötung schwerbehinderter Neugeborener im Kontext des Präferenz-Utilitarismus Peter Singers: Dieses Kapitel analysiert Singers Argumente für Abtreibung und die Tötung schwerbehinderter Säuglinge. Es beginnt mit der Erläuterung der Grundlagen seines Präferenz-Utilitarismus, der den moralischen Wert einer Handlung an der Maximierung der interpersonellen Präferenzsumme misst. Es wird Singers Konzept der gleichen Interessenabwägung detailliert beschrieben, welches die unparteiische Berücksichtigung aller betroffenen Interessen fordert, unabhängig von Eigenschaften wie Intelligenz oder Fähigkeiten. Die Anwendung dieses Prinzips auf Abtreibung und Infantizid bildet den Kern der Argumentation Singers, die in diesem Kapitel im Detail untersucht wird.
Schlüsselwörter
Peter Singer, Präferenz-Utilitarismus, Abtreibung, Infantizid, moralischer Status, Schwerbehinderung, Ethik, Bioethik, gleiche Interessenabwägung, konsequentialistische Ethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Peter Singers Positionen zur Abtreibung und Tötung schwerbehinderter Neugeborener
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Positionen von Peter Singer zur Abtreibung und Tötung schwerbehinderter Neugeborener im Kontext seines Präferenz-Utilitarismus. Sie untersucht seine Argumente, deren philosophische Grundlage und die ethischen Implikationen für die behandelten Themen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Präferenz-Utilitarismus als ethische Grundlage, Singers moralische Bewertung von Abtreibung und der Tötung schwerbehinderter Neugeborener, eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Argumentation sowie das Prinzip der gleichen Interessenabwägung.
Wie wird Singers Position dargestellt?
Die Arbeit erläutert Singers Präferenz-Utilitarismus, der den moralischen Wert einer Handlung an der Maximierung der interpersonellen Präferenzsumme misst. Sie beschreibt detailliert sein Konzept der gleichen Interessenabwägung und zeigt, wie Singer dieses Prinzip auf Abtreibung und Infantizid anwendet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Analyse von Singers Positionen zu Abtreibung und Infantizid im Kontext seines Präferenz-Utilitarismus, einem Kapitel zur kritischen Beurteilung seiner Position und einer Zusammenfassung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Das Ziel ist die Analyse von Singers Argumenten und deren philosophische Beurteilung. Die Arbeit untersucht die ethischen Implikationen seiner Theorie und deren Anwendung auf Abtreibung und die Tötung schwerbehinderter Neugeborener.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Peter Singer, Präferenz-Utilitarismus, Abtreibung, Infantizid, moralischer Status, Schwerbehinderung, Ethik, Bioethik, gleiche Interessenabwägung, konsequentialistische Ethik.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung stellt Peter Singer als kontroversen Bioethiker vor und skizziert die Debatte um seine Positionen zum moralischen Status des frühen menschlichen Lebens. Sie beschreibt Singers Kritik an der Vorstellung eines intrinsischen Rechts auf Leben und kündigt die Analyse seiner Argumente für die moralische Zulässigkeit von Abtreibung und Infantizid an.
Wie wird das Kapitel zur Analyse von Singers Positionen beschrieben?
Dieses Kapitel analysiert Singers Argumente für Abtreibung und die Tötung schwerbehinderter Säuglinge detailliert. Es erläutert die Grundlagen seines Präferenz-Utilitarismus und sein Konzept der gleichen Interessenabwägung und untersucht die Anwendung dieses Prinzips auf Abtreibung und Infantizid.
- Citation du texte
- Christian Reimann (Auteur), 2013, Abtreibung und Tötung schwerbehinderter Neugeborener im Kontext des Präferenz-Utilitarismus Peter Singers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262155