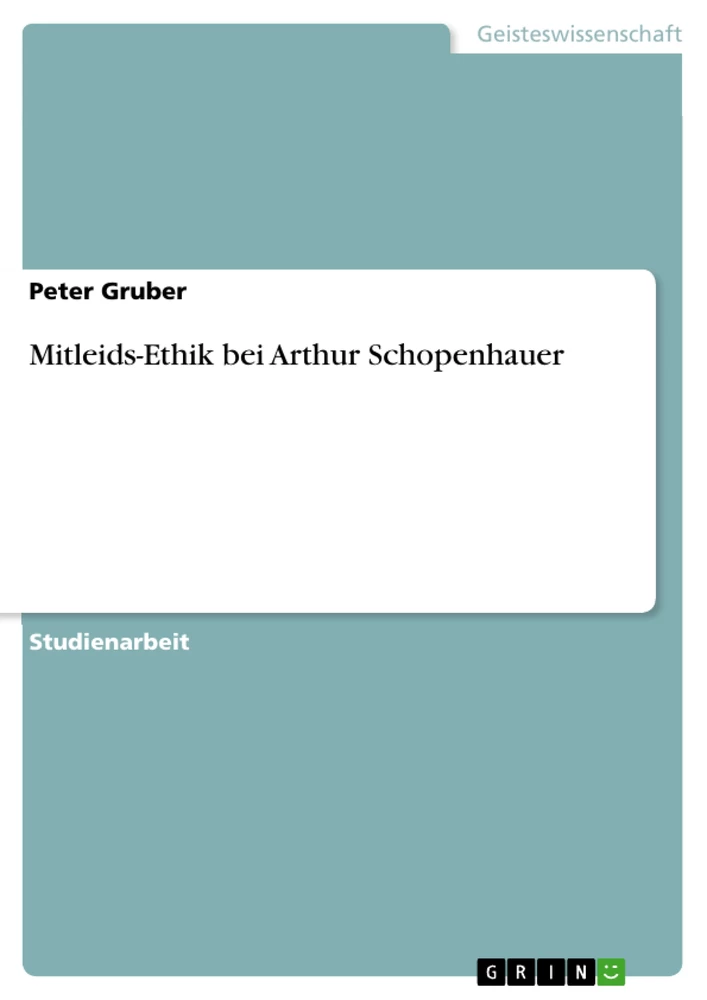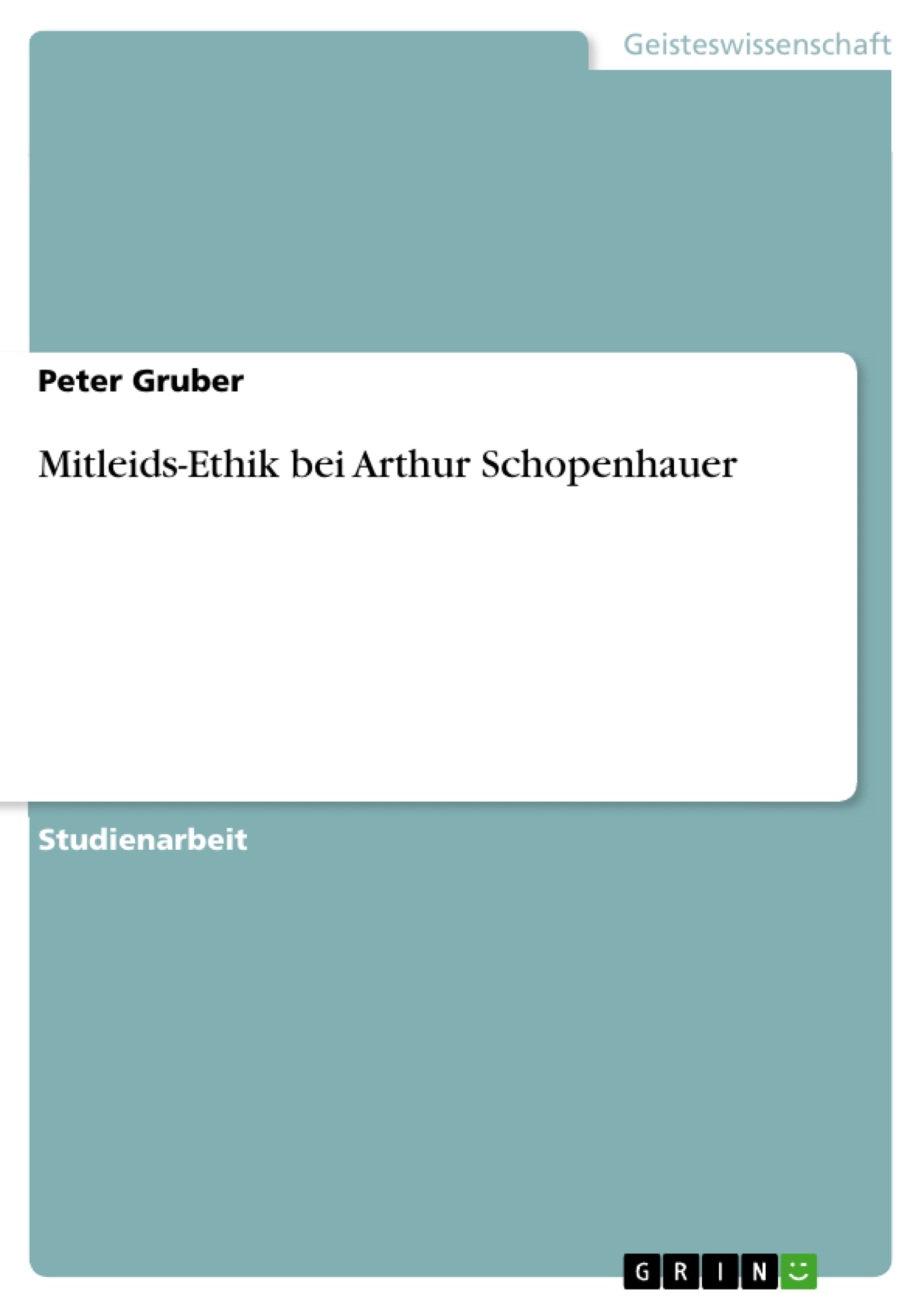Eine Zusammenfassung der Ethik Schopenauers unter Berücksichtigung möglicher Kritikpunkte an derselben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das metaphysische Fundament der Ethik
2.1. Die Metaphysik Schopenhauers
2.2. Drei Triebfedern: Mitleid, Egoismus und Bosheit
2.3. Mitleid moralisch?
3. Charakter und Gewissen
3.1. Handlung, Charakter und Freiheit
3.2. Das Gewissen
4. Das Verbotene, das Erlaubte und das Gute
4.1. Der Begriff des Guten und des Rechten
4.2. Die reine Rechtslehre und die Staatslehre
4.3. Die Tugend der Menschenliebe
5. Aufgabe der Ethik
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das metaphysische Fundament von Schopenhauers Ethik?
Schopenhauers Ethik basiert auf seiner Metaphysik des Willens. Er sieht in allem Leben denselben blinden Willen am Werk, was die theoretische Grundlage für die Überwindung der Trennung zwischen Individuen bildet.
Welche drei Triebfedern des menschlichen Handelns nennt Schopenhauer?
Schopenhauer unterscheidet drei Grundmotive: den Egoismus (das eigene Wohl), die Bosheit (das fremde Wehe) und das Mitleid (das fremde Wohl). Nur Handlungen aus Mitleid haben für ihn moralischen Wert.
Warum gilt Mitleid bei Schopenhauer als die Basis der Moral?
Mitleid ist für Schopenhauer das unmittelbare Mitfühlen des Leidens eines anderen. Es hebt die Schranke zwischen Ich und Nicht-Ich auf und führt so zu gerechtem und menschenfreundlichem Handeln.
Wie sieht Schopenhauer das Verhältnis von Charakter und Freiheit?
Schopenhauer geht davon aus, dass der empirische Charakter eines Menschen angeboren und unveränderlich ist. Freiheit existiert für ihn nicht im Handeln (das determiniert ist), sondern nur im intelligiblen Wesen des Menschen.
Was ist die Aufgabe der Ethik laut Schopenhauer?
Die Aufgabe der Ethik ist es nicht, Vorschriften zu machen (präskriptiv), sondern das tatsächliche moralische Handeln der Menschen zu erklären und zu deuten (deskriptiv).
- Quote paper
- Peter Gruber (Author), 2013, Mitleids-Ethik bei Arthur Schopenhauer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262246