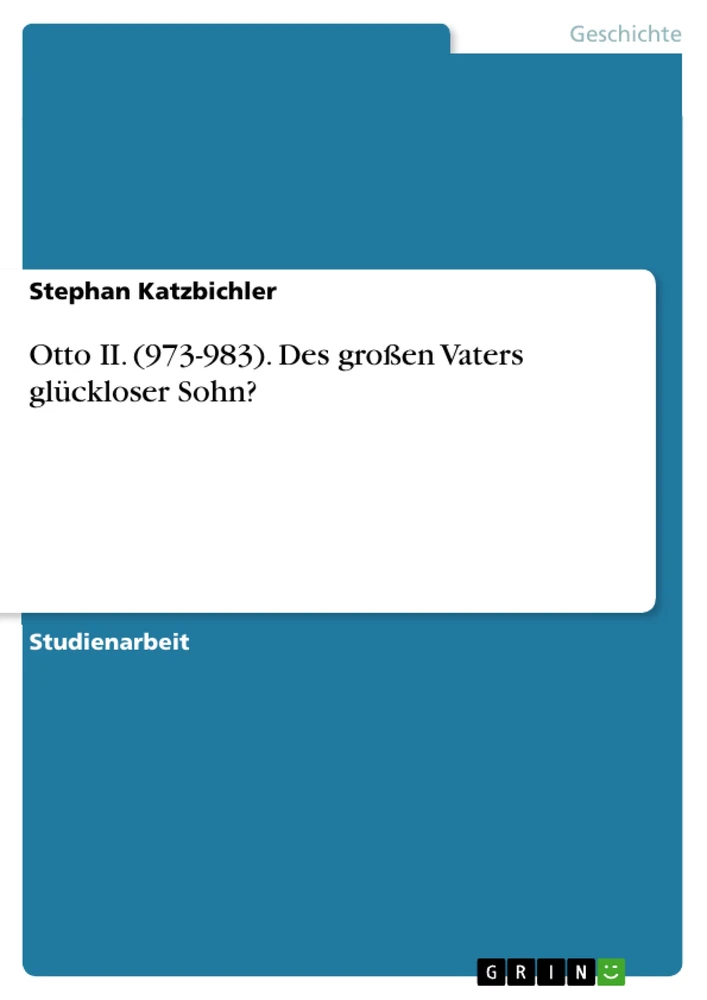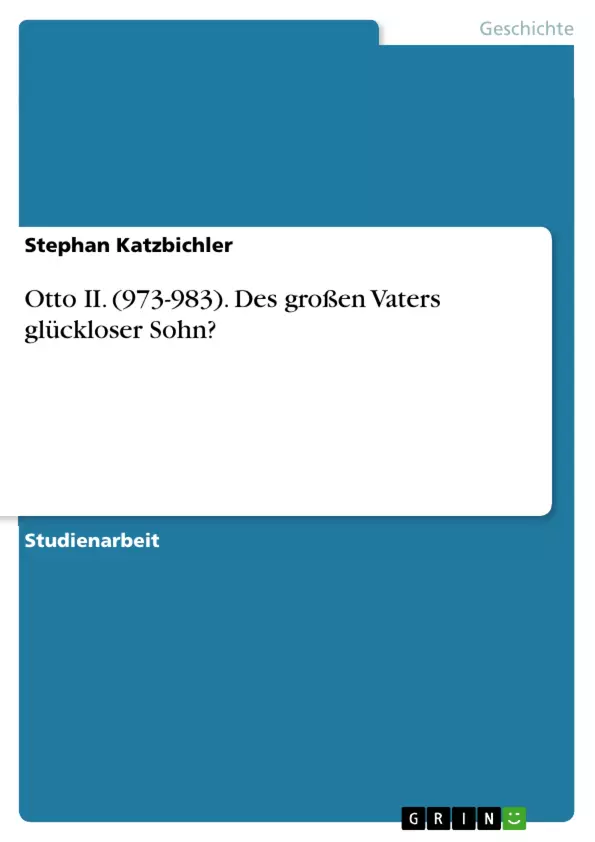Denkt man heute an einen römisch-deutschen Kaiser des Mittelalters aus dem Geschlecht der Liudolfinger, so konzentrieren sich die Gedanken auf Otto II. sicherlich als letztes. Der Schatten seiner Nachfolger, besonders aber Ottos des Großen, seines Vaters, scheint auch heute noch so überwältigend zu sein, dass Otto II. weder 1967, als an seine Mitkaiserkrönung hätte erinnert werden können, noch 1973, zum tausendsten Jahrestag des Beginns seiner Regentschaft, noch zehn Jahre später, als man seinen Todestag hätte begehen können, größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit fand. Mit ein Grund hierfür mag sicherlich sein, dass Otto II. in der jüngeren Forschung bezüglich seiner Regierungstätigkeit häufig als „eines großen Vaters glückloser Sohn“ bezeichnet wurde.
Als Otto der Große am 7. Mai 973 starb, trat Otto II., der von seinem Vater schon früh zum Mitherrscher im regnum und imperium gemacht worden war, die Nachfolge im Reich als Kaiser an. Verheiratet mit der byzantinischen Kaisernichte Theophanu, verfolgte er zu Beginn seiner Regierungszeit bis 978 zunächst konsequent die Neuordnung der Machtverhältnisse in Süddeutschland , bevor Otto II., erfüllt von der Idee des universalen Kaisertums, sich von 980 bis zu seinem Tod auf Italien bzw. Rom konzentrierte. In den letzten beiden Jahren seiner Regentschaft ereigneten sich dabei mit der Niederlage gegen die Sarazenen in Süditalien und mit den Verwirrungen im Reich in Folge des Aufstands der Elbslawen zwei Katastrophen, die zusammen mit dem frühen Tod des Kaisers am 7. Dezember 983 das Imperium in eine tiefe Krise stürzten und die Beurteilung der Kaiserherrschaft Ottos II. in der Geschichtsschreibung bis heute prägen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Otto II. und sein Vater (955-973)
- 2.1. Herkunft und Jugend
- 2.2. Mitregentschaft und Thronfolge
- 3. Die Herrschaft Ottos II. (973-983)
- 3.1. Herrschaftsantritt
- 3.2. Innenpolitische Konflikte und Herrschaftssicherung
- 3.2.1. Konflikte im Süden
- 3.2.2. Konflikte im Westen
- 3.3. Stützen der Herrschaft
- 3.3.1. Neuordnung der Bistümer
- 3.3.2. Klosterpolitik
- 3.4. Italienpolitik
- 3.4.1. Romzentrierung
- 3.4.2. Süditalienfeldzug
- 3.5. Regierungskrise
- 3.5.1. Thronfolgeregelung
- 3.5.2. Aufstand der Elbslawen
- 3.5.3. Tod und Nachfolge
- 4. Otto II. – des großen Vaters glückloser Sohn?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Regierungszeit Ottos II., des Sohnes Ottos des Großen, und hinterfragt die gängige Darstellung Ottos II. als "glückloser Sohn". Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Herrschaft Ottos II. umfassend zu analysieren und eine ausgewogene Bewertung seiner Regierungsleistung zu ermöglichen. Dabei wird die Bedeutung seiner innen- und außenpolitischen Strategien sowie der Herausforderungen seiner Regierungszeit beleuchtet.
- Ottos II. Mitregentschaft unter seinem Vater Otto I.
- Die innenpolitischen Herausforderungen und Herrschaftskonsolidierung Ottos II.
- Die Italienpolitik Ottos II. und ihre Bedeutung für das Reich.
- Die Regierungskrise am Ende der Herrschaft Ottos II.
- Eine kritische Auseinandersetzung mit der Bewertung Ottos II. als "glückloser Sohn".
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bewertung Ottos II. als "glückloser Sohn" in den Mittelpunkt. Sie skizziert die geringe öffentliche Aufmerksamkeit für Otto II. im Vergleich zu seinem Vater und begründet die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse seiner Regierungszeit. Die Arbeit verspricht eine detaillierte Betrachtung von Ottos II. Herrschaftsantritt, seiner innenpolitischen Strategien, seiner Italienpolitik und der Krise am Ende seiner Herrschaft. Die verwendeten Quellen und die methodische Vorgehensweise werden ebenfalls kurz erläutert.
2. Otto II. und sein Vater (955-973): Dieses Kapitel befasst sich mit der Herkunft und Jugend Ottos II., sowie seiner Mitregentschaft unter seinem Vater Otto I. Es analysiert die frühzeitige Einbeziehung Ottos II. in die Reichspolitik, seine Krönung zum Mitkönig und die Bedeutung dieser Maßnahmen für die Sicherung der dynastischen Kontinuität. Die Rolle Ottos II. während der Abwesenheit seines Vaters im Italien wird ebenfalls diskutiert. Das Kapitel verdeutlicht, wie die frühzeitige Mitregentschaft Ottos II. sowohl seine Vorbereitung auf die zukünftige Herrschaft als auch die strategischen Kalkulationen seines Vaters Otto I. widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Otto II., Otto der Große, Liudolfinger, Heiliges Römisches Reich, Mitregentschaft, Thronfolge, Innenpolitik, Italienpolitik, Regierungskrise, Elbslawen, Herrschaftsstabilisierung, Kaiser, Universalkaisertum, Geschichtsschreibung, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Regierungszeit Ottos II.
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert umfassend die Regierungszeit Kaiser Ottos II., des Sohnes Ottos des Großen. Sie hinterfragt dabei die gängige Darstellung Ottos II. als „glückloser Sohn“ und bewertet seine Regierungsleistung ausgewogen. Die Arbeit untersucht seine Innen- und Außenpolitik, die Herausforderungen seiner Herrschaft und die Bedeutung seiner Strategien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Mitregentschaft Ottos II. unter seinem Vater, die innenpolitischen Herausforderungen und die Herrschaftskonsolidierung, die Italienpolitik und deren Bedeutung für das Reich, die Regierungskrise am Ende seiner Herrschaft und eine kritische Auseinandersetzung mit der Bewertung Ottos II. als „glückloser Sohn“. Spezifische Aspekte umfassen Konflikte im Süden und Westen des Reiches, die Neuordnung der Bistümer, die Klosterpolitik, den Süditalienfeldzug, den Aufstand der Elbslawen und die Thronfolgeregelung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Otto II. und seinen Vater (955-973) mit Fokus auf Herkunft, Jugend und Mitregentschaft, ein Kapitel über die Herrschaft Ottos II. (973-983) mit detaillierter Analyse der Innen- und Außenpolitik sowie der Regierungskrise, und abschließend ein Kapitel, welches die Frage nach Otto II. als „glückloser Sohn“ kritisch hinterfragt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist eine umfassende Analyse der Regierungszeit Ottos II. und eine ausgewogene Bewertung seiner Regierungsleistung. Es soll gezeigt werden, welche Bedeutung seine innen- und außenpolitischen Strategien hatten und welche Herausforderungen er während seiner Herrschaft bewältigen musste. Die Arbeit will ein differenzierteres Bild von Otto II. zeichnen als das bisher gängige.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Einleitung der Arbeit erwähnt die verwendeten Quellen und die methodische Vorgehensweise, jedoch werden die konkreten Quellen in der hier gegebenen Zusammenfassung nicht aufgeführt. Nähere Informationen hierzu finden sich im Volltext der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Otto II., Otto der Große, Liudolfinger, Heiliges Römisches Reich, Mitregentschaft, Thronfolge, Innenpolitik, Italienpolitik, Regierungskrise, Elbslawen, Herrschaftsstabilisierung, Kaiser, Universalkaisertum, Geschichtsschreibung, Quellenkritik.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von der Zielsetzung und den Themenschwerpunkten. Es werden Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel gegeben, sowie Schlüsselwörter aufgelistet. Die Struktur ist klar und logisch, um eine übersichtliche Darstellung des Themas zu gewährleisten.
- Quote paper
- Stephan Katzbichler (Author), 2013, Otto II. (973-983). Des großen Vaters glückloser Sohn?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262275