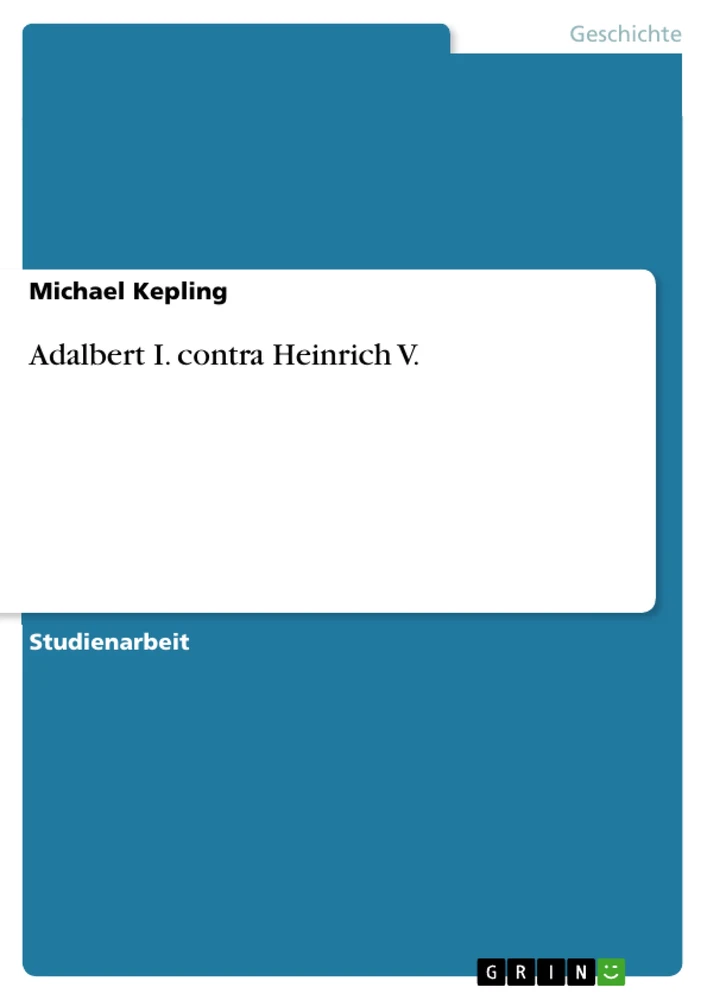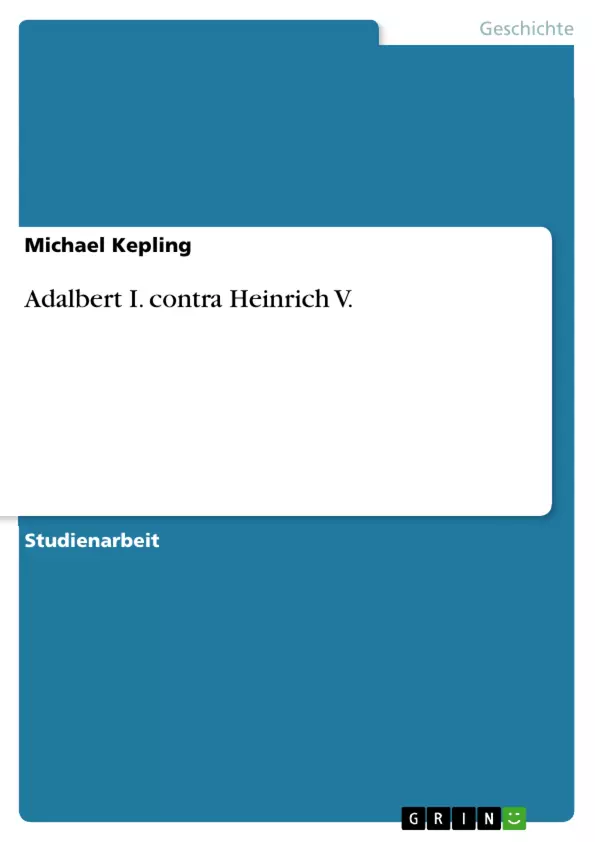Wohl kaum eine andere Zeit war derart von ermüdenden Auseinandersetzungen zwischen Regnum und Sacerdotium, zwischen Kaiser- und Papsttum geprägt wie das Jahrhundert der salischen Königsdynastie (1024-1125). Die Ansprüche des Kaisertums, das auf seinen tradierten Rechten beharrte, kollidierten mit jenen des Papsttums, das im Begriff war, erste Führungsmacht in der Christenheit und zentrale Regierungsinstanz der Kirche zu werden. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere der sogenannte Investiturstreit, im Zuge dessen die Frage erörtert wurde, wer eigentlich legitimiert sei, Bischöfe in ihr Amt einzusetzen: König oder Papst. Eine genuin theologische Frage also, die sich schnell jedoch ausweitete und bald schon nicht nur implizit vor allem darum kreiste, wer die eigentliche Führungsmacht in der Welt sei.
Die Konflikte zwischen Kirche und Welt lassen sich dabei keinesfalls auf die Konstellation einer Auseinandersetzung zwischen Papst und Kaiser beschränken. Vielmehr sah sich der Kaiser, vormals die unbestrittene Autorität im Reich, insbesondere nach den umwälzenden Ereignissen des Jahres 1111 auch seitens seines Episkopats in seinem Machtanspruch bedrängt. Denn ein Signum des ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhunderts liegt sicher in einer Intensivierung von Autoritäts- und Machtausübung, in einem gewandelten Amts- und Herrschaftsverständnis, liegt in einem gestiegenen Verantwortungsgefühl der Fürsten für das Reich, nicht zuletzt aber auch für das eigene Herrschaftsgebiet. Und ausgehend von diesem neuen Herrschafts- und Selbstverständnis bot sich den Bischöfen, zumal den mächtigen, genügend Spielraum, um vor dem Hintergrund des Investiturstreits auch ihre persönlichen politischen Ziele in Angriff zu nehmen. Als exemplarisch für eine solche Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Bischof, die im Spannungsfeld des Investiturstreits ihre Wurzeln hat und abläuft, dabei aber politisch motiviert ist, erweist sich der Konflikt zwischen Kaiser Heinrich V., dem letzten salischen Herrscher, und Erzbischof Adalbert I. von Mainz. Das Ziel dieser Arbeit ist es nun, die Vorgänge besagter Auseinandersetzung näher zu beleuchten.
Dazu werden zunächst die umwälzenden Ereignisse des Jahres 1111 im Hinblick auf die Positionierung Adalberts während jener Vorgänge und im Hinblick auf die daraus entstandenen Folgen für das Verhältnis zwischen dem Kaiser und seinen Bischöfen skizziert, bevor...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Jahr 1111 und die Folgen
- Der Konflikt zwischen Kaiser Heinrich V. und Adalbert von Mainz
- Der Bruch zwischen Kaiser und Erzbischof und die Gefangennahme Adalberts
- Die weitere Zuspitzung des Konflikts
- Der Würzburger Hoftag 1121
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konflikt zwischen Kaiser Heinrich V. und Erzbischof Adalbert I. von Mainz. Sie untersucht die Hintergründe der Auseinandersetzung und beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Umstände, die zum Bruch zwischen den beiden Männern führten.
- Die Veränderungen im Herrschaftsverständnis im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert.
- Die Intensivierung von Autoritäts- und Machtausübung im Reich.
- Die Bedeutung des Investiturstreits und die Frage der Machtverteilung zwischen Kaiser und Papst.
- Die persönlichen politischen Ziele der Bischöfe und die Nutzung des Investiturstreits als Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen.
- Die Rolle des Erzbischofs Adalbert von Mainz im Konflikt mit Kaiser Heinrich V.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Konflikts zwischen Kaiser Heinrich V. und Erzbischof Adalbert I. von Mainz dar und beleuchtet die Umwälzungen im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert. Dabei werden die Folgen des Investiturstreits und die Veränderungen im Herrschaftsverständnis von Kaiser und Fürsten beleuchtet.
Das zweite Kapitel behandelt die Ereignisse des Jahres 1111 und die Folgen für das Verhältnis zwischen Kaiser und seinen Bischöfen. Es wird die Rolle Adalberts von Mainz in diesen Vorgängen und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Machtverhältnisse im Reich geschildert.
Im dritten Kapitel wird der Konflikt zwischen Kaiser Heinrich V. und Erzbischof Adalbert I. von Mainz im Detail beschrieben. Es werden die Ursachen für den Bruch zwischen den beiden Männern und die weitere Zuspitzung des Konflikts dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet den Konflikt zwischen Kaiser Heinrich V. und Erzbischof Adalbert I. von Mainz vor dem Hintergrund des Investiturstreits, der Veränderungen im Herrschaftsverständnis im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert und der Intensivierung von Autoritäts- und Machtausübung im Reich. Zu den wichtigsten Themen gehören die Frage der Machtverteilung zwischen Kaiser und Papst, die Rolle der Bischöfe im Investiturstreit und die Bedeutung des Würzburger Hoftags 1121.
- Citation du texte
- Michael Kepling (Auteur), 2011, Adalbert I. contra Heinrich V., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262453