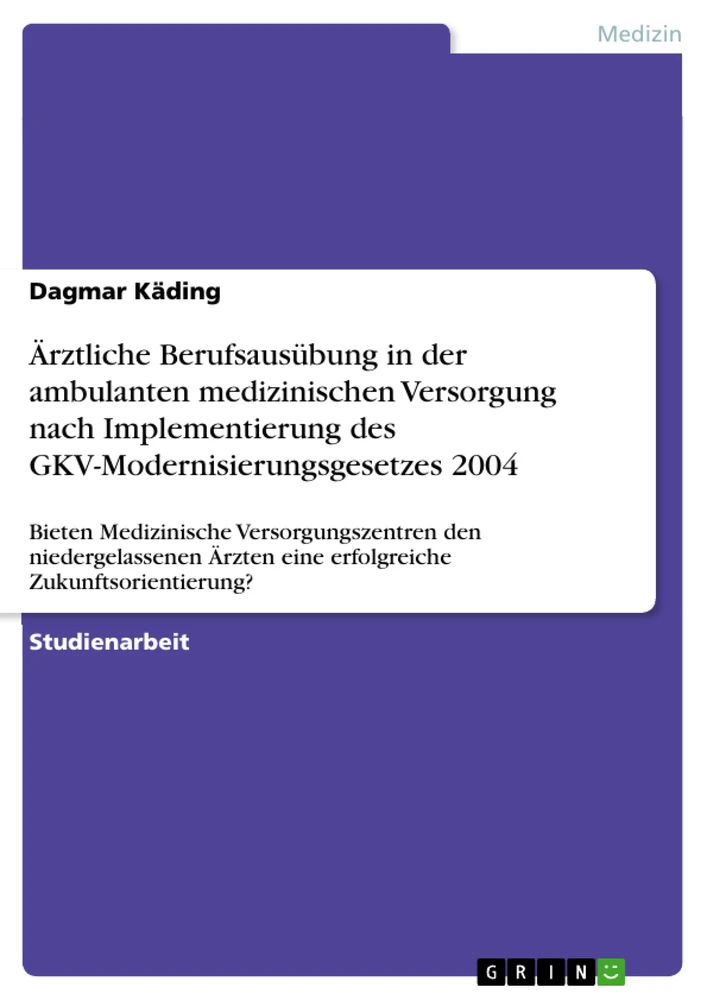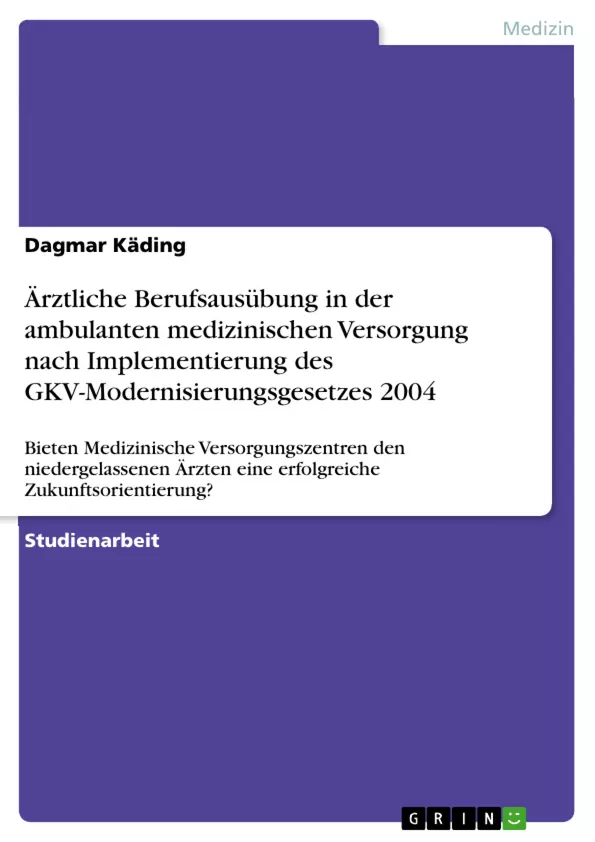Das deutsche Gesundheitswesen kämpft mittlerweile seit Jahrzehnten mit Problemen der Finanzierung und deren effizienten Lösungsansätzen. Häufig wird der Begriff „Kostenexplosion“ zur Erklärung der Finanzprobleme angewandt und damit wird auch die Lenkung auf Ausgabenseite des Gesundheitswesens forciert.
Es wird anhand der sekundären Forschungen durch Statistiken verdeutlicht, dass die Aus-gaben im Gesundheitswesen in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen sind. Im Jahr 2002 wurde bei den gesetzlichen Krankenkassen ein Defizit von 2.96 Milliarden Euro festgestellt.
Die Gründe der Finanzierungsprobleme sind vielfältig. Nicht zuletzt führen medizinischer Fortschritt, steigernde Nachfrage nach medizinischen Gütern und Dienstleistungen in immer älterwerdenden Gesellschaft zu enormen finanziellen Belastungen.
Neben der Kostenseite sind auch die Bereiche der Realausgaben für Gesundheitsdienstleistungen sowie Einnahmestagnation der Kostenträger und Belastungsverschiebungen zwischen einzelnen Kostenträgern im Gesundheitswesen. Nicht nur aus den u. a. oben genannten Gründen wird die Mittelknappheit im öffentlichen Sozialsystem sehr deutlich und die daraus resultierenden gesetzlichen Reformen, die verstärkt unter Kosten- und Leistungsdruck stehen.
Problemstellung
Das deutsche Gesundheitswesen wurde in den letzten Jahren vielfach gesetzlich verändert. Durch steigende Ausgaben in sozialen Bereichen sowie eine hohe Arbeitslosigkeit führten zu einer Initiation der Reorganisationen, wie Abbildung 2 darstellt.
Die gesetzlichen Reformen zielen auf alle wichtigsten Akteure im Gesundheitswesen ab. Diese wären u.a. Krankenkassen, Krankenhäuser, Apotheken, Ärzteschaft, Patienten oder die Gesundheitsindustrie.
Eine Kumulation von Gesundheitsreformgesetzen sollte die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge stabilisieren und die Versorgung auf ein hohes Niveau weiterentwickeln, sowie technische Innovationen forcieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Problemstellung
- 1.1. GKV-Modernisierungsgesetz als Problemlösung
- 1.2. Ziele des GKV-Modernisierungsgesetzes
- 1.3. Historie und Gegenwart der Medizinischen Versorgungszentren
- 2. Rahmenbedingungen für die Gründung der MVZ.
- 2.1. Das Vertragsänderungsgesetz (VÄndG)
- 2.2. Weitere gesetzliche Änderungen zu Medizinischen Versorgungszentren
- 2.3. Möglichkeiten durch Kooperationen
- 2.4. Praxisbeispiel - MVZ München
- 3. Gründungsvoraussetzungen
- 4. Rechtsformen
- 5. Empirische Analyse der Weiterentwicklung der MVZ.
- 5.1. Wahl der Rechtsform seit 2005
- 5.2. MVZ-Gründungen seit 2005 im Überblick
- 5.3. Art der ärztlichen Berufsausübung seit 2005
- 5.4. Durchschnittliche Arbeitsgröße der MVZ – Entwicklung seit 2005
- 6. Empirische Analyse der Kooperationsmotiven der Ärzte....
- 6.1. Studie zur Ärztezufriedenheit/ Erhebungsmethoden
- 6.2. Allgemeine Daten zur empirischen Studie Ärztezufriedenheit
- 6.3. Darstellung der motivationsbezogenen Aspekte der Ärzte und Ziel der Untersuchung
- 6.4. Auswertung der Studie
- 7. Geschlechtsspezifische Entwicklung der Absolventen der Humanmedizin und Prognose des Zukunftsszenarios
- 8. Zusammenfassung/Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung der ärztlichen Berufsausübung im ambulanten Bereich nach der Implementierung des GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) 2004 im deutschen Gesundheitswesen. Im Fokus steht die Frage, ob Medizinische Versorgungszentren (MVZ) den niedergelassenen Ärzten eine erfolgreiche Zukunftsorientierung bieten können. Die Arbeit analysiert die Rahmenbedingungen für die Gründung von MVZ, die empirische Entwicklung der MVZ-Gründungen seit 2005 und die motivationsbezogenen Aspekte der Ärzte in Bezug auf die Wahl der MVZ-Form.
- Einfluss des GKV-Modernisierungsgesetzes auf die ambulante medizinische Versorgung
- Entwicklung und Bedeutung von Medizinischen Versorgungszentren
- Rahmenbedingungen und Gründungsvoraussetzungen für MVZ
- Empirische Analyse der MVZ-Gründungen und -entwicklung
- Motive von Ärzten für die Mitarbeit in MVZ
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der ärztlichen Berufsausübung im ambulanten Bereich nach der Implementierung des GKV-Modernisierungsgesetzes ein. Die Arbeit untersucht die Rolle von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in diesem Kontext und stellt die Relevanz der Thematik heraus.
- Kapitel 1 beleuchtet die Problemstellung der ärztlichen Berufsausübung im ambulanten Bereich und stellt das GKV-Modernisierungsgesetz als Lösungsansatz vor. Die Ziele des Gesetzes und die Historie sowie die Gegenwart der MVZ werden analysiert.
- Kapitel 2 betrachtet die Rahmenbedingungen für die Gründung von MVZ, einschließlich des Vertragsänderungsgesetzes (VÄndG) und weiterer gesetzlicher Änderungen. Möglichkeiten durch Kooperationen und ein Praxisbeispiel eines MVZ in München werden dargestellt.
- Kapitel 3 und 4 befassen sich mit den Gründungsvoraussetzungen und verschiedenen Rechtsformen von MVZ.
- Kapitel 5 präsentiert eine empirische Analyse der Weiterentwicklung von MVZ, einschließlich der Wahl der Rechtsform, der MVZ-Gründungen, der Art der ärztlichen Berufsausübung und der durchschnittlichen Arbeitsgröße seit 2005.
- Kapitel 6 widmet sich der empirischen Analyse der Kooperationsmotiven der Ärzte. Eine Studie zur Ärztezufriedenheit wird vorgestellt, und die motivationsbezogenen Aspekte der Ärzte und die Ziele der Untersuchung werden erläutert. Die Auswertung der Studie wird präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie ambulante medizinische Versorgung, GKV-Modernisierungsgesetz, Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Gründungsvoraussetzungen, Rechtsformen, empirische Analyse, Kooperationsmotive, Ärztezufriedenheit und die Rolle von MVZ im Kontext der ärztlichen Berufsausübung. Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des GKV-Modernisierungsgesetzes auf die Entwicklung der MVZ und untersucht deren Bedeutung für die Zukunft der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland.
- Quote paper
- B.A. Dagmar Käding (Author), 2010, Ärztliche Berufsausübung in der ambulanten medizinischen Versorgung nach Implementierung des GKV-Modernisierungsgesetzes 2004, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262493