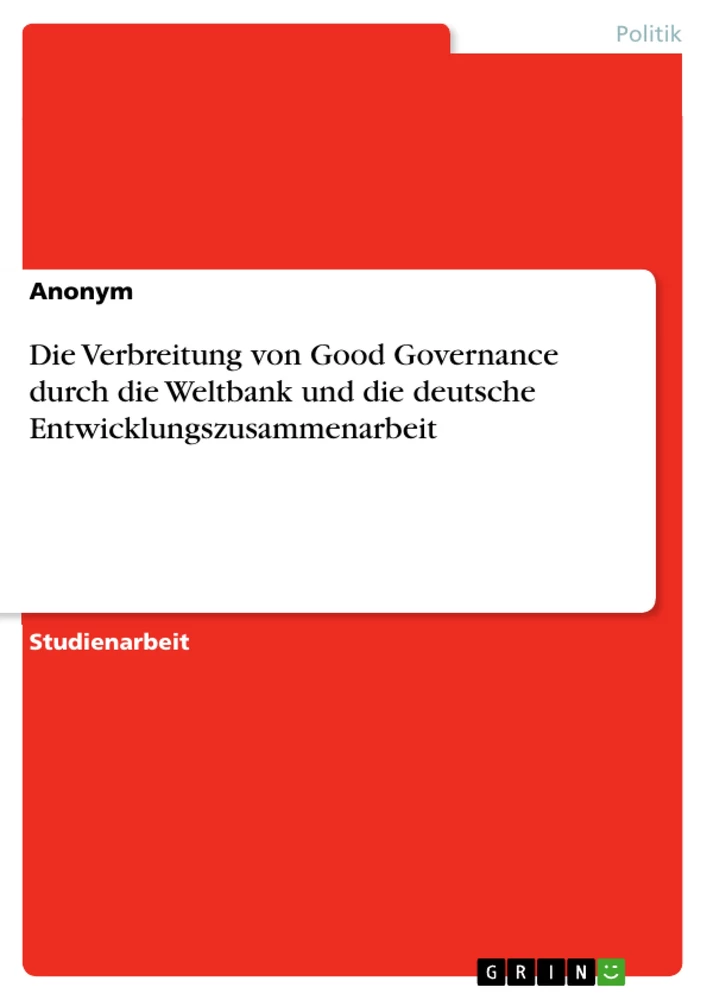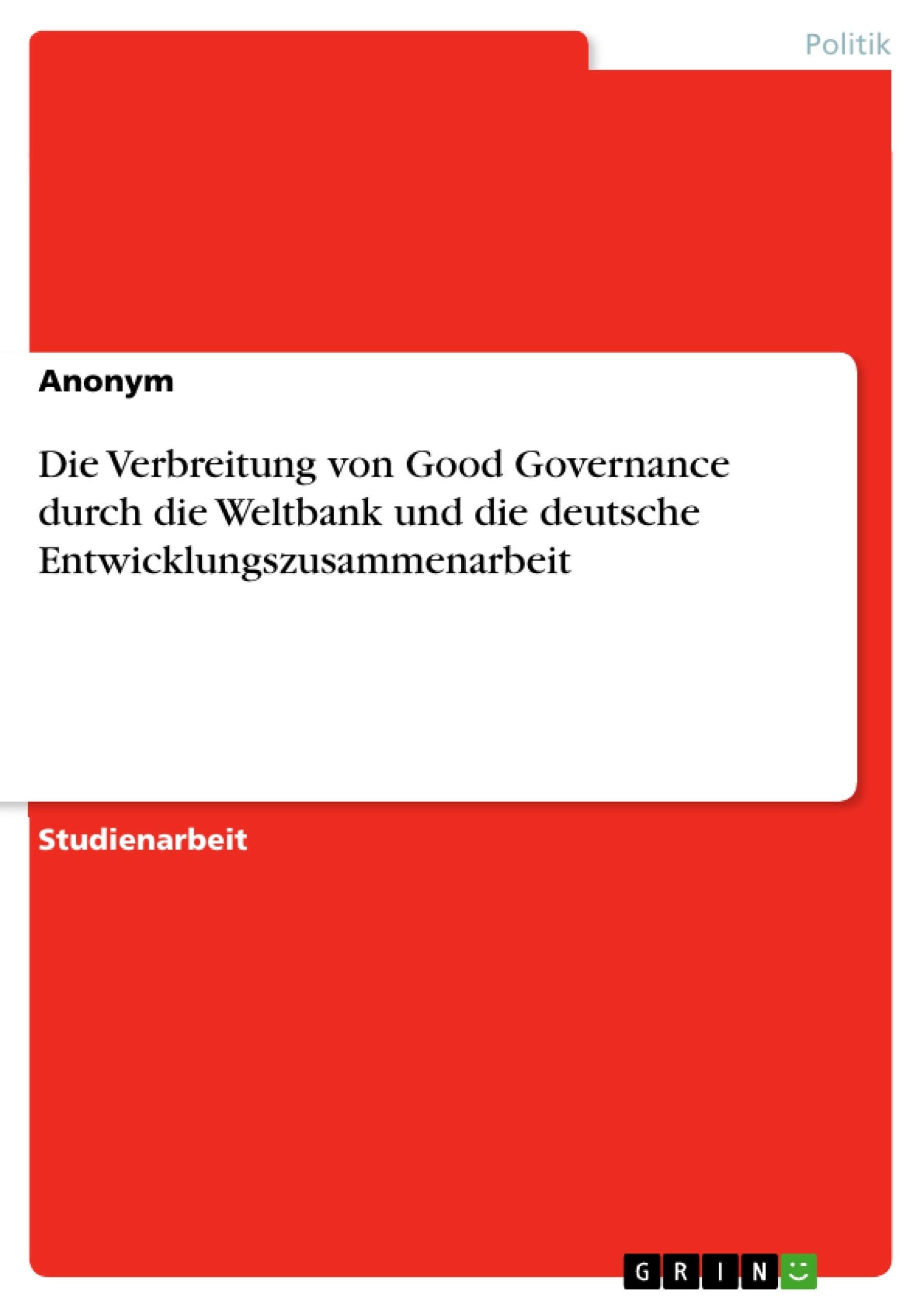Das Konzept bzw. der Ansatz Good Governance wurde seit den späten 1980er Jahren zunehmend zu einem vorherrschenden Paradigma in der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Die Arbeit versucht, die Ausbreitung des Konzepts durch die Ansätze der isomorphen institutionellen Entwicklung und des Policy-Learning zu erklären. Neben definitorischen Ausführungen liegt das Hauptaugenmerk der Arbeit im Stellenwert, den Good Governance im Rahmen der Arbeit der Weltbank und der deutschen Entwicklungszusammenarbeit erfährt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung: Isomorphie, Policy Learning, Governance und Good Governance
- Isomorphie und Policy Learning
- Governance und Good Governance
- Die Weltbank
- Die Entstehung des Konzepts
- Der Stellenwert von Good Governance in der Tätigkeit der Weltbank
- Good Governance in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
- Analyse
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Quellen
- Sekundärliteratur
- Websites
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die internationale Verbreitung des Good Governance-Konzepts in der globalen Entwicklungszusammenarbeit. Dabei wird die Rolle der Weltbank als Initiatorin der Diffusion des Paradigmas beleuchtet, und sodann die Auswirkungen für den Fall der deutschen Entwicklungszusammenarbeit erörtert. Ein Fokus der Arbeit liegt folglich auf dem Wandel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit seit der Wiedervereinigung 1990, und in diesem Kontext insbesondere auf den Stellenwert des Themenkomplexes der Good Governance für diese.
- Die Verbreitung des Good Governance-Konzepts in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit
- Die Rolle der Weltbank als Initiatorin der Diffusion des Good Governance-Paradigmas
- Die Auswirkungen von Good Governance auf die deutsche Entwicklungszusammenarbeit
- Der Wandel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit seit der Wiedervereinigung 1990
- Der Stellenwert von Good Governance in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung sowie die Gliederung der Arbeit.
Das Kapitel 2 definiert die zentralen Konzepte der Arbeit, Isomorphie, Policy Learning, Governance und Good Governance. Es wird die Entstehung und Entwicklung der jeweiligen Konzepte erläutert und deren Relevanz für die Untersuchung der Verbreitung von Good Governance in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit hervorgehoben.
Kapitel 3 widmet sich der Weltbank als einem der wichtigsten Akteure in der Verbreitung des Good Governance-Konzepts. Es wird die Entstehung des Konzepts innerhalb der Weltbank beschrieben und der Stellenwert von Good Governance in der Tätigkeit der Weltbank erläutert.
Kapitel 4 untersucht die Ausrichtung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Hinblick auf Good Governance. Es wird die historische Entwicklung des Konzepts in der deutschen Entwicklungspolitik dargestellt und die Rolle der Bundesrepublik Deutschland als einflussreicher Stakeholder in der Weltbank-Gruppe beleuchtet.
Das Kapitel 5 analysiert die Verbreitung des Good Governance-Ansatzes im Kontext der Weltbank und der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Es wird untersucht, ob sich im konkreten Fall von isomorpher organisationeller Entwicklung und von Policy Diffusion im Sinne eines Policy Learning und eines Policy-Transfers sprechen lässt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Good Governance, Weltbank, deutsche Entwicklungszusammenarbeit, Isomorphie, Policy Learning, Policy Transfer, Governance, Rechtsstaatlichkeit, Transparenz, Korruption, Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit, internationale Beziehungen, politische Ökonomie, Institutionenökonomie, Entwicklungstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Good Governance in der Entwicklungspolitik?
Good Governance bezeichnet eine gute Regierungsführung, die auf Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Korruptionsbekämpfung basiert.
Welche Rolle spielt die Weltbank bei diesem Konzept?
Die Weltbank gilt als Initiatorin und treibende Kraft hinter der internationalen Verbreitung (Diffusion) des Good Governance-Paradigmas seit den späten 1980er Jahren.
Wie hat sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit verändert?
Seit der Wiedervereinigung 1990 hat Good Governance einen zentralen Stellenwert in der deutschen Entwicklungspolitik eingenommen, oft beeinflusst durch internationales Policy-Learning.
Was ist Isomorphie in diesem Zusammenhang?
Isomorphie beschreibt den Prozess, bei dem sich Organisationen oder Staaten in ihren Strukturen und Praktiken einander angleichen, um Legitimität zu gewinnen.
Was sind die Schwerpunkte der Analyse?
Die Analyse untersucht, ob die Verbreitung des Konzepts durch isomorphe institutionelle Entwicklung, Policy-Learning oder Policy-Transfer erklärt werden kann.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Die Verbreitung von Good Governance durch die Weltbank und die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262588