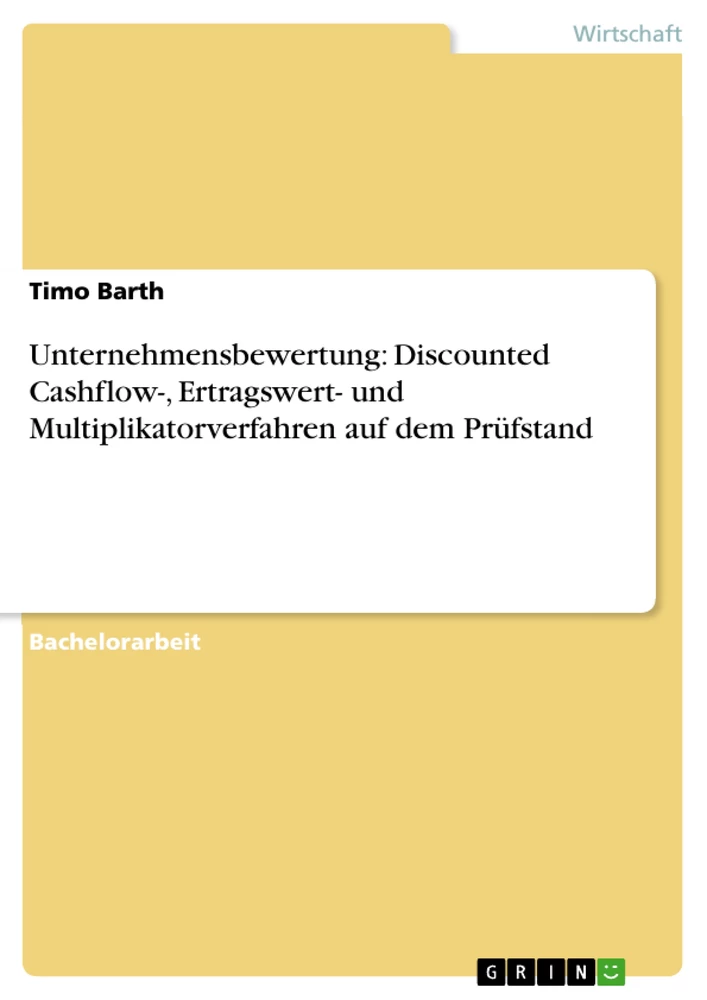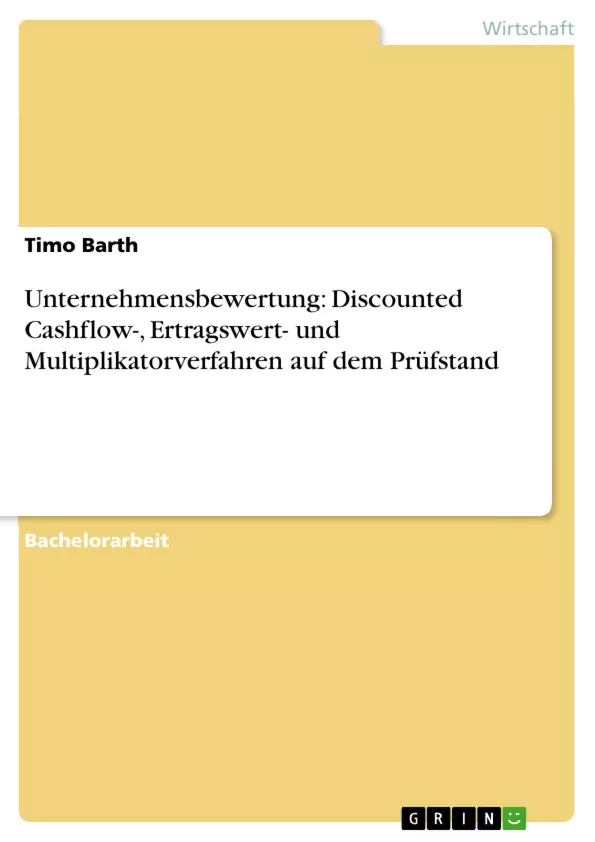Wie lässt sich der Wert eines Unternehmens bestimmen? Die Antwort auf diese Frage
wurde bereits von den Sumerern um 2000 vor Christi Geburt gesucht
(vgl. Bellinger/Vahl 1984, S. 1). Über die Jahrhunderte hinweg fand diese Frage immer
wieder Beachtung, wodurch sich zahlreiche Ansätze und Methoden entwickelten, die
die Beantwortung dieser Frage zum Ziel hatten.
Entscheidend für deren Entwicklung waren der Stand der mathematischen Kenntnisse
und die Werte und Gesetze, von denen die jeweiligen Perioden geprägt wurden
(vgl. Henselmann 2012, S. 100). Dies wird am Beispiel von Reinertragsmultiplikatoren
deutlich, die als dominierende Bewertungsmethode im Mittelalter zum Einsatz kamen
(vgl. Schneider 2001, S. 770). Sie spiegeln den Stand mathematischer Kenntnisse jener
Zeit wider und tragen dem an mehreren Stellen in der Bibel verankerten Zinsverbot
Rechnung. Bedingt durch den Einfluss der Kirche war es kirchlich wie weltlich untersagt,
Zinsen auf verliehenes Geld zu erheben (vgl. Henselmann 2012, S. 101).
Mit der Lockerung des Zinsverbots im späten Mittelalter wurden zunächst Kreditzinsen
in Höhe von bis zu 5 Prozent und später auch Zinseszinsen akzeptiert, welche sich in
Deutschland bei der Berechnung von Kapitalwerten jedoch erst im Verlauf des
19. Jahrhunderts durchsetzten (vgl. Henselmann 2012, S. 104).
Mit der intensiven Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre zu Beginn des
20. Jahrhunderts findet die Frage der Unternehmensbewertung auch bei deutschen Wissenschaftlern
verstärkt Beachtung (vgl. Schmalenbach 1912/13, S. 36). Durch das Inkrafttreten
des Handelsgesetzbuchs am 1. Januar 1900 und der darauf folgenden
Verbreitung von Bilanzen wurden nun dem Substanzwert und der objektiven Bewertungslehre
verstärkt Bedeutung beigemessen (vgl. Bellinger/Vahl 1992, S. 8; vgl. Kuhner/
Maltry 2006, S. 53). Aufgrund deren Orientierung an bilanziellen Größen zählten
die Wirtschaftsprüfer jener Zeit zu den stärksten Verfechtern, die Wissenschaftler sahen
darin jedoch die Kapitulation vor der Problemstellung einer prospektiven und subjektbezogenen
Unternehmensbewertung (vgl. Henselmann 2012, S. 105).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorstellung der Arbeit
- Gegenstand und Ziel der Arbeit
- Aufbau
- Grundlagen der Unternehmensbewertung
- Wertbegriff
- Werttheorie
- Objektive Bewertung
- Subjektive Bewertung
- Funktionale Bewertung
- Marktwertorientierte Bewertung
- Anlässe und Grundsätze der Unternehmensbewertung
- Konzeptionelle Grundlagen der Bewertungsverfahren
- Vergleichsverfahren
- Comparative Company Approach
- Rules of Thumb
- Vorgehensweise bei der Bewertung mit Multiplikatoren
- Discounted Cashflow-Verfahren
- WACC-Ansatz
- Free Cashflow
- Total Cashflow
- APV-Ansatz
- Equity-Ansatz
- Vorgehensweise bei der Bewertung mit DCF-Verfahren
- WACC-Ansatz
- Ertragswertverfahren
- Kapitalisierungsgrößen
- Kalkulationszinsfuß
- Vorgehensweise bei der Bewertung mit dem Ertragswertverfahren
- Vergleichsverfahren
- Vergleich und Kritik
- Vergleich
- Kritik
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis befasst sich mit dem betriebswirtschaftlichen Problem der Unternehmensbewertung. Ziel ist es, die in der Praxis dominierenden Verfahren zu vergleichen und kritisch hinsichtlich ihrer Konzeption und Eignung für den Zweck der Unternehmensbewertung zu beurteilen.
- Wertbegriff und Werttheorien
- Konzeptionelle Grundlagen der Bewertungsverfahren (Vergleichs-, DCF- und Ertragswertverfahren)
- Vergleich und Kritik der Verfahren
- Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Entwicklung der Unternehmensbewertung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert Gegenstand, Zielsetzung und Aufbau. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der Unternehmensbewertung erörtert, wobei der Wertbegriff definiert und verschiedene Wertkonzeptionen sowie -theorien vorgestellt werden. Die im zweiten Kapitel behandelten Aspekte sind für das dritte Kapitel sowie für Vergleich und Kritik von Bedeutung.
Das dritte Kapitel widmet sich den konzeptionellen Grundlagen der Bewertungsverfahren. Die Vergleichsverfahren, Discounted Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren) und das Ertragswertverfahren werden hinsichtlich ihrer zugrunde liegenden Theorien und ihrer Methodik analysiert. Für jedes Verfahren wird eine exemplarische Vorgehensweise skizziert, die einen praktischen Bewertungsprozess mit dem Verfahren veranschaulicht.
Das vierte Kapitel beinhaltet den Vergleich und die Kritik der verschiedenen Verfahren. Die Varianten der DCF-Verfahren werden miteinander verglichen, ebenso wie die originäre Form des Ertragswertverfahrens und die durch das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) modifizierte Variante. Anschließend werden alle Verfahren kritisch gewürdigt, wobei der marktorientierte Ansatz im Allgemeinen und im Speziellen anhand der zu subsumierenden Verfahren betrachtet wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Unternehmensbewertung, die konzeptionellen Grundlagen der Bewertungsverfahren, den Vergleich und die Kritik der Verfahren sowie die Zielsetzung und Eignung der Verfahren für den Zweck der Unternehmensbewertung. Die Arbeit betrachtet die in der Praxis dominierenden Verfahren, darunter die Discounted Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren), das Ertragswertverfahren und das Multiplikatorverfahren. Die Analyse bezieht sich auf die deutsche und die angelsächsische Bewertungslehre sowie auf den Standard des IDW. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen objektiver, subjektiver und funktionaler Bewertung und untersucht die Bedeutung des Wertbegriffs und der Werttheorien für die Unternehmensbewertung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Methoden zur Unternehmensbewertung werden in der Praxis am häufigsten genutzt?
Die dominierenden Verfahren sind das Discounted Cashflow-Verfahren (DCF), das Ertragswertverfahren und die Multiplikatorverfahren (Vergleichsverfahren).
Was ist der Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Bewertung?
Die objektive Bewertung orientiert sich an bilanziellen Größen und Substanzwerten, während die subjektive Bewertung die individuellen Zukunftserwartungen und Zwecke des Bewerters einbezieht.
Wie funktioniert das Discounted Cashflow-Verfahren (DCF)?
Beim DCF-Verfahren wird der Unternehmenswert durch die Diskontierung zukünftiger Cashflows ermittelt, wobei Ansätze wie WACC, APV oder der Equity-Ansatz zum Einsatz kommen.
Welche Rolle spielt das Ertragswertverfahren?
Es ermittelt den Wert basierend auf den zukünftigen Erträgen, die mit einem Kapitalisierungszinsfuß abgezinst werden. In Deutschland ist die vom IDW modifizierte Variante besonders relevant.
Warum ist der Wertbegriff in der Unternehmensbewertung so komplex?
Weil der "Wert" eines Unternehmens von verschiedenen Theorien (funktional, marktorientiert) und dem jeweiligen Anlass der Bewertung abhängt.
- Citation du texte
- Timo Barth (Auteur), 2013, Unternehmensbewertung: Discounted Cashflow-, Ertragswert- und Multiplikatorverfahren auf dem Prüfstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262796