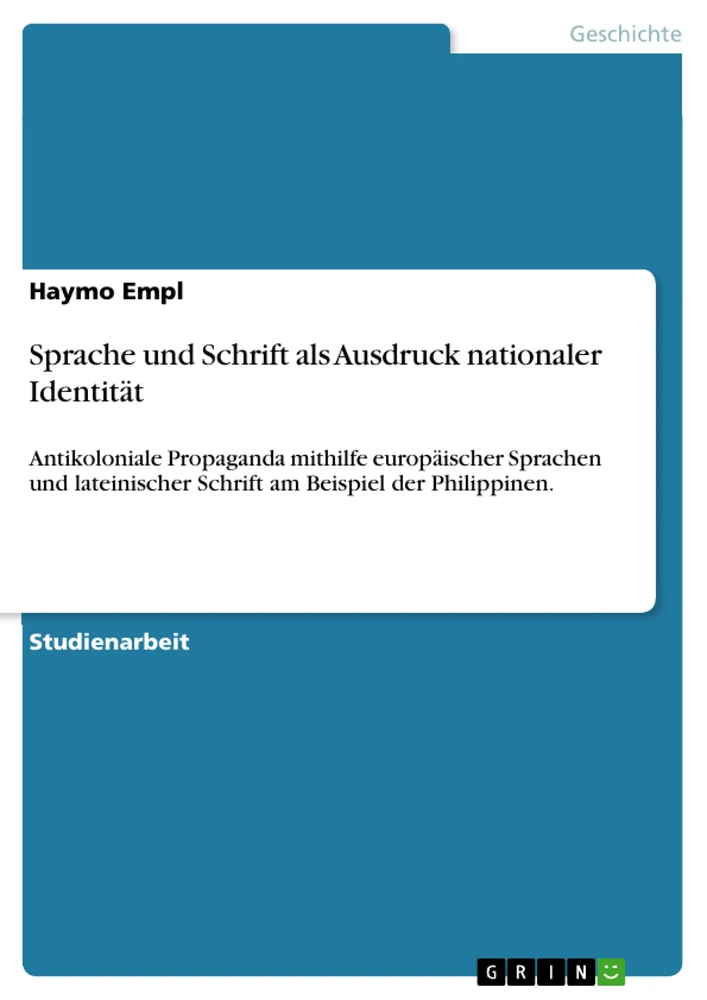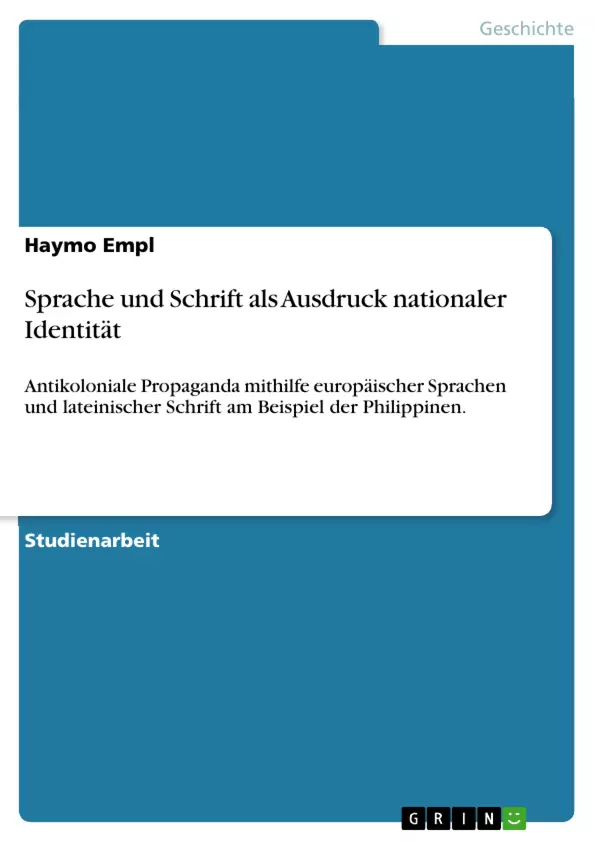Die gemeinsame Sprache zählt als Ausdrucks- und Kommunikationsmittel zusammen mit der gemeinsamen Kultur zu den wichtigsten Merkmalen eines Volkes. Das Volk wiederum wird im Staatsrecht – hier bezeichnet als Staatsvolk – neben Staatsgebiet und Staatsgewalt als elementarer Bestandteil eines Staates genannt. In der vornationalen Zeit war die Schriftsprache ein Abgrenzungsmittel der Machthaber gegenüber der einfachen Bevölkerung. Ich verdeutliche dies anhand einiger Beispiele:
Im mittelalterlichen Europa wurden wissenschaftliche Werke vorwiegend in lateinischer Sprache verfasst, die das ungebildete Volk sowieso nicht lesen konnte. In der frühen Neuzeit wurde in vielen europäischen Königs- und Fürstenhäusern französisch gesprochen. Die eigentliche Sprache des Volkes existierte dagegen hauptsächlich als gesprochene Sprache ohne Schriftform.
In der Kolonialzeit, beginnend im späten 15. Jahrhundert, führten die jeweiligen Kolonialherren in ihren Kolonien die eigene (Landes)Sprache ein, welche von der ansässigen Bevölkerung natürlich nicht verstanden wurde. Die Sprachen der Einheimischen waren weder in der Verwaltung noch in sonstigen Bereichen des öffentlichen Lebens von Bedeutung. Erst mit dem Aufkommen des Nationalismus im 19. Jahrhundert – zunächst in Europa, später auch in den Kolonien Afrikas, Südamerikas und Asiens – erhielten die Volkssprachen ihre heutige wesentliche Bedeutung als nationale Identifikationssymbole und dienten zunächst den nationalen Bewegungen zur Kommunikation und Verbreitung ihrer Gedanken und Ziele, später schliesslich den neuen Nationalstaaten als Landessprachen.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle von Sprache und Schrift in der nationalen antikolonialen Bewegung auf den Philippinen im späten 19. Jahrhundert. Dabei soll vor allem dargestellt werden, auf welche Art und Weise in diesem Falle die spanische Sprache Organisationen wie der Liga Filipina als Transportmedium zum Erreichen der philippinischen Bevölkerung diente.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Philippinen als spanische Kolonie
- Die Entstehung des philippinischen Nationalgefühls Ende des 19. Jahrhunderts
- José Rizal und die Liga Filipina
- Kindheit, Jugend und Ausbildung José Rizals
- Die Rolle der spanischen Sprache in der nationalen Bewegung unter Rizal
- Die Liga Filipina und die Katipunan
- Rizal in der Verbannung, die philippinische Revolution von 1896 und Tod Rizals
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle von Sprache und Schrift in der nationalen antikolonialen Bewegung auf den Philippinen im späten 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet insbesondere, wie die spanische Sprache als Transportmittel zur Erreichung der philippinischen Bevölkerung für Organisationen wie die Liga Filipina eingesetzt wurde.
- Die Bedeutung von Sprache und Schrift für die nationale Identität
- Die Rolle der spanischen Sprache in der Kolonialisierung der Philippinen
- Die Entstehung des philippinischen Nationalgefühls und die Rolle von José Rizal
- Die Liga Filipina und ihre Bedeutung für die nationale Bewegung
- Die Auswirkungen der spanischen Kolonialherrschaft auf die philippinische Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Sprache und Schrift für die nationale Identität. Es zeigt auf, wie die Sprache in der Geschichte als Abgrenzungsmittel der Machthaber gegenüber der einfachen Bevölkerung verwendet wurde und wie die Volkssprachen im 19. Jahrhundert eine neue Bedeutung als nationale Identifikationssymbole erlangten.
2. Die Philippinen als spanische Kolonie
Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte der spanischen Kolonisierung der Philippinen ab dem 16. Jahrhundert. Es zeigt auf, wie die Spanier die Inseln unter ihre Kontrolle brachten, die lokale Bevölkerung missionierten und die spanische Sprache und Kultur verbreiteten.
3. Die Entstehung des philippinischen Nationalgefühls Ende des 19. Jahrhunderts
Das Kapitel behandelt die Entstehung des philippinischen Nationalgefühls im späten 19. Jahrhundert. Es stellt die verschiedenen Faktoren dar, die zur Bildung einer nationalen Identität führten, wie z. B. die zunehmende Unterdrückung durch die spanische Kolonialmacht, die Verbreitung von Bildung und der Einfluss von europäischen Ideen.
4. José Rizal und die Liga Filipina
Dieses Kapitel widmet sich dem Leben und Wirken von José Rizal, einem wichtigen Protagonisten der philippinischen Unabhängigkeitsbewegung. Es beleuchtet die Rolle der spanischen Sprache in der nationalen Bewegung unter Rizal und die Gründung der Liga Filipina, einer Organisation, die sich für Reformen und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Filipinos einsetzte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Sprache, Schrift, nationale Identität, Kolonialismus, Anti-Kolonialismus, Philippinen, spanische Kolonialherrschaft, José Rizal, Liga Filipina, nationale Bewegung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Sprache für die nationale Identität?
Sprache ist ein zentrales Identifikationssymbol; sie dient als Kommunikationsmittel für nationale Bewegungen und zur Abgrenzung gegenüber Kolonialmächten.
Warum wurde auf den Philippinen Spanisch als Transportmedium genutzt?
Obwohl es die Sprache der Kolonialherren war, ermöglichte sie der gebildeten Elite (Ilustrados), nationale Gedanken über Sprachgrenzen hinweg zu verbreiten und Reformen zu fordern.
Wer war José Rizal?
Rizal war ein philippinischer Nationalheld, Arzt und Schriftsteller, der durch seine Werke und die Gründung der Liga Filipina den gewaltfreien Widerstand gegen Spanien anführte.
Was war die "Liga Filipina"?
Eine von Rizal gegründete Organisation, die sich für die Einheit der Philippinen, rechtliche Reformen und den Schutz der Bürger vor Ungerechtigkeit einsetzte.
Wie unterschied sich die vornationale Zeit von der Ära des Nationalismus?
In der vornationalen Zeit diente Schriftsprache (wie Latein) der Abgrenzung der Elite; im Nationalismus wurde die Volkssprache zum Symbol für das gesamte Staatsvolk.
- Quote paper
- Haymo Empl (Author), 2013, Sprache und Schrift als Ausdruck nationaler Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262847