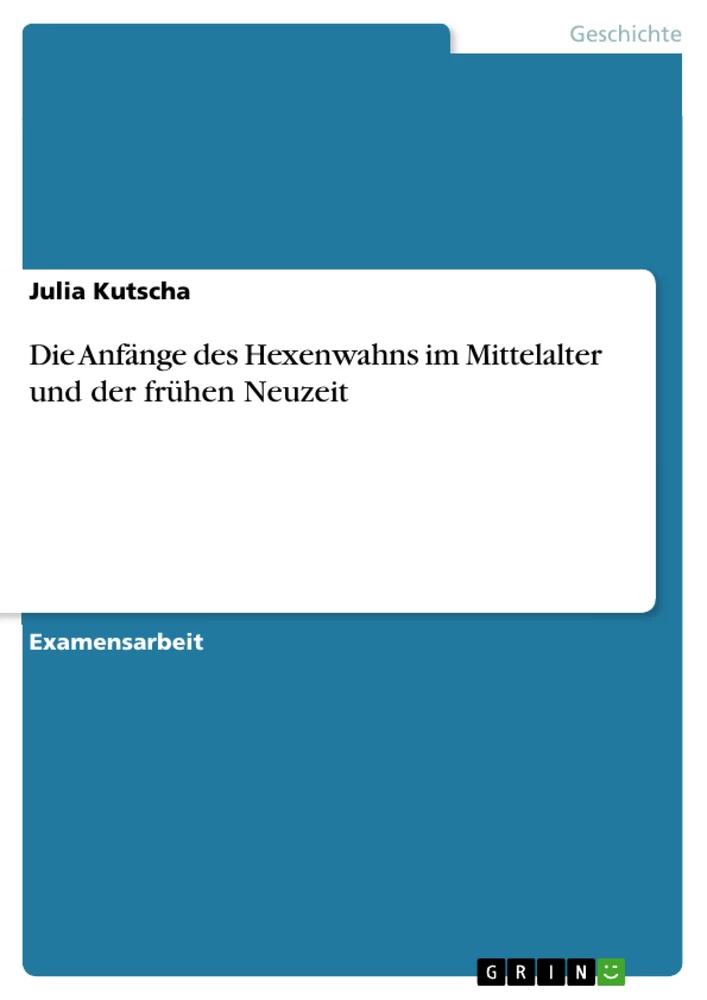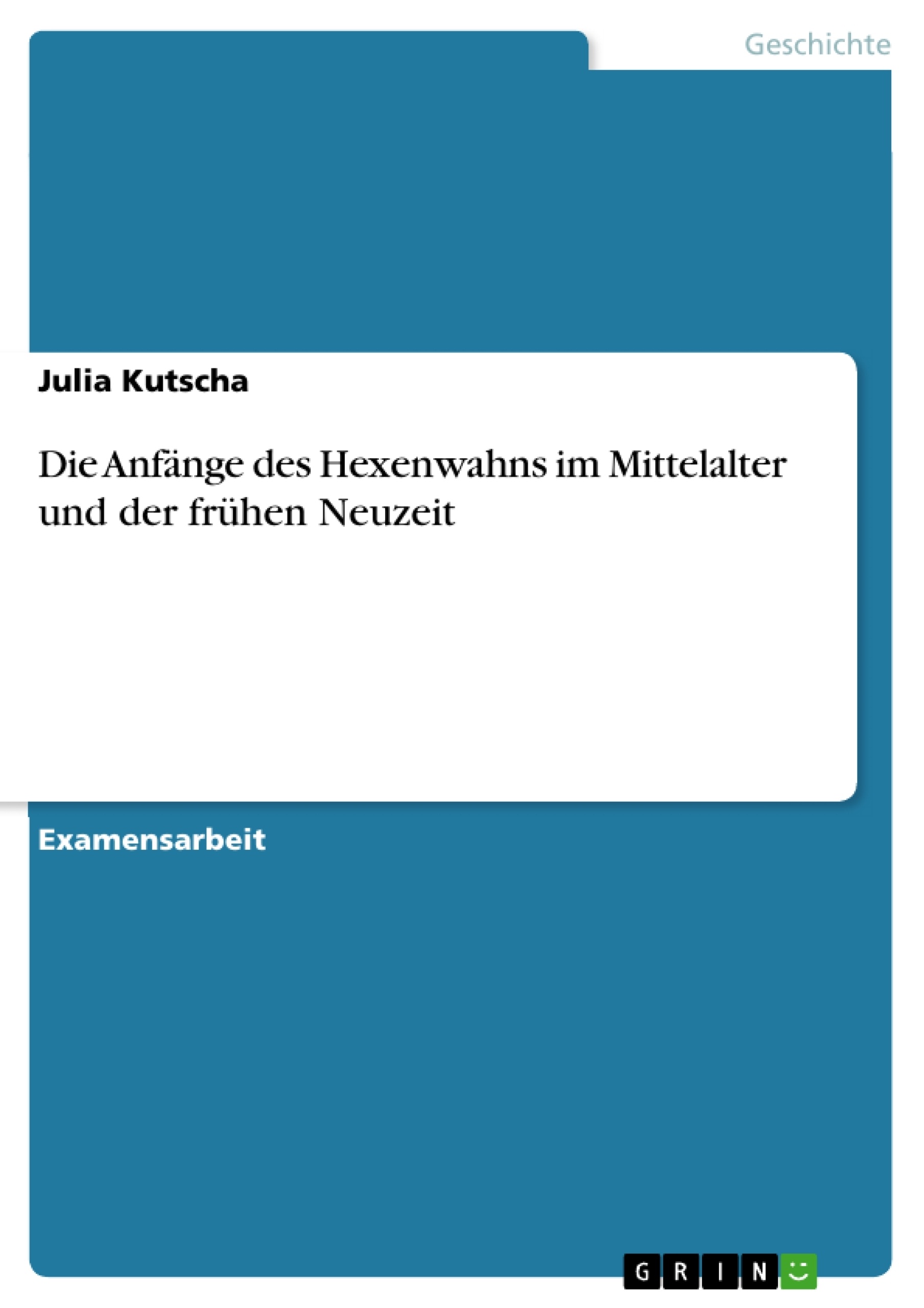Die Vorstellung der Einflussnahme durch Zauberei auf den Alltag, beeinflusste das Denken und Handeln vieler Europäer im Mittelalter. Magische Praktiken wurden in unterschiedlichen sozialen Schichten und verschiedenen Berufsgruppen praktiziert. Ausgehend von der Magievorstellung der Antike, bildete sich im Mittelalter eine zunehmende Konkurrenz zwischen der christlichen Kirche und den heidnischen Glaubensvorstellungen des Volkes. So bestrafte die Kirche den heidnischen Aberglauben bis zum 11. Jahrhundert mit Kirchenbußen. Danach wurden die sogenannten Ketzer zunehmend mit dem Tod bestraft. Ab dem 13. Jahrhundert wandte die Kirche das Inquisitionsverfahren zur ihrer Ausrottung an.
Es kann ein Wandel des Volksglaubens und seiner magischen Elemente über Jahrhunderte hinweg festgestellt werden, der letztendlich in der Hervorbringung der ´Hexe´ uferte. Mit ihm wandelte sich das Bild der ´Zauberin´ zur ´Hexe´ und fand seinen Höhepunkt in den Hexenverfolgungen der Neuzeit. In der Fachliteratur werden unterschiedliche Gründe für die Verfolgungen aufgeführt.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird kurz auf den theoretischen Hintergrund der Hexenforschung eingegangen. Der Hexenwahn des Mittelalters und der frühen Neuzeit betraf alle gesellschaftlichen Bereiche. Angefangen vom alltäglichen Leben des Volkes, bis hin zur Politik des Staates und der Theologie der christlichen Kirche. Aus diesem Grund wurde das Forschungsinteresse in unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise der Geschichte, der Soziologie, der Anthropologie und der Psychologie, geweckt. Daraus ergeben sich Forschungskontroversen, auf die im Folgenden (Kap. 1.2) näher eingegangen wird.
Das Vorstellungsbild der Hexe entwickelte sich aus dem Zusammenwirken der magischen Volkskultur sowie der scholastischen Hexenlehre. Besonders in Krisenzeiten geraten Menschen, die das jeweilige Werte- und Normensystem einer Gesellschaft nicht beachten, in den Fokus und werden aufgrund ihrer Andersartigkeit ausgegrenzt. Die Entstehung des Hexenstereotyps wird, aufbauend auf der Definition des Begriffs ´Hexe´ im Kapitel 1.3, näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Hintergrund
- Die Entwicklung des Forschungsdiskurses
- Die Forschungskontroversen
- Die Entstehung des Hexenstereotyps
- Magie als Voraussetzung für die Entstehung des Hexenwahns
- Antike Ursprünge der Hexereivorstellungen
- Die germanisch-keltischen Einflüsse
- Die griechisch-römische Weltanschauung
- Das frühe Christentum
- Die dualistische Magie des Mittelalters
- Antike Ursprünge der Hexereivorstellungen
- Die magische Praxis
- Der Zauberspruch
- Die Zauberbücher und das Ritual
- Der Bildzauber und der Liebeszauber
- Die Wahrsagerei
- Die Magie in Verbindung mit der Bibel und der Kirche
- Der Beginn der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit
- Die Voraussetzungen für die Anfänge der Hexenverfolgung
- Die kleine Eiszeit'
- Der Pakt mit dem Teufel
- Die Verbindung zwischen Ketzern und Hexen
- Das Verhältnis des Staates und der Kirche zur Magie
- Die Entwicklung der Rechtsvorschriften
- Die Inquisition
- Der Beginn der Verfolgungen
- Die Voraussetzungen für die Anfänge der Hexenverfolgung
- Der Malleus Maleficarum - Der Hexenhammer
- Der Autor Heinrich Kramer
- Die Hexenlehre des Hexenhammers
- Die Auslösung des Hexenwahns durch die Rezeption des Hexenhammers
- Die Frauenfeindlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Anfängen des Hexenwahns im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Sie untersucht die Entstehung des Hexenstereotyps, die Rolle der Magie und den Einfluss der Kirche auf die Entwicklung der Hexenverfolgungen.
- Die Entwicklung des Hexenstereotyps und die Bedeutung von Magie im Volksglauben
- Die Rolle der Kirche und die Entstehung der Hexenverfolgung
- Der Einfluss des Malleus Maleficarum auf die Hexenverfolgungen
- Die gesellschaftlichen und kulturellen Ursachen des Hexenwahns
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet den theoretischen Hintergrund der Hexenforschung, wobei die Entwicklung des Forschungsdiskurses und die Kontroversen innerhalb der Fachdisziplin behandelt werden. Kapitel 2 befasst sich mit der Magie als Voraussetzung für die Entstehung des Hexenwahns und untersucht die antiken Ursprünge der Hexereivorstellungen. Kapitel 3 beschreibt verschiedene magische Praktiken und beleuchtet die Rolle der Magie in Verbindung mit der Bibel und der Kirche. Kapitel 4 analysiert den Beginn der Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit, die Voraussetzungen und das Verhältnis von Staat und Kirche zur Magie. Kapitel 5 befasst sich mit der Hexenlehre des Malleus Maleficarum und seiner Bedeutung für die Entwicklung der Hexenverfolgungen.
Schlüsselwörter
Hexenwahn, Hexenverfolgung, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Magie, Hexenstereotyp, Kirche, Malleus Maleficarum, Volksglaube, Inquisition.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „Hexenhammer“ (Malleus Maleficarum)?
Es handelt sich um ein im 15. Jahrhundert von Heinrich Kramer verfasstes Werk, das die theoretische Grundlage für die systematische Hexenverfolgung bildete.
Welchen Einfluss hatte die Kirche auf den Hexenwahn?
Die Kirche bekämpfte heidnischen Aberglauben zunächst mit Bußen, ging aber ab dem 13. Jahrhundert durch die Inquisition massiv gegen angebliche Ketzer und Hexen vor.
Was ist die „Kleine Eiszeit“ im Kontext der Hexenverfolgung?
Klimatische Verschlechterungen führten zu Missernten und Not, woraufhin die Bevölkerung Sündenböcke suchte, was den Hexenwahn in Krisenzeiten befeuerte.
Wie entwickelte sich das Bild der „Zauberin“ zur „Hexe“?
Durch das Zusammenwirken von Volksglauben und scholastischer Lehre wandelte sich die Vorstellung von einfacher Magie hin zum gefährlichen Pakt mit dem Teufel.
Welche Rolle spielte die Frauenfeindlichkeit im Hexenwahn?
Besonders im Hexenhammer wurde ein stark frauenfeindliches Weltbild propagiert, das Frauen als anfälliger für die Verführungen des Teufels darstellte.
- Arbeit zitieren
- Julia Kutscha (Autor:in), 2010, Die Anfänge des Hexenwahns im Mittelalter und der frühen Neuzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262928