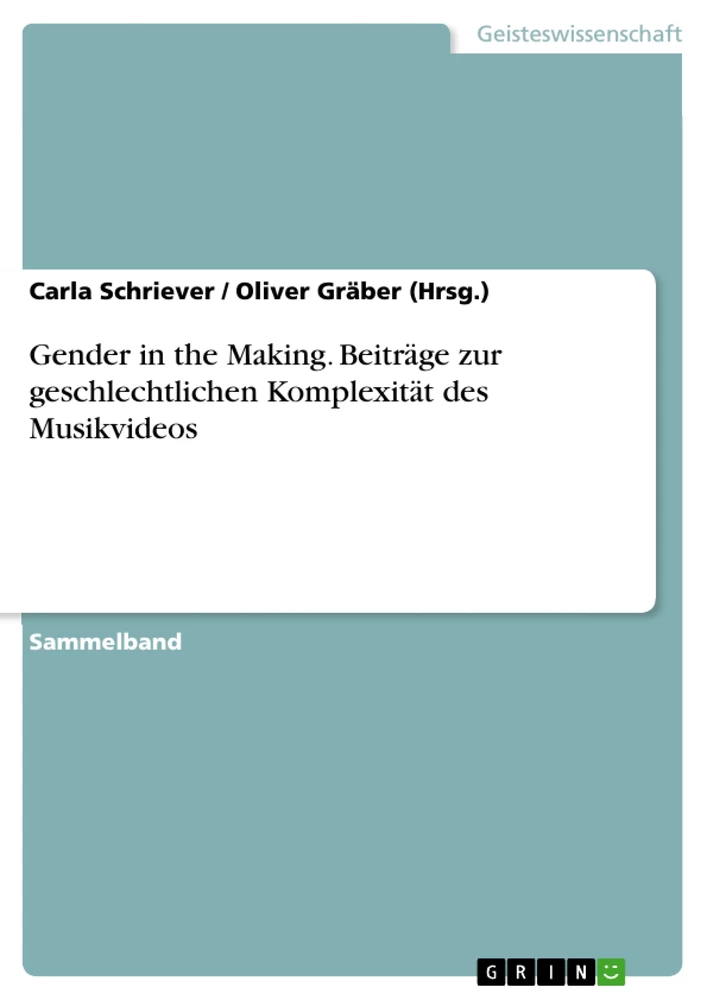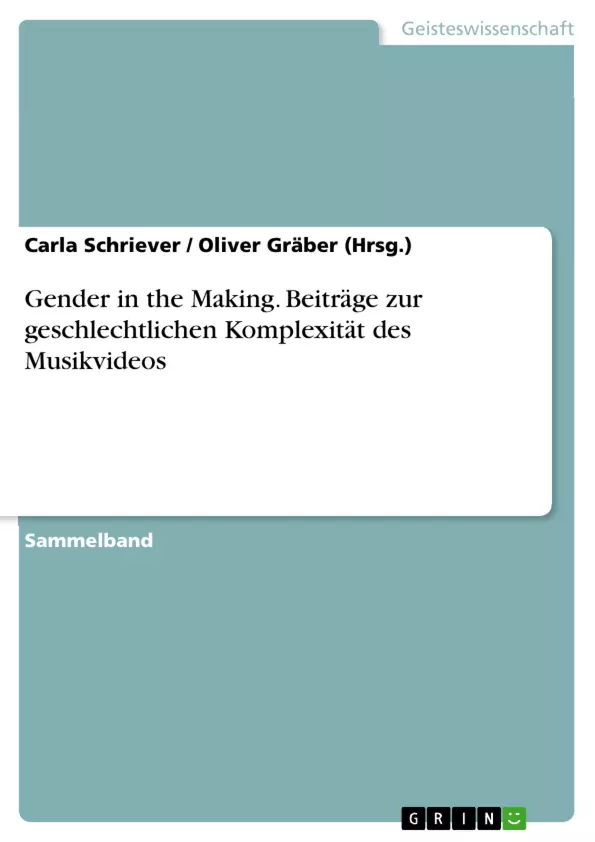Musikvideos lassen sich als Miniaturen der gesellschaftlichen Praxis beschreiben. In einer intermedialen Zeit, die durch Smartphones und den allumfassenden Zugriff auf das Internet den Musikvideos eine Omnipräsenz ermöglicht, ist die Begegnung mit dieser Form des „Werbe-Kurzfilms“ kaum vermeidbar.
Im philosophischen Diskurs spielen Musikvideos oft eine bloß untergeordnete Rolle und gelten nur selten als potentieller Gegenstand einer konstruktiven Auseinandersetzung. Daher gibt es über das Phänomen des Musikvideos, verglichen mit anderen Formen des medialen Ausdrucks, vergleichbar wenig wissenschaftliche Literatur. Doch wenn man berücksichtigt, dass Musikvideos, wie andere Medien auch, Zeichen und Text (ergo Sprache und Bild) repräsentieren, bleibt offen, warum es im interdisziplinären Diskurs bisher so stiefmütterlich behandelt wurde bzw. wird.
Dabei bleibt häufig unberücksichtigt, dass Musikvideos als gesellschaftsreflektierendes Moment zu betrachten sind.
Diese Kurzfilme sprechen einen Konsumentenkreis an, der von anderen Formen medialer Präsenz kaum erreicht wird und ermöglichen selbst im Vorbeigehen eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme von Inhalten. So beschreibt Leibesteter , dass Musikvideos in einem „Nebenbei“ konsumiert werden können. Sie sind oftmals einfach gestaltet und aufgrund ihrer Kürze erfordern sie nicht zu viel Aufmerksamkeit von ihren Konsumenten. Entgegen Leibetseder’s Auffassung ist zu sagen, dass gerade nachdem ehemalige Musiksender, ihre Formate mit Werbung für Klingeltöne und Soap Operas füllen, weniger Raum bleibt, Musikvideos unbewusst zu konsumieren. Die Mehrzahl der heutigen Rezipienten, suchen bewusst nach Videos, z.B. über Internetplattformen. Dabei entsteht eine viel bewusstere Wahrnehmung als auch ein viel bewussterer Prozess des Sehens von Videos. Musikvideos prägen die Gesellschaft seit den frühen 80er Jahren. Seit dieser Zeit haben sie in einer bestimmten Weise einen umfassenden, gesellschaftsprägenden Einfluss. Bestand der damalige Anspruch, wir erinnern uns zum Beispiel an die Videos von Michael Jackson, insbesondere darin eine möglichst komplexe Geschichte mit einem speziellen Song zu illustrieren, so lässt sich von diesem Anspruch heute kaum noch etwas erkennen. Die auf schrille Farben, schnelle Bildwechsel und skandal-heischend Nacktheit ausgelegten Clips, untermalen die inhaltsleeren Texte und schaffen damit ein Bild das sich als Reflexion der Schnelllebigkeit unserer Zeit verstehen lässt...
Inhaltsverzeichnis
- I. What you see, is what you get - Gender Repräsentationen im Musikvideo
- Warum tanzt der Mann? - Analyse der Beziehung und Vereinbarung von Tanz und Männlichkeit in Musikvideos: Timberlake, Jackson, Prince...
- Lobet den Herrn im Spitzenhöschen - Vermischung von Erotik und Religion im Musikvideo
- Was passiert wenn eine Boygroup erwachsen wird? Zur Entwicklung der Backstreet Boys
- II. Pour it on me - Sexualisierung und heteronormative Begehrungsmuster
- Bitches and Bottles - die Hypermaskulinisierung im Hip Hop Video
- Hypermasculinity in Rap Music
- Take me on stage - Wie Stars ihre Fans verführen...
- All night you can come - all day you can shop... Über LL Cool J als Objekt der Begierde im Hip Hop
- Das weibliche Begehren in Liedtexten und Musikvideos unter der Fragestellung: Gibt es einen weiblichen Blick und kann „Frau“ vollständig zum Subjekt werden?
- III. You wear it well - Zur Maskenhaftigkeit von Geschlechtszuschreibungen
- In short, what we wear matters - Versuche der Vermittlung zwischen Politik und Dragqueening
- Am I straight or gay? - Controversy Prince als Gender Dekonstruktivist
- Crossdressing als dekonstruktive Strategie der Geschlechterrepräsentation in Musikvideos
- Miley Cyrus, you should stop! Aneignung als soziales Privileg eines weißen Popfeminismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Beiträge dieses Bandes untersuchen die komplexe Darstellung von Gender in Musikvideos. Ziel ist es, die verschiedenen Strategien der Geschlechterrepräsentation zu analysieren und deren gesellschaftlichen Einfluss zu beleuchten. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Musikvideos als gesellschaftsreflektierendes Medium steht im Vordergrund.
- Gender-Repräsentationen in Musikvideos
- Sexualisierung und heteronormative Begehrungsmuster
- Maskenhaftigkeit von Geschlechtszuschreibungen
- Der Einfluss von Musikvideos auf die Gesellschaft
- Die Rolle von Musikvideos in der Konstruktion von Geschlechteridentitäten
Zusammenfassung der Kapitel
I. What you see, is what you get - Gender Repräsentationen im Musikvideo: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung von Gender in Musikvideos und analysiert, wie Geschlechterrollen konstruiert und präsentiert werden. Es untersucht verschiedene Beispiele, um die komplexen Beziehungen zwischen Tanz, Männlichkeit und Geschlechterrollen aufzuzeigen. Die Analyse umfasst die Vermischung von Erotik und Religion sowie die Entwicklung von Boygroups und deren Einfluss auf die Darstellung von Männlichkeit. Die Kapitel zeigen wie die visuelle Gestaltung und die Narrative der Videos die Geschlechterrollen und die Erwartungen an diese formen und beeinflussen.
II. Pour it on me - Sexualisierung und heteronormative Begehrungsmuster: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Sexualisierung und die heteronormativen Begehrungsmuster in Musikvideos, insbesondere im Kontext von Hip-Hop. Es untersucht die Hypermaskulinisierung und deren Auswirkungen auf die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Die Beiträge analysieren, wie Stars ihre Fans verführen und wie das weibliche Begehren in Liedtexten und Musikvideos dargestellt wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage nach dem "weiblichen Blick" und der Möglichkeit für Frauen, vollständig zum Subjekt zu werden.
III. You wear it well - Zur Maskenhaftigkeit von Geschlechtszuschreibungen: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Maskenhaftigkeit von Geschlechtszuschreibungen in Musikvideos. Es untersucht die Versuche, Politik und Dragqueening zu vermitteln, und analysiert die Figur von Prince als Gender-Dekonstruktivist. Die dekonstruktiven Strategien der Geschlechterrepräsentation durch Crossdressing werden ebenso beleuchtet wie die Aneignung von Popfeminismus als soziales Privileg. Die Kapitel untersuchen, wie Musikvideos Geschlechtsidentitäten konstruieren und hinterfragen und die komplexen Möglichkeiten der Geschlechterzuschreibungen in der Visualität von Musikvideos analysieren.
Schlüsselwörter
Musikvideo, Gender, Geschlechterrollen, Sexualisierung, Heteronormativität, Hypermaskulinisierung, Geschlechterrepräsentation, Dragqueening, Popfeminismus, Identitätskonstruktion, Medienanalyse, Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen zu: "What you see, is what you get - Gender Repräsentationen im Musikvideo"
Was ist der Gegenstand der Untersuchung in diesem Buch?
Das Buch analysiert die komplexe Darstellung von Gender in Musikvideos. Es untersucht verschiedene Strategien der Geschlechterrepräsentation und beleuchtet deren gesellschaftlichen Einfluss. Der Fokus liegt auf Musikvideos als gesellschaftsreflektierendes Medium.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Gender-Repräsentationen in Musikvideos, Sexualisierung und heteronormative Begehrungsmuster, die Maskenhaftigkeit von Geschlechtszuschreibungen, der Einfluss von Musikvideos auf die Gesellschaft und die Rolle von Musikvideos in der Konstruktion von Geschlechteridentitäten.
Welche Kapitel umfasst das Buch und worum geht es in ihnen?
Das Buch besteht aus drei Kapiteln: Kapitel I ("What you see, is what you get") befasst sich mit der Darstellung von Gender in Musikvideos und analysiert die Konstruktion von Geschlechterrollen anhand verschiedener Beispiele (Tanz und Männlichkeit, Erotik und Religion, Entwicklung von Boygroups). Kapitel II ("Pour it on me") konzentriert sich auf Sexualisierung und heteronormative Begehrungsmuster im Hip-Hop, Hypermaskulinisierung und das weibliche Begehren. Kapitel III ("You wear it well") untersucht die Maskenhaftigkeit von Geschlechtszuschreibungen, Dragqueening, Prince als Gender-Dekonstruktivist und die Aneignung von Popfeminismus.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse basiert auf der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Musikvideos als Medium. Es werden verschiedene Beispiele aus der Musikvideografie herangezogen und analysiert, um die komplexen Beziehungen zwischen visueller Gestaltung, Narrativen und der Konstruktion von Geschlechterrollen aufzuzeigen.
Welche Zielsetzung verfolgt das Buch?
Das Buch zielt darauf ab, die verschiedenen Strategien der Geschlechterrepräsentation in Musikvideos zu analysieren und deren gesellschaftlichen Einfluss zu beleuchten. Es soll ein tieferes Verständnis für die Rolle von Musikvideos in der Konstruktion und Darstellung von Geschlechteridentitäten schaffen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Musikvideo, Gender, Geschlechterrollen, Sexualisierung, Heteronormativität, Hypermaskulinisierung, Geschlechterrepräsentation, Dragqueening, Popfeminismus, Identitätskonstruktion, Medienanalyse, Gesellschaftskritik.
Für welche Zielgruppe ist das Buch gedacht?
Das Buch richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Gender Studies, Medienwissenschaft, Musikwissenschaft und Kulturwissenschaften befasst. Es eignet sich auch für alle Interessierten, die sich mit der Darstellung von Gender in populären Medien auseinandersetzen möchten.
- Citation du texte
- Carla Schriever (Auteur), Oliver Gräber (Hrsg.) (Auteur), 2013, Gender in the Making. Beiträge zur geschlechtlichen Komplexität des Musikvideos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262985