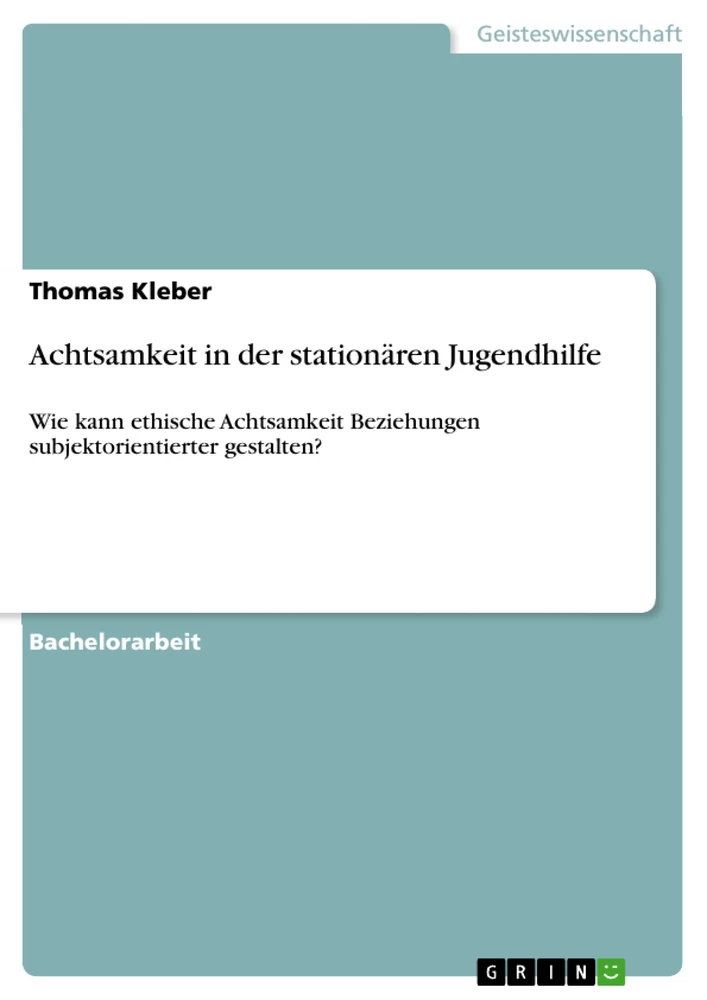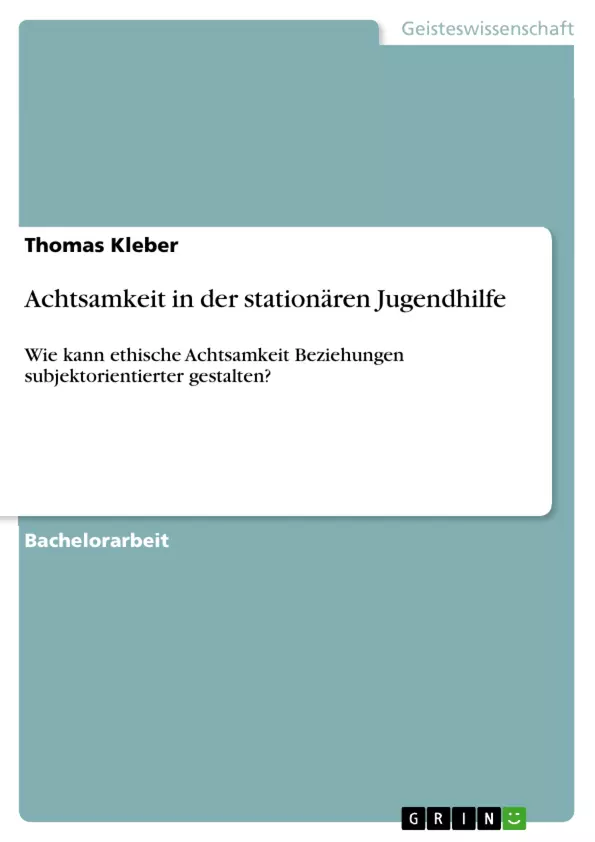Eingeforderte Achtsamkeit gilt in Hochglanzprospekten von Institutionen meist nur der Adressatenseite. Dabei ist ethische Achtsamkeit ohne Selbstsorge für Sozialarbeitende auf die Dauer nicht möglich. Vorliegendes Buch möchte Mut machen, sich neu als Akteur einer Praxisethik zu verstehen, die beide Seiten berücksichtigt und einfordert. Alle Beteiligten im Jugendhilfeprozess kommen hierfür aus ihrer Sicht zu Wort. Als Teamkonzept ist eine dauerhafte Verwirklichung achtsamer Praxis möglich und kann als ein Qualitätsmerkmal Sozialer Arbeit im stationären Alltag angewandt werden. Die differenzierte Ausarbeitung verschiedener Achtsamkeitsauffassungen möchte dazu beitragen über das Thema Achtsamkeit sprachfähiger zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Begriff der Achtsamkeit
- Achtsamkeit im Volksmund
- Achtsamkeit im Buddhismus und der Psychologie/Therapie (Mindfulness)
- Kritik
- Achtsamkeit als ethischer Begriff (Carefulness)
- Die Freiheit der Achtsamkeit
- Take Care (engl.)
- Achtsamkeit als Care und Resonanz
- Achtsamkeit zwischen Autonomie und Fremdbestimmung
- Achtsamkeit berücksichtigt Differenzen der Macht und der Möglichkeiten
- Zwischenstopp
- Subjektorientierung
- Du als Subjektorientierung
- Ich als Subjektorientierung
- Subjektorientierung als Bereitschaft zu teilen
- Subjektorientierung als Verständnissuche (Zuhören, um zu verstehen)
- Berufsethos- Berufswahl
- Stationäre Jugendhilfe als Diskursfeld
- Der Gesetzgeber
- SozialarbeiterInnen / ErzieherInnen
- Starke Kinder und Jugendliche mit Eigensinn
- Herkunftseltern
- Ungewöhnliche Gruppen
- Erschwerte Bedingungen
- Vernachlässigung und Trauma
- Beziehungen
- Beziehungsangebot der Postmoderne
- Rahmenbedingungen für Beziehungen in stationären Wohngruppen
- Nähe und Distanz
- Kommunikation
- Zwischenstopp
- Achtsamkeit als Teamkonzept
- Zusammenfassung
- Die Auswirkungen der Achtsamkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Achtsamkeit im Kontext der stationären Jugendhilfe. Ziel ist es, die Anwendbarkeit und Relevanz verschiedener Achtsamkeitskonzepte (Mindfulness und Carefulness) in diesem anspruchsvollen Arbeitsfeld zu beleuchten. Die Arbeit reflektiert die Herausforderungen und Chancen achtsamen Handelns im Umgang mit traumatisierten Jugendlichen und deren Bezugspersonen.
- Achtsamkeit als Mindfulness und Carefulness
- Herausforderungen achtsamen Handelns in der stationären Jugendhilfe
- Subjektorientierung und die Rolle des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin
- Beziehungen und Kommunikation in der stationären Jugendhilfe
- Achtsamkeit als Teamkonzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik der Achtsamkeit in der stationären Jugendhilfe ein. Sie veranschaulicht die Kluft zwischen dem Ideal achtsamen Daseins und der oft hektischen Realität in der Jugendhilfe. Mit einem Zitat von Tim Bendzko wird die Sehnsucht nach Achtsamkeit und echter Begegnung illustriert, die im Gegensatz zur schnelllebigen, oberflächlichen Moderne steht. Der Unterschied zwischen Mindfulness und Carefulness wird angedeutet, wobei die Arbeit betont, dass der meditationstechnische Ansatz von Mindfulness im Kontext der Jugendhilfe allein nicht ausreicht und eine ethische Perspektive (Carefulness) miteinbezogen werden muss. Die Bedeutung des Themas wird durch den hohen Stellenwert und die öffentlichen Erwartungen an die Jugendhilfe hervorgehoben, sowie die komplexen Herausforderungen für die MitarbeiterInnen, die mit hohen Erwartungen und schwierigen Klienten konfrontiert sind. Die Arbeit wird nicht als Vorwurf an die ErzieherInnen verstanden, sondern als Reflexionspunkt und Möglichkeit zur Verbesserung. Kohlbergs Theorie der Moralentwicklung wird als Grundlage für die Reflexion über die Möglichkeit der Entwicklung von Achtsamkeit im Team genannt.
Der Begriff der Achtsamkeit: Dieses Kapitel erörtert den Begriff der Achtsamkeit aus verschiedenen Perspektiven. Es wird zwischen dem umgangssprachlichen Verständnis, der buddhistischen Tradition (Mindfulness) und der ethischen Perspektive von Conradi (Carefulness) unterschieden. Die verschiedenen Aspekte werden ausführlich dargestellt und kritisch betrachtet. Der Fokus liegt auf den praktischen Anwendungsmöglichkeiten und den ethischen Implikationen in Bezug auf Machtstrukturen und asymmetrische Beziehungen. Der Gegensatz zwischen dem meditativen Ansatz von Mindfulness und dem ethischen Ansatz von Carefulness wird herausgearbeitet und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise im Kontext der stationären Jugendhilfe wird unterstrichen.
Achtsamkeit als ethischer Begriff (Carefulness): Dieses Kapitel vertieft die ethische Dimension von Achtsamkeit, basierend auf Elisabeth Conradis Konzept von Carefulness. Im Gegensatz zu Mindfulness, das vor allem auf Selbstreflexion und Bewusstwerdung ausgerichtet ist, konzentriert sich Carefulness auf den achtsamen Umgang mit Menschen in asymmetrischen Beziehungen, wie sie in der Jugendhilfe häufig vorkommen. Die Aspekte Freiheit, Verantwortung, Nähe und Distanz in solchen Beziehungen werden analysiert. Besonders wird die Bedeutung von Achtsamkeit angesichts von Machtdifferenzen und unterschiedlichen Möglichkeiten hervorgehoben. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, den Kontext und die besonderen Bedürfnisse der Klienten in der Jugendhilfe zu berücksichtigen, und entwickelt eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen von traditionellen Achtsamkeitskonzepten im Umgang mit schwierigen sozialen Beziehungen.
Subjektorientierung: Dieses Kapitel behandelt den wichtigen Aspekt der Subjektorientierung in der Jugendhilfe. Es betrachtet sowohl die Subjektorientierung der betreuten Jugendlichen als auch der MitarbeiterInnen. Es analysiert die Bedeutung der Bereitschaft zum Teilen und der Verständnissuche als Basis achtsamer Beziehungen. Der Fokus liegt auf dem Zuhören mit dem Ziel zu verstehen und die Perspektive des Gegenübers einzunehmen. Der Zusammenhang zur Achtsamkeit wird deutlich gemacht: Nur durch eine konsequente Subjektorientierung kann eine authentische und achtsame Beziehung aufgebaut werden. Die Fähigkeit zum Zuhören und Verstehen wird als grundlegend für eine gelingende Arbeit in der Jugendhilfe angesehen.
Stationäre Jugendhilfe als Diskursfeld: Dieses Kapitel beleuchtet die stationäre Jugendhilfe als komplexes Feld unterschiedlicher Perspektiven und Interessen. Es analysiert den Einfluss des Gesetzgebers, die Rolle der SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen, die Herausforderungen im Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen, sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern. Die verschiedenen AkteurInnen und deren Sichtweisen werden beleuchtet. Die Komplexität der Situation und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise werden deutlich gemacht. Die Kapitel analysiert sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die alltäglichen Herausforderungen im Umgang mit schwierigen Kindern und Jugendlichen.
Erschwerte Bedingungen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die erschwerten Bedingungen, unter denen sowohl die Jugendlichen als auch die MitarbeiterInnen in der stationären Jugendhilfe arbeiten. Der Schwerpunkt liegt auf den Folgen von Vernachlässigung und Trauma bei den Jugendlichen. Die besonderen Herausforderungen, die dies für die Arbeit mit den Kindern mit sich bringt, werden ausführlich betrachtet. Das Kapitel verdeutlicht die Notwendigkeit eines sensiblen und achtsamen Umgangs mit traumatisierten Jugendlichen.
Beziehungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Bedeutung von Beziehungen in der stationären Jugendhilfe. Es analysiert das Beziehungsangebot der Postmoderne und die Rahmenbedingungen für Beziehungen in stationären Wohngruppen. Die Aspekte Nähe, Distanz und Kommunikation werden ausführlich erörtert. Das Kapitel betont die Notwendigkeit von authentischen und achtsamen Beziehungen als Grundlage für eine gelingende Hilfeplanung. Die Bedeutung von klarer Kommunikation und der Fähigkeit, Nähe und Distanz angemessen zu gestalten, werden hervorgehoben.
Achtsamkeit als Teamkonzept: Dieses Kapitel untersucht Achtsamkeit als ein Konzept, das über die einzelne Person hinausgeht und sich auf das gesamte Team erstreckt. Es wird analysiert, wie Achtsamkeit in Teams entwickelt und umgesetzt werden kann und welche Bedeutung die Selbstachtsamkeit für die MitarbeiterInnen hat. Die Bedeutung von Reflexionsprozessen und der Fähigkeit zur Distanzierung von der Bezugsgruppe im Sinne Kohlbergs werden als Voraussetzung für kritisches Denken und achtsames Handeln genannt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Achtsamkeit in der stationären Jugendhilfe
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff der Achtsamkeit im Kontext der stationären Jugendhilfe. Sie beleuchtet die Anwendbarkeit und Relevanz verschiedener Achtsamkeitskonzepte (Mindfulness und Carefulness) und reflektiert Herausforderungen und Chancen achtsamen Handelns im Umgang mit traumatisierten Jugendlichen und deren Bezugspersonen.
Welche Achtsamkeitskonzepte werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Mindfulness (achtsames Sein im buddhistischen Sinne) und Carefulness (achtsamer Umgang mit anderen, besonders in asymmetrischen Beziehungen). Sie argumentiert, dass Mindfulness allein im Kontext der Jugendhilfe nicht ausreicht und Carefulness eine wichtige ethische Ergänzung darstellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die Anwendbarkeit und Relevanz von Achtsamkeitskonzepten in der stationären Jugendhilfe zu beleuchten. Die Arbeit soll dazu beitragen, achtsames Handeln in diesem anspruchsvollen Arbeitsfeld zu fördern und die Herausforderungen und Chancen zu reflektieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt u.a. Achtsamkeit als Mindfulness und Carefulness, Herausforderungen achtsamen Handelns, Subjektorientierung der Mitarbeiter und Jugendlichen, Beziehungen und Kommunikation in der stationären Jugendhilfe und Achtsamkeit als Teamkonzept.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einführung, zum Begriff der Achtsamkeit (inkl. Kritik), Achtsamkeit als ethischer Begriff (Carefulness), Subjektorientierung, der stationären Jugendhilfe als Diskursfeld, erschwerten Bedingungen (Vernachlässigung, Trauma), Beziehungen, und Achtsamkeit als Teamkonzept. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Rolle spielt die Subjektorientierung?
Subjektorientierung, sowohl der Jugendlichen als auch der Mitarbeiter, ist zentral. Die Bereitschaft zum Teilen und die Verständnissuche (Zuhören, um zu verstehen) werden als Basis achtsamer Beziehungen hervorgehoben.
Welche Bedeutung haben Beziehungen in der stationären Jugendhilfe?
Beziehungen sind zentral. Die Arbeit analysiert das Beziehungsangebot der Postmoderne, Rahmenbedingungen in Wohngruppen, Nähe und Distanz, und Kommunikation. Authentische und achtsame Beziehungen sind Grundlage für gelingende Hilfeplanung.
Wie wird Achtsamkeit als Teamkonzept verstanden?
Achtsamkeit wird als Teamkonzept betrachtet, das über die einzelne Person hinausgeht. Es wird analysiert, wie Achtsamkeit in Teams entwickelt und umgesetzt werden kann, inkl. der Bedeutung von Selbstachtsamkeit und Reflexionsprozessen.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Kluft zwischen dem Ideal achtsamen Daseins und der hektischen Realität, den Umgang mit traumatisierten Jugendlichen, die Komplexität der Beziehungen und die Herausforderungen der Zusammenarbeit im Team. Die erschwerten Bedingungen für sowohl die Jugendlichen als auch die MitarbeiterInnen werden berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit schlussfolgert, dass ein umfassendes Verständnis von Achtsamkeit, welches sowohl Mindfulness als auch Carefulness integriert, für die stationäre Jugendhilfe unerlässlich ist. Sie betont die Bedeutung von Subjektorientierung, achtsamer Beziehungsgestaltung und der Entwicklung von Achtsamkeit als Teamkonzept.
- Quote paper
- Thomas Kleber (Author), 2013, Achtsamkeit in der stationären Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263026