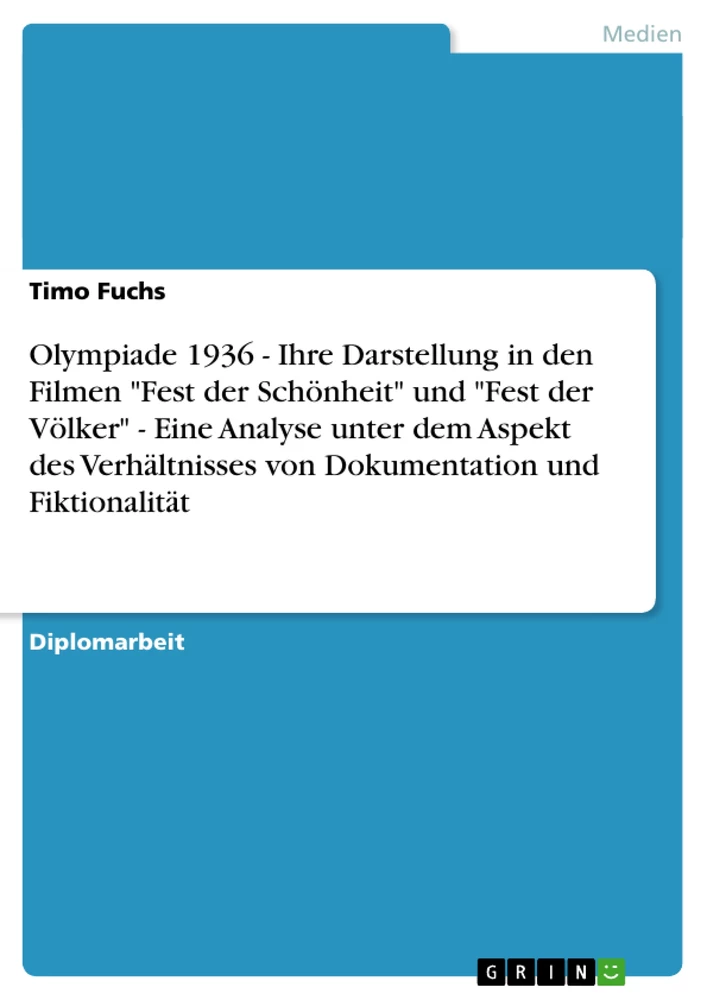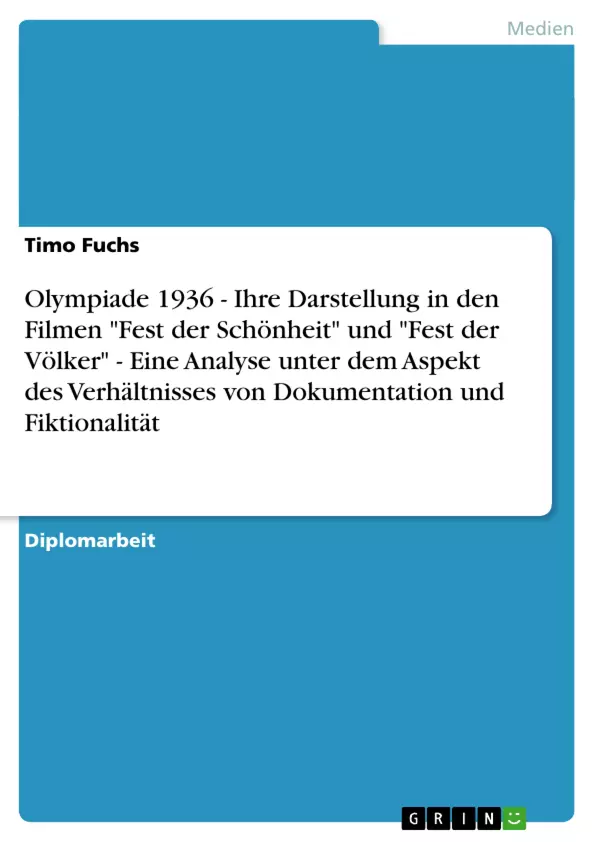Die Regisseurin Leni Riefenstahl erhält den Auftrag, die XI. Olympischen Spiele im Jahre 1936, das Weltereignis in Berlin, filmisch zu dokumentieren. Für sie selbst soll „Olympia – Der Film von den XI. Olympischen Spielen in Berlin“ der Höhepunkt ihre Karriere werden. Der erst zwei Jahre nach den Spielen uraufgeführte Dokumentarfilm erregte seit seiner Veröffentlichung großes Aufsehen – während des „Dritten Reichs“ als Musterbeispiel der Filmkunst, nach 1945 vor allem als gefährlicher Träger einer subtilen NS-Ideologie.
In dieser Arbeit soll dem Propaganda-Vorwurf nicht ausführlich nachgegangen werden. Vielmehr zeigt die hier angestellte Untersuchung Grundlagen für eine propagandistische Wirkung auf, in dem sie die Struktur des Films mit der Frage analysiert, an welchen Stellen das Werk den rein berichtenden Modus verlässt und eine aktive gestalterische Darstellung vornimmt. Die vorliegende Arbeit beleuchtet den Erzählmodus von „Olympia“. Wie er funktioniert und zu welcher Wahrnehmung des Rezipienten dieser führt, soll im Hauptteil erörtert werden. Die Grundlage dieser Frage ist die Untersuchung der dokumentarischen und der fiktionalen Struktur des Films: An welchen Stellen beeinflussen fiktionale Elemente auf welche Weise den dokumentarischen Charakter des Films? Dazu werde ich drei Abschnitte des Films analysieren: Den ersten Prolog sowie die Disziplin des Marathonlaufs, beide aus dem ersten Teil, „Fest der Völker“ sowie die Sequenz des Kunst- und Turmspringens aus „Fest der Schönheit“.
Wichtig für diese Analyse ist der Blick auf den (film-)historischen Kontext der Olympiade 1936. Ihre filmische Dokumentation ist vor allem auch mit den Maßstäben der damaligen Zeit zu bewerten, die für die Herstellung eines Dokumentarfilms und seine Beeinflussung durch fiktionale Elemente galten. Daher werde ich zunächst eine Darstellung des Verständnisses von Dokumentarismus und Fiktionalität in den 30er Jahren anführen, die sich aus den ersten Jahren des Films nach 1886 ableitet.
An den filmhistorischen Überblick schließt ein Abriss über die Konzeption, Planung und Durchführung des „Olympia“-Films an. Seine Entstehungsgeschichte soll die Ansätze Riefenstahls zur Verwendung von Dokumentarismus und Fiktionalität bei diesem Projekt aufzeigen. Darauf folgt die detaillierte Untersuchung und deren Auswertung zu den dokumentarischen und fiktionalen Strukturen des Films.
Inhaltsverzeichnis
- Olympia 1936: Ihre Darstellung in den Filmen „Fest der Völker“ und „Fest der Schönheit“
- Erster Film von den Olympischen Spielen Berlin 1936
- Olympia - Fest der Völker
- Gestaltung: Leni Riefenstahl
- Analyse des Verhältnisses von Dokumentation und Fiktionalität
- Olympischer Film-Kurier
- Olympia - Fest der Schönheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin durch die beiden Filme "Fest der Völker" und "Fest der Schönheit" von Leni Riefenstahl. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Verhältnisses von Dokumentation und Fiktionalität in den Filmen und der Frage, inwieweit Riefenstahl die Spiele für die Propagandazwecke des NS-Regimes instrumentalisierte.
- Die Inszenierung der Spiele durch Leni Riefenstahl
- Die Verknüpfung von Sport und Propaganda
- Die Rolle des Films als Propagandainstrument
- Die Darstellung der Olympischen Spiele im Kontext des Nationalsozialismus
- Die Rezeption der Filme im In- und Ausland
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Entstehung der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin und dem politischen Kontext, in dem die Spiele stattfanden. Es beleuchtet die Rolle des Nationalsozialismus und die propagandistische Instrumentalisierung der Spiele.
- Das zweite Kapitel analysiert den Film "Fest der Völker" von Leni Riefenstahl. Es untersucht die Inszenierung der Spiele, die Kameraführung, die Musik und die verwendeten filmischen Mittel, um die ideologische Botschaft des Films zu transportieren.
- Das dritte Kapitel widmet sich dem Film "Fest der Schönheit". Es betrachtet die Darstellung der Sportlerinnen und Sportler, die Inszenierung der einzelnen Disziplinen und die Verknüpfung von ästhetischen und propagandistischen Elementen.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rezeption der beiden Filme im In- und Ausland. Es beleuchtet die Kritik an den Filmen und die unterschiedlichen Perspektiven auf Riefenstahls Werk.
Schlüsselwörter
Olympische Spiele, Berlin 1936, Leni Riefenstahl, Propaganda, Nationalsozialismus, Dokumentation, Fiktionalität, Sport, Ästhetik, Rezeption, Film, "Fest der Völker", "Fest der Schönheit".
- Citation du texte
- Timo Fuchs (Auteur), 2004, Olympiade 1936 - Ihre Darstellung in den Filmen "Fest der Schönheit" und "Fest der Völker" - Eine Analyse unter dem Aspekt des Verhältnisses von Dokumentation und Fiktionalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26316