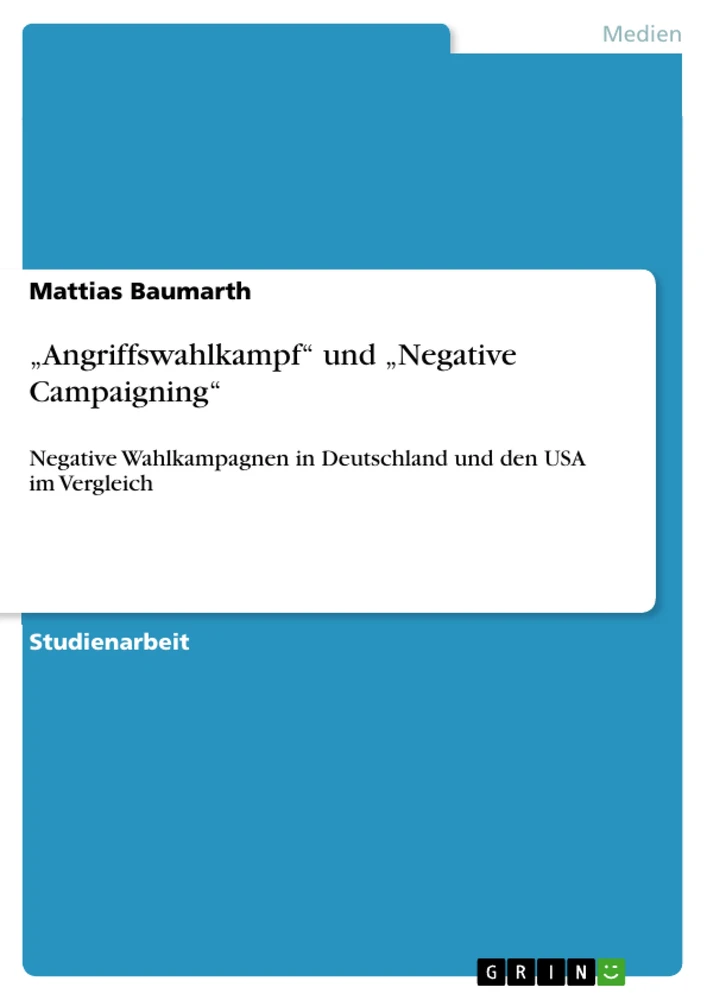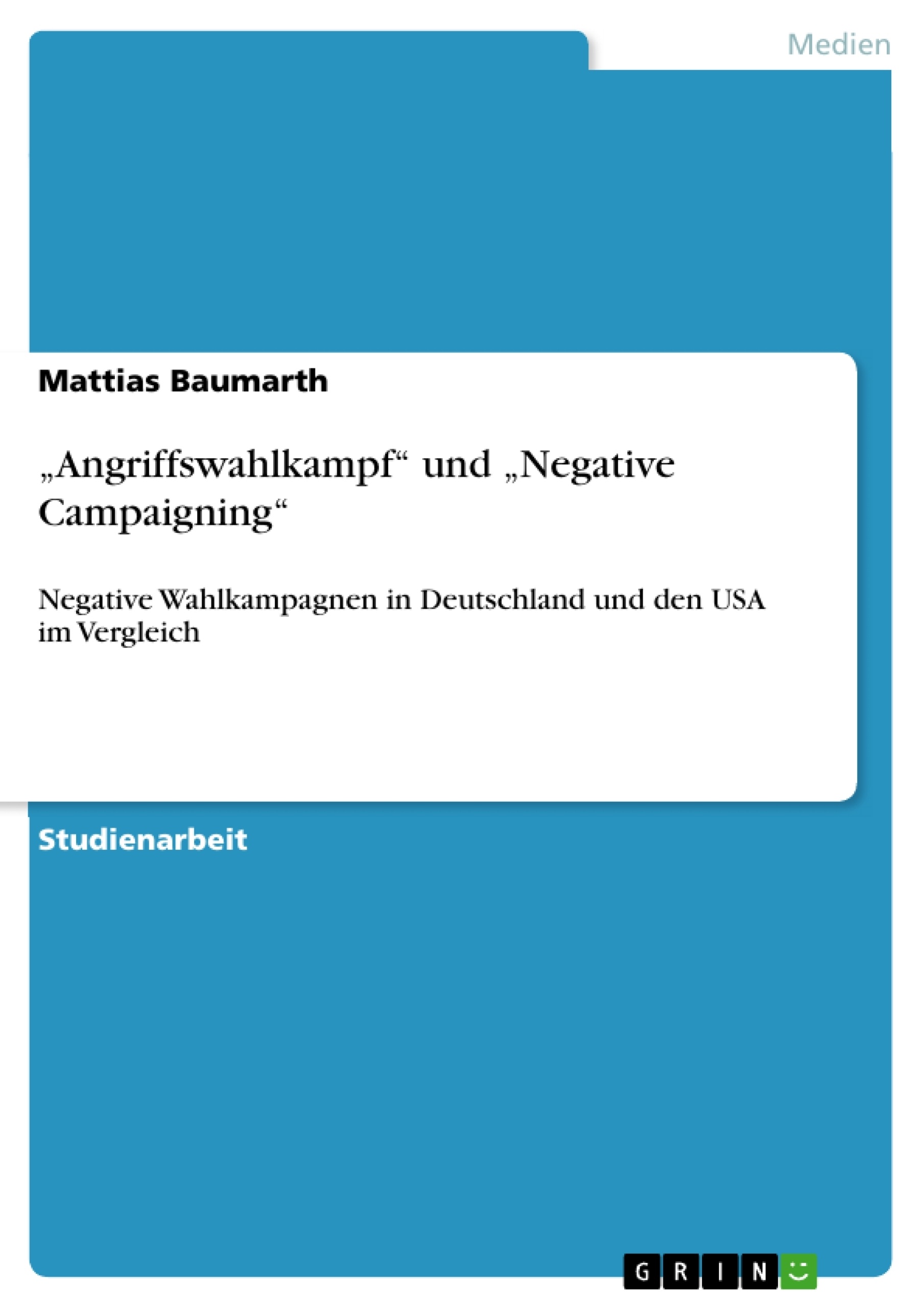In den USA hat Negative Campaigning, das Wahlkampfmittel, welches in erster Linie das Ziel hat den politischen Gegner zu diskreditieren, einen festen Platz in Forschung und Praxis. Schon sehr früh begann sich die amerikanische Kommunikationswissenschaft für das Thema zu interessieren und zudem gehört das Negative Campaigning zum Standardrepertoire der Wahlkämpfer in fast jedem Wahlkampf – vom lokalen Wettstreit um den Platz im Schulkomitee bis hin zum Rennen um die Präsidentschaft.
In Deutschland hingegen wird der „Angriffswahlkampf“, wie das gleiche Phänomen hier oft genannt wird, geradezu stiefmütterlich behandelt. Die Forschung hat sich bis dato kaum mit der Thematik befasst und die Wahlkämpfer scheinen vergleichsweise zögerlich den politischen Gegner direkt anzugreifen. Immer wieder ist in der öffentlichen Diskussion zu hören, Negative Campaigning sei gefährlich, da grundsätzlich ein „Bumerangeffekt“, also das Zurückschlagen auf den Urheber der Negativkampagne zu erwarten sei1.
Tatsächlich ist das Negative Campaigning in deutschen Wahlkämpfen deutlich weniger verbreitet als in den USA. Die Frage, die sich stellt, lautet demnach: Warum wird Negative Campaining in Deutschland seltener eingesetzt als in den Vereinigten Staaten? Ist das politische System, bzw. das Parteiensystem verantwortlich? Sind die Unterschiede im Mediensystem entscheidend? Oder ist es eine Folge der unterschiedlichen politischen Kultur?
Die vorliegende Arbeit wird auf Grundlage der bisherigen Forschung untersuchen, ob manche dieser Hypothesen für wahrscheinlicher gehalten werden können als andere. Ziel soll es sein, eine Aussage darüber treffen zu können, welche der Hypothesen in Zukunft einer genaueren empirischen Untersuchung unterzogen werden sollten.
Zu diesem Zweck wird im ersten Teil zunächst geklärt was Negative Campaigning überhaupt ist und wie stark es in beiden Ländern eingesetzt wird. Außerdem werden die bisherigen Forschungsergebnisse zur Frage inwieweit es sich um ein effektives Wahlkampfmittel handelt dargestellt.
Im Zeiten Teil werden zunächst kurz die Unterschiede zwischen den beiden Staaten hinsichtlich politischem System, Mediensystem und politischer Kultur erläutert. Gleichzeitig steht dann die Frage im Vordergrund inwieweit sich diese Unterschiede (möglicherweise) auf den Einsatz des Negative Campaingning (im Folgenden als „NC“ bezeichnet) auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Negative Wahlkampagnen – eine Bestandsaufnahme
- I.I. Was ist „Negative Campaigning“?
- 1.2. Folgen des „Negative Campaigning“?
- 1.3. Häufigkeit von „Negative Campaigning“
- Entwicklung in den USA
- Entwicklung in Deutschland
- 1.4. Wie effektiv ist „Negative Campaigning“?
- 2. Unterschiedliche Rahmenbedingungen – unterschiedliche Wahlkämpfe?
- 2.1. Politisches System
- 2.2. Mediensystem
- 2.3. Politische Kultur
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedliche Bewertung und Anwendung von „Negative Campaigning“ in Deutschland und den USA. Es soll geklärt werden, warum das Wahlkampfmittel in den USA deutlich verbreiteter ist und als effektiver gilt, während es in Deutschland vergleichsweise selten eingesetzt wird. Die Arbeit analysiert die Unterschiede in den politischen Systemen, Mediensystemen und politischen Kulturen der beiden Länder und überprüft, inwiefern diese Unterschiede die Nutzung von „Negative Campaigning“ beeinflussen.
- Unterschiede in der Bewertung und Anwendung von „Negative Campaigning“ in Deutschland und den USA
- Analyse der Rolle des politischen Systems und des Parteiensystems
- Einfluss des Mediensystems auf die Verbreitung von „Negative Campaigning“
- Bedeutung der politischen Kultur und ihre Auswirkungen auf Wahlkampfstile
- Vergleichende Untersuchung der Wirksamkeit von „Negative Campaigning“ in beiden Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz der Untersuchung dar. Sie beschreibt die unterschiedliche Bedeutung des „Negative Campaigning“ in Deutschland und den USA und führt die wichtigsten Forschungsziele aus.
- I. Negative Wahlkampagnen – eine Bestandsaufnahme: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von „Negative Campaigning“, seinen Folgen, der Häufigkeit seines Einsatzes in Deutschland und den USA sowie seiner Effektivität. Es beleuchtet die Entwicklung des „Negative Campaigning“ in beiden Ländern und stellt die Ergebnisse bisheriger Forschung dar.
- 2. Unterschiedliche Rahmenbedingungen – unterschiedliche Wahlkämpfe?: Dieses Kapitel beleuchtet die Unterschiede in den politischen Systemen, Mediensystemen und politischen Kulturen von Deutschland und den USA. Es untersucht, inwiefern diese Unterschiede die Nutzung von „Negative Campaigning“ beeinflussen könnten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Negative Campaigning, Angriffswahlkampf, politische Kommunikation, Wahlkampfstrategien, politische Kultur, Mediensystem, Parteiensystem, USA, Deutschland, Vergleichende Analyse.
Was versteht man unter "Negative Campaigning"?
Es handelt sich um ein Wahlkampfmittel, das primär darauf abzielt, den politischen Gegner zu diskreditieren, anstatt nur eigene Positionen darzustellen.
Warum wird Negative Campaigning in Deutschland seltener eingesetzt als in den USA?
Gründe liegen in den unterschiedlichen politischen Systemen, den Mediensystemen sowie der politischen Kultur, die in Deutschland Angriffe oft als riskanter ansieht.
Was ist der sogenannte "Bumerangeffekt"?
Der Bumerangeffekt beschreibt das Risiko, dass eine negative Kampagne negativ auf den Urheber selbst zurückfällt und dessen Ansehen schadet.
Ist Negative Campaigning effektiv?
In den USA gilt es als Standardrepertoire und oft als effektiv; in Deutschland wird die Wirksamkeit aufgrund der anderen politischen Rahmenbedingungen skeptischer beurteilt.
Welchen Einfluss hat das Parteiensystem auf den Wahlkampfstil?
Das deutsche Mehrparteiensystem erfordert oft Koalitionen, was zu einer mäßigeren Rhetorik führen kann, während das US-Zweiparteiensystem direktere Konfrontationen begünstigt.