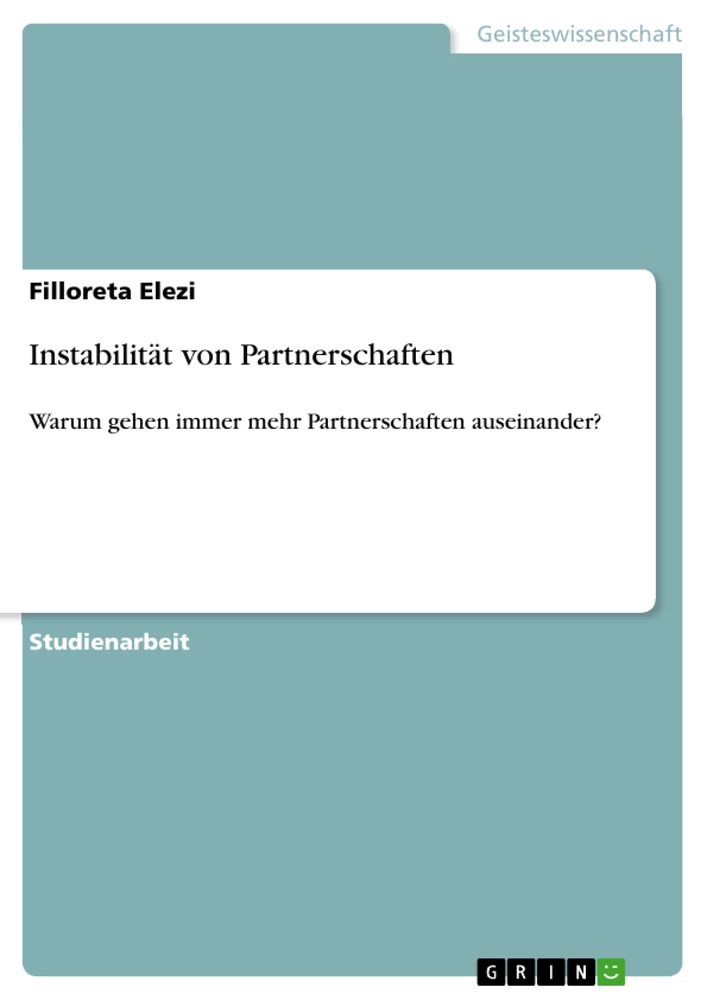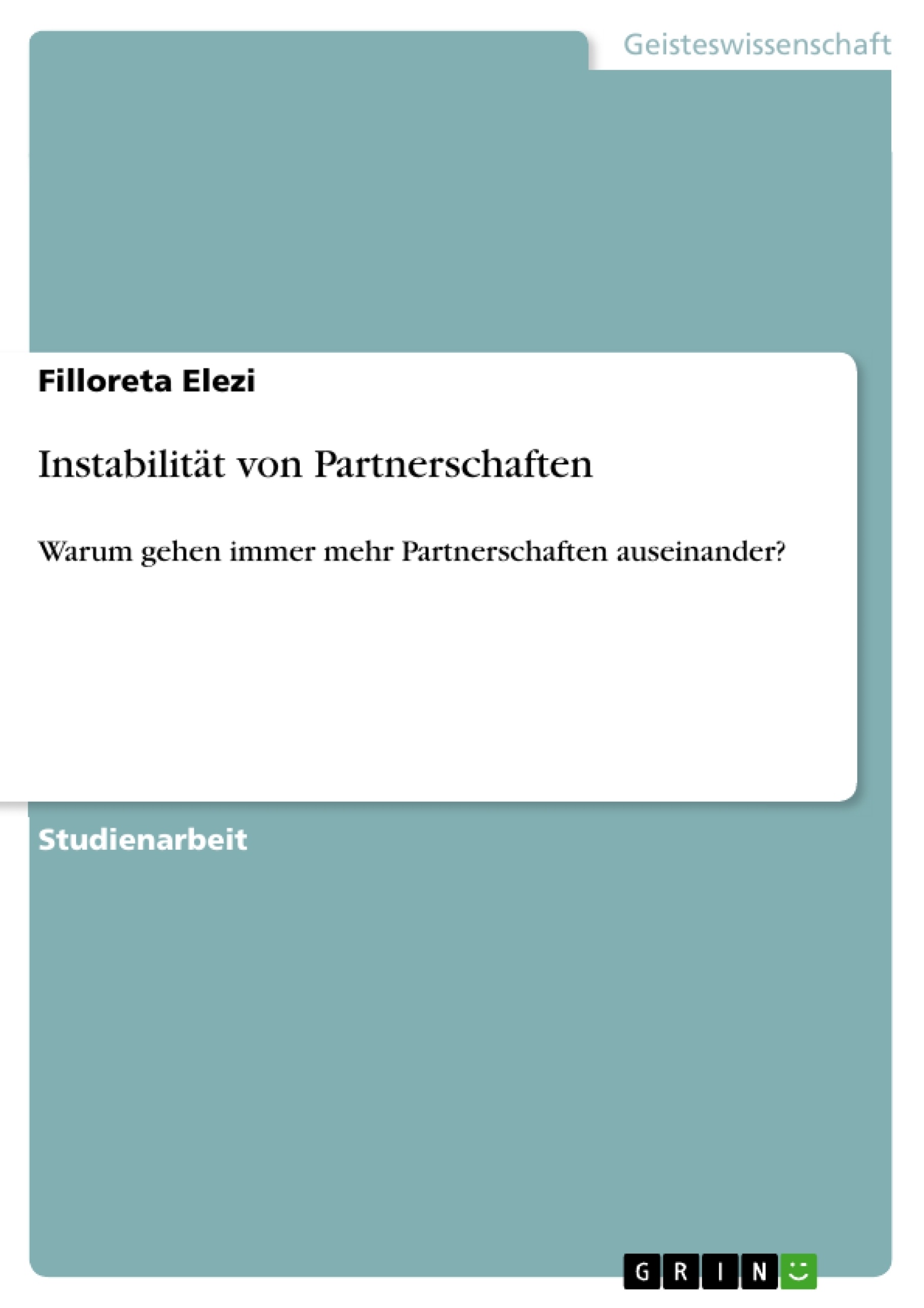In Deutschland beklagt man sich über die geringe Geburtenrate. Im Jahr 2011 lag diese bei 1,37 Kinder pro Frau. Trotz eines leichten Anstiegs, kann der Bevölkerungsschwund nicht gebremst werden, dafür wären mindestens 1,6 Kinder pro Frau nötig. So schreitet der demographische Wandel weiter voran, doch welche Faktoren bewirken die geringe Geburtenrate?
In einer Forsa-Studie, wurde in einem Zeitraum vom 17. November bis 3. Dezember 2010, 1.012 Personen befragt. Ganze 66% äußerten den Wunsch "auf jeden Fall" oder "vielleich" Kinder zu bekommen. Der Kinderwunsch ist also bei der Mehrheit noch existent. Dann stellt sich aber die Frage, wieso sie diesen Wunsch nicht umsetzen.
Bei 44% fehlt dazu einfach noch der passende Partner und über 60% begründen die geringe Geburtenrate aufgrund der zurückgegangenen Haltbarkeit von Partnerschaften und Ehen. Somit spielt die Instabilität von Partnerschaften beim demografischen Wandel eine wichtige Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Daten und Fakten zu Partnerschaften in Deutschland
- Überblick über Einflussfaktoren für die Stabilität von Partnerschaften
- Miterlebte Scheidungen
- Gemeinsamkeiten als wichtiger Faktor
- Arbeitsteilung
- Gewohnheit oder Ritual?
- Untreue
- Einfluss der Persönlichkeit auf die Stabilität von Partnerschaften
- Big Five
- Die vier Liebestypen
- Einfluss des Konfliktverhaltens auf die Stabilität von Partnerschaften
- Konflikte konstruktiv bewältigen
- Prozess des Verzeihens
- Belastungen des Alltags als Gefährdung von Partnerschaften
- Der Job als Beziehungskiller
- Der Alltagsstress
- Unterstützungssysteme für gefährdete Partnerschaften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Instabilität von Partnerschaften in Deutschland. Sie beleuchtet die Faktoren, die zur geringen Geburtenrate beitragen, und die Bedeutung stabiler Beziehungen für die Gesellschaft und den Staat.
- Die aktuelle Lage von Partnerschaften in Deutschland
- Einflussfaktoren auf die Stabilität von Partnerschaften
- Die Rolle von Persönlichkeit und Konfliktverhalten
- Alltagsprobleme und ihre Auswirkungen auf Beziehungen
- Unterstützungssysteme für gefährdete Partnerschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung der geringen Geburtenrate in Deutschland und die Bedeutung stabiler Partnerschaften in diesem Kontext. Das zweite Kapitel analysiert Daten und Fakten zu Partnerschaften in Deutschland, basierend auf der Studie "Pairfam", und betrachtet verschiedene Aspekte wie Partnerschaftszufriedenheit und Konflikthäufigkeit.
Kapitel drei untersucht verschiedene Einflussfaktoren, die die Stabilität von Partnerschaften beeinträchtigen können, wie zum Beispiel die Erfahrung einer Scheidung in der eigenen Kindheit, die Bedeutung von Gemeinsamkeiten, Arbeitsteilung und die Auswirkungen von Untreue.
Schlüsselwörter
Partnerschaftsstabilität, Geburtenrate, demographischer Wandel, Scheidung, "Pairfam"-Studie, Persönlichkeit, Konfliktverhalten, Alltagsprobleme, Unterstützungssysteme, Konfliktlösung, Vergebung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Geburtenrate in Deutschland ein zentrales Thema?
Mit einer Rate von ca. 1,37 Kindern pro Frau (Stand 2011) liegt Deutschland unter dem für den Bevölkerungserhalt notwendigen Wert von 1,6, was den demografischen Wandel beschleunigt.
Welchen Einfluss hat die Instabilität von Partnerschaften auf den Kinderwunsch?
Laut Studien begründen über 60 % der Befragten die geringe Geburtenrate mit der abgenommenen Haltbarkeit von Ehen und Partnerschaften; viele finden zudem keinen passenden Partner.
Welche Faktoren gefährden die Stabilität einer Beziehung?
Zu den untersuchten Faktoren gehören miterlebte Scheidungen der Eltern, mangelnde Gemeinsamkeiten, unfaire Arbeitsteilung, Untreue und Alltagsstress.
Wie beeinflusst die Persönlichkeit die Partnerschaft?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der "Big Five" Persönlichkeitsmerkmale sowie die Einteilung in verschiedene Liebestypen auf die Beständigkeit von Beziehungen.
Gilt der Beruf als "Beziehungskiller"?
Ja, berufliche Belastungen und der damit verbundene Stress werden in der Analyse als signifikante Gefährdungen für das partnerschaftliche Zusammenleben identifiziert.
Was hilft bei gefährdeten Partnerschaften?
Die Arbeit nennt konstruktive Konfliktbewältigung, den Prozess des Verzeihens sowie externe Unterstützungssysteme als Möglichkeiten zur Stabilisierung.
- Quote paper
- Filloreta Elezi (Author), 2013, Instabilität von Partnerschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263256