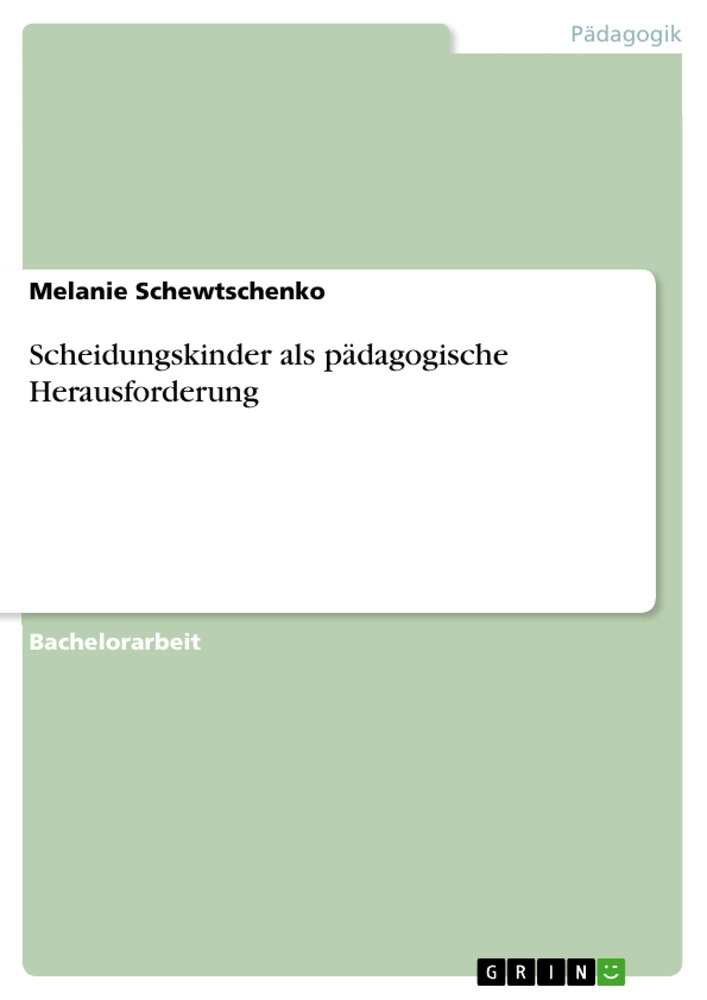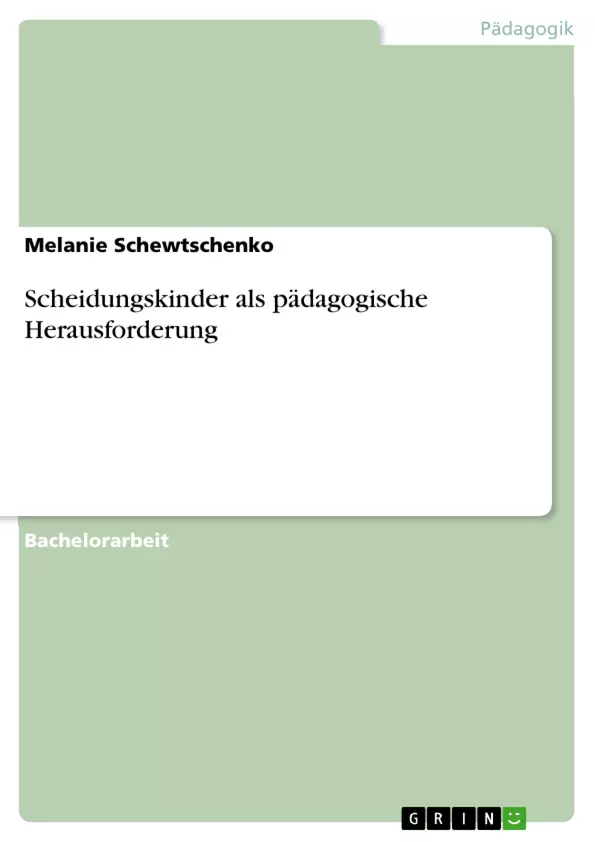Trennung und Scheidung stellen einen drastischen Schnitt im Leben von Paaren, Eltern und deren Kinder dar. Obwohl es heutzutage nicht mehr ungewöhnlich ist, sich von seinem Lebenspartner scheiden zu lassen, löst eine solche Trennung immer noch eine hohe emotionale Betroffenheit aus, insbesondere dann, wenn Kinder mit im Spiel sind. Diese werden dann auch immer die Last einer Entwicklung tragen, an der sie am wenigsten Schuld haben. Für eine gesunde Entwicklung braucht das Kind eine funktionierende Familie, die ihm Liebe, Wärme und ein soziales Umfeld der Geborgenheit schenkt. Mit der Scheidung der Eltern zerbricht diese Struktur und das Kind verliert Ordnung und Halt in seiner Welt.Genau aus diesem Grunde ist Scheidung auch ein vieldiskutiertes und bleibend aktuelles Thema. Die Entwicklung der Scheidungszahlen steigt nach wie vor in die Höhe und somit natürlich auch die Zahl betroffener Kinder. Diese werden meist unfreiwillig, völlig unvorbereitet mit der Scheidung konfrontiert und in den elterlichen Konflikt mit einbezogen. Aufgrund ihres Entwicklungsstandes besitzen sie nur bedingt kognitive Verarbeitungsmöglichkeiten und sehen die veränderte Lebenslage aus ihrem kindeseigenen Blickwinkel, welcher sich naturgemäß von dem der Erwachsenen deutlich unterscheidet. Die Frage, wie Kinder mit solch einem einschneidenten Ereignis umgehen und welche Folgen sich daraus für sie ergeben, hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und weiter an Aktualität gewonnen. Wie erleben Kinder eine Scheidung? Welche Faktoren haben Einfluss auf die Verarbeitung und den Umgang mit der elterlichen Trennung? Reagieren Jungen etwa anders als Mädchen? Welche Handlungsmöglichkeiten hat hier die Pädagogik und wo kann sie wie ansetzten? . Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, muss man zunächst einmal die Komplexität dieses Trennung- und Scheidungsprozesses erkennen. Ich habe in meiner Arbeit versucht, einen kleinen Einblick in dieses vielschichtige Thema zu geben und dabei die wichtigsten Aspekte herauszuarbeiten. Mein besonderes Augenmerk lege ich hierbei, wie der Titel meiner Arbeit schon auch aussagt, auf die pädagogische Praxis und die Frage, wie wir als Pädagogen den betroffenen Kindern Hilfe und Unterstützung in dieser für sie außergewöhnlich schwierigen Situation geben können.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Pädagogik und Scheidung
- 1. Zielformulierung der Pädagogik
- 2. Was ist Persönlichkeit und wie entwickelt sie sich?
- 3. Wechselwirkungen zwischen Persönlichkeit und Umwelt
- 4. Persönlichkeitsmodell (Fünf-Faktoren-Modell)
- C. Scheidung als Phänomen
- 5. Was ist Scheidung?
- 5.1 Statistische Daten zu Scheidungssituation und Relevanz der Problematik
- 6. Kindliches Erleben der Scheidung
- 6.1.Scheidungszyklus
- 6.1.1 Vorscheidungsphase
- 6.1.2 Scheidungsphase
- 6.1.3 Nachscheidungsphase
- 6.2 Faktoren, die das Scheidungserleben beeinflussen
- 6.2.1 Mutter-Kind-Beziehung
- 6.2.2 Beziehung zum Vater
- 6.2.3 Stieffamilie
- 6.2.4 Geschwisterbeziehung
- 6.2.5 Großeltern und Verwandte
- 7. Reaktionen und Auswirkungen der Scheidung
- 7.1. Altersspezifisch
- 7.1.1. Säuglinge und Kleinkinder
- 7.1.2. Vorschulkinder
- 7.1.3. Schulkinder
- 7.2. Geschlechtsspezifisch
- 7.3. Auswirkungen auf Schule und Lernen
- 8. Folgen der Scheidung für das Kind
- 8.1. Aggressionsprobleme
- 8.2. Selbstwertprobleme
- 8.3. Geschlechtsidentitätsprobleme
- 8.4. Positive Folgen der Scheidung
- D. Praxis und pädagogische Schlussfolgerungen
- 9. Soziale Unterstützung der Scheidungskinder in Tageseinrichtungen
- 9.1. Verhaltensänderungen bei den Kindern wahrnehmen
- 9.2. Das Konzept der sozialen Unterstützung
- 9.3. Erzieherin-Kind-Beziehung
- 9.4. Peerkontakte
- 10. Handlungsmöglichkeiten der Pädagogik
- 10.1 Pädagogische Unterstützung und Hilfe
- 10.2 Ausdrucksmöglichkeiten von Gefühlen durch Malen und Gestalten
- 10.3 Beratung von Eltern für den Umgang mit den Kindern
- 11. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Auswirkungen von Scheidung auf Kinder im Hinblick auf die pädagogische Praxis zu untersuchen. Sie beleuchtet die Komplexität der Scheidungserfahrung, die psychologischen Folgen für Kinder und die Rolle der Pädagogik in der Unterstützung und Begleitung dieser Kinder.
- Die Entwicklung der Persönlichkeit im Kontext von Scheidung
- Das kindliche Erleben der Scheidung und die Einflussfaktoren auf seine Verarbeitung
- Die Reaktionen und Auswirkungen der Scheidung auf Kinder in unterschiedlichen Altersstufen und geschlechtsspezifischen Kontexten
- Die Folgen der Scheidung für die Entwicklung des Kindes, einschließlich Verhaltensänderungen und möglicher Probleme
- Die Rolle der Pädagogik in der sozialen Unterstützung und Begleitung von Scheidungskindern in pädagogischen Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema Scheidungskinder in den Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung und betont die Bedeutung der Unterstützung für diese Kinder. Sie führt die Problematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
B. Pädagogik und Scheidung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Persönlichkeit und deren Entwicklung, mit dem Einfluss der Umwelt und dem Fünf-Faktoren-Modell. Es beleuchtet das Ziel der Pädagogik im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung.
C. Scheidung als Phänomen: Dieses Kapitel behandelt die statistischen Daten zur Scheidungssituation in Deutschland, erläutert das kindliche Erleben der Scheidung und die verschiedenen Phasen des Scheidungsprozesses. Es beschreibt die Einflussfaktoren auf das Scheidungserleben des Kindes und untersucht die alters- und geschlechtsspezifischen Reaktionen und Auswirkungen. Es beleuchtet außerdem die Folgen der Scheidung für Schule und Lernen sowie die langfristigen Folgen für die Entwicklung des Kindes.
D. Praxis und pädagogische Schlussfolgerungen: Dieses Kapitel fokussiert auf die pädagogische Praxis und die soziale Unterstützung von Scheidungskindern in Tageseinrichtungen. Es beleuchtet die Rolle der pädagogischen Fachkraft, die Erkennung von Verhaltensänderungen und die Bedeutung der Erzieherin-Kind-Beziehung. Es werden Handlungsmöglichkeiten der Pädagogik aufgezeigt, wie beispielsweise die Unterstützung des emotionalen Ausdrucks durch Malen und Gestalten und die Beratung von Eltern.
Schlüsselwörter
Scheidung, Scheidungskinder, Persönlichkeitsentwicklung, Pädagogik, soziale Unterstützung, Tageseinrichtungen, Erzieherin-Kind-Beziehung, Verhaltensänderungen, Handlungsmöglichkeiten, Malen, Gestalten, Elternberatung.
- Arbeit zitieren
- Melanie Schewtschenko (Autor:in), 2012, Scheidungskinder als pädagogische Herausforderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263419