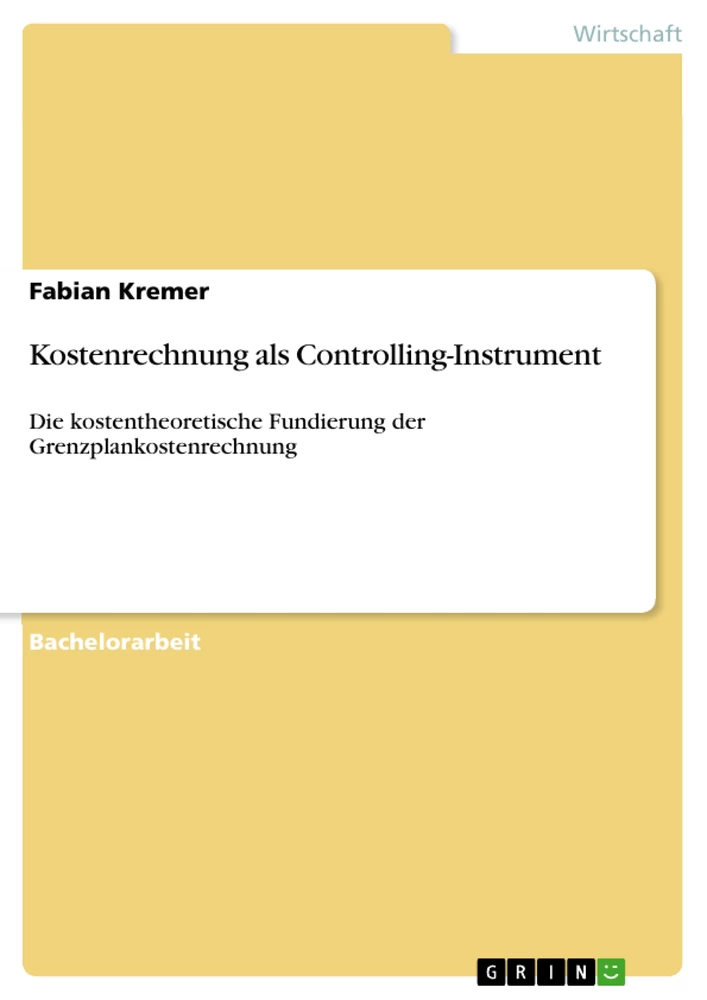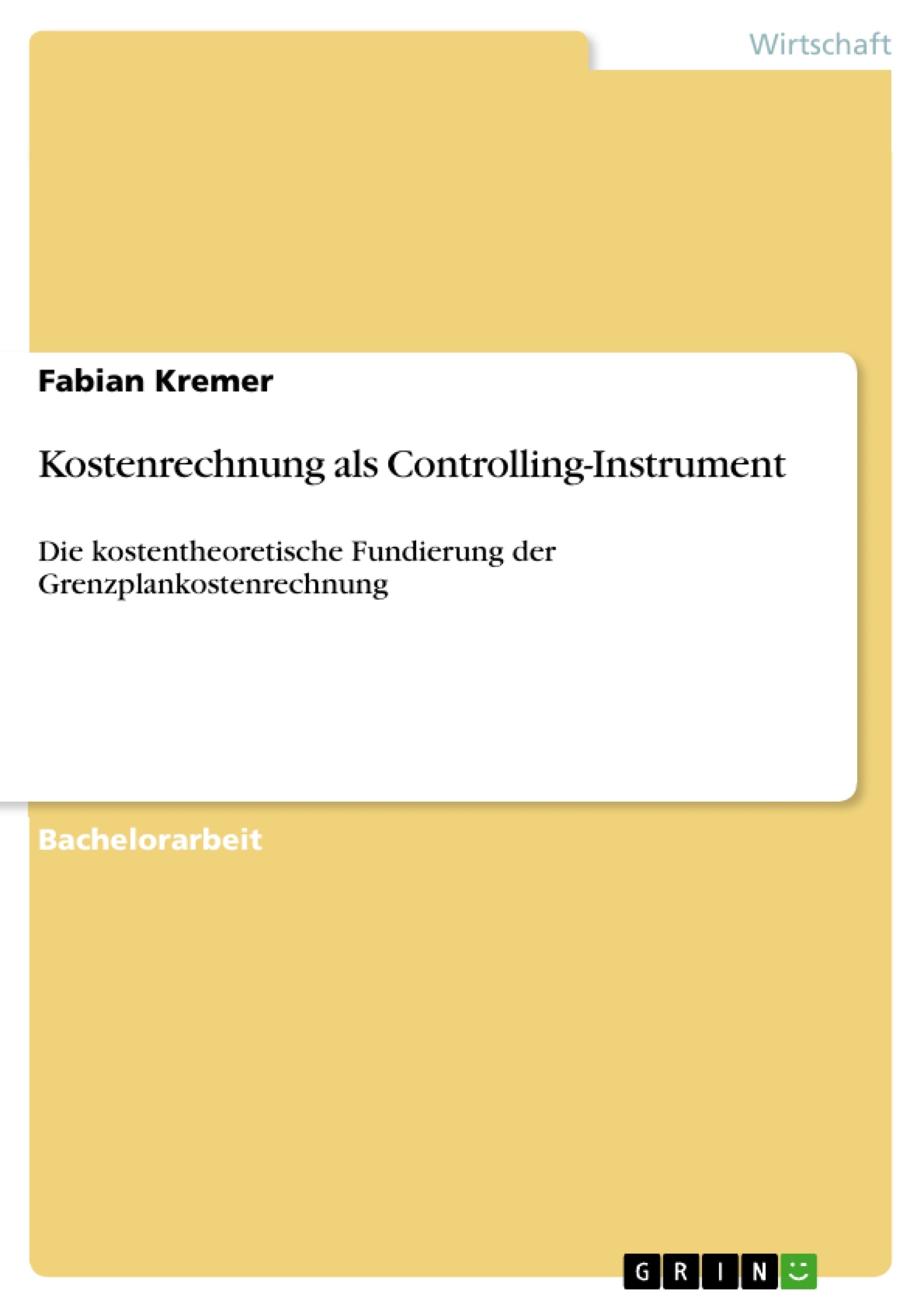Der Controlling-Praktiker besitzt in der heutigen, technisch hoch entwickelten Zeit eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich seine tägliche Arbeit durch die Nutzung von diversen Tools und Business-Intelligence Software zu erleichtern. Komplexe Berechnungen lassen sich in Sekundenschnelle lösen, Zusammenhänge können grafisch aufbereitet werden und das Speichern immenser Datenmengen ist möglich. Trotz der Entwicklung immer, angeblich neuer Funktionen in den einzelnen Programmen, darf hierbei nicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit hinter diesen Funktionen vergessen werden. Und genau hier ist die Aufgabe des Controllers anzusetzen. Um seiner Hauptaufgabe, der Koordination der betrieblichen Führungsebene, nachzugehen, ist das Verständnis hinter solchen Anwendungen essentiell. Auch weil er es ist, der die Schnittstellenprobleme, die durch den Einsatz der Software entstehen, lösen muss, ist ein umfassendes Verständnis der Systeme hinter der Software nötig. Bekanntestes Beispiel in Deutschland ist hierbei der Einsatz der SAP-Software mit ihrem Controlling-Modul CO. Da bestimmte Anwendungsfelder, etwa die strategische Planung oder die Investitionsrechnung, nicht ausreichend unterstützt werden, aber Fachfremde vielleicht doch verleitet sind die Software hierfür zu verwenden, muss der Controller als Experte für solche Fragen offen stehen. Das System, das größtenteils dem Modul CO der SAP-Software zugrundeliegt, ist das System der Grenzplankostenrechnung nach Wolfgang Kilger. Der Controller als Experte für das interne Rechnungswesen sollte die Prämissen dieses Systems kennen, seine Stärken, aber auch seine Schwächen im Vergleich zu anderen Kostenrechnungssystemen beurteilen können.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Grenzplankostenrechnung mit ihren Prämissen vorzustellen und im Hinblick auf die Kostentheorie zu betrachten. Dazu soll die Grenzplankostenrechnung zunächst in Kapitel 2 vorgestellt und eingeordnet, sowie ein Blick auf ihre Prämissen geworfen werden. Kapitel 3 beschäftigt sich anschließend mit den einzelnen Komponenten einer Grenzplankostenrechnung. In Kapitel 4 werden die Probleme, derer sich die Grenzplankostenrechnung gegenübersieht, genauer beleuchtet. Abschließend wird in Kapitel 5 das internationale Interesse an der Grenzplankostenrechnung betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Die Rolle der Grenzplankostenrechnung für den Controlling-Praktiker
- Grundlagen der Grenzplankostenrechnung
- Einordnung der Grenzplankostenrechnung in das System der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufgaben der Grenzplankostenrechnung
- Prämissen der Grenzplankostenrechnung
- Der verbrauchsorientierte Kostenbegriff
- Der Einfluss der Kostentheorie in der Grenzplankostenrechnung
- Kostenplanung und -kontrolle durch die Grenzplankostenrechnung
- Die Kostenartenrechnung zur Ermittlung der Einzel- und Gemeinkosten
- Die Kostenstellenrechnung zur Planung der Gemeinkosten
- Bezugsgrößenplanung in den Kostenstellen
- Möglichkeiten der Primärkostenrechnung
- Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung
- Die Kostenträgerstückrechnung
- Die Betriebsergebnisrechnung
- Kostenkontrolle durch Abweichungsanalysen
- Umsetzungsprobleme der Grenzplankostenrechnung
- Können Entscheidungen auf Basis der Grenzplankostenrechnung optimal sein?
- Untersuchung der Linearitätsprämisse im Hinblick auf die Kostentheorie
- Gemeinkostenverrechnung in der Prozesskostenrechnung und Grenzplankostenrechnung im Vergleich
- Kostenverrechnungsunterschiede der Grenzplankostenrechnung im Vergleich zum Rechnen mit relativen Einzelkosten
- Zunehmende internationale Beachtung der Grenzplankostenrechnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Grenzplankostenrechnung und analysiert ihre Bedeutung im Kontext der Kostentheorie. Ziel ist es, die Prämissen der Grenzplankostenrechnung aufzuzeigen und ihre Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen Kostenrechnungssystemen zu beurteilen.
- Einordnung der Grenzplankostenrechnung in das System der Kosten- und Leistungsrechnung
- Die Prämissen der Grenzplankostenrechnung
- Die Anwendung der Grenzplankostenrechnung in der Kostenplanung und -kontrolle
- Die Herausforderungen und Probleme der Grenzplankostenrechnung
- Die zunehmende internationale Bedeutung der Grenzplankostenrechnung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 führt in die Grundlagen der Grenzplankostenrechnung ein und ordnet sie im System der Kosten- und Leistungsrechnung ein. Es werden die Aufgaben und Prämissen der Grenzplankostenrechnung erläutert sowie der verbrauchsorientierte Kostenbegriff und der Einfluss der Kostentheorie auf die Grenzplankostenrechnung beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit der Anwendung der Grenzplankostenrechnung in der Kostenplanung und -kontrolle. Es werden die Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerstückrechnung und Betriebsergebnisrechnung im Kontext der Grenzplankostenrechnung dargestellt.
Kapitel 4 beleuchtet die Herausforderungen und Probleme der Grenzplankostenrechnung. Es werden die Optimierung von Entscheidungen, die Linearitätsprämisse, die Gemeinkostenverrechnung und die Unterschiede in der Kostenverrechnung im Vergleich zu anderen Methoden analysiert.
Schlüsselwörter
Grenzplankostenrechnung, Kostentheorie, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Planung, Kontrolle, Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerstückrechnung, Betriebsergebnisrechnung, Prozesskostenrechnung, Linearitätsprämisse, internationale Beachtung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grenzplankostenrechnung?
Die Grenzplankostenrechnung ist ein von Wolfgang Kilger entwickeltes System der Kostenrechnung, das vor allem auf der Trennung von fixen und variablen Kosten basiert und zur Planung sowie Kontrolle dient.
Warum ist dieses System für SAP-Anwender relevant?
Das Controlling-Modul (CO) der SAP-Software basiert in weiten Teilen auf den Prinzipien der Grenzplankostenrechnung, weshalb ein Verständnis des Systems für Controller essenziell ist.
Welche Aufgaben übernimmt ein Controller in diesem Zusammenhang?
Der Controller fungiert als Experte für das interne Rechnungswesen, löst Schnittstellenprobleme der Software und koordiniert die betriebliche Führungsebene auf Basis der Kostendaten.
Was sind die kritischen Prämissen der Grenzplankostenrechnung?
Eine zentrale Prämisse ist die Linearität der Kostenverläufe. Die Arbeit untersucht kritisch, inwieweit diese Annahmen in der modernen Kostentheorie Bestand haben.
Wie unterscheidet sich die Grenzplankostenrechnung von der Prozesskostenrechnung?
Die Arbeit vergleicht beide Systeme insbesondere im Hinblick auf die Verrechnung von Gemeinkosten und zeigt die jeweiligen Stärken und Schwächen auf.
Gibt es ein internationales Interesse an diesem deutschen System?
Ja, das Kapitel 5 der Arbeit beleuchtet die zunehmende internationale Beachtung, die der Grenzplankostenrechnung als präzises Controlling-Instrument geschenkt wird.
- Citation du texte
- Fabian Kremer (Auteur), 2013, Kostenrechnung als Controlling-Instrument, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263462