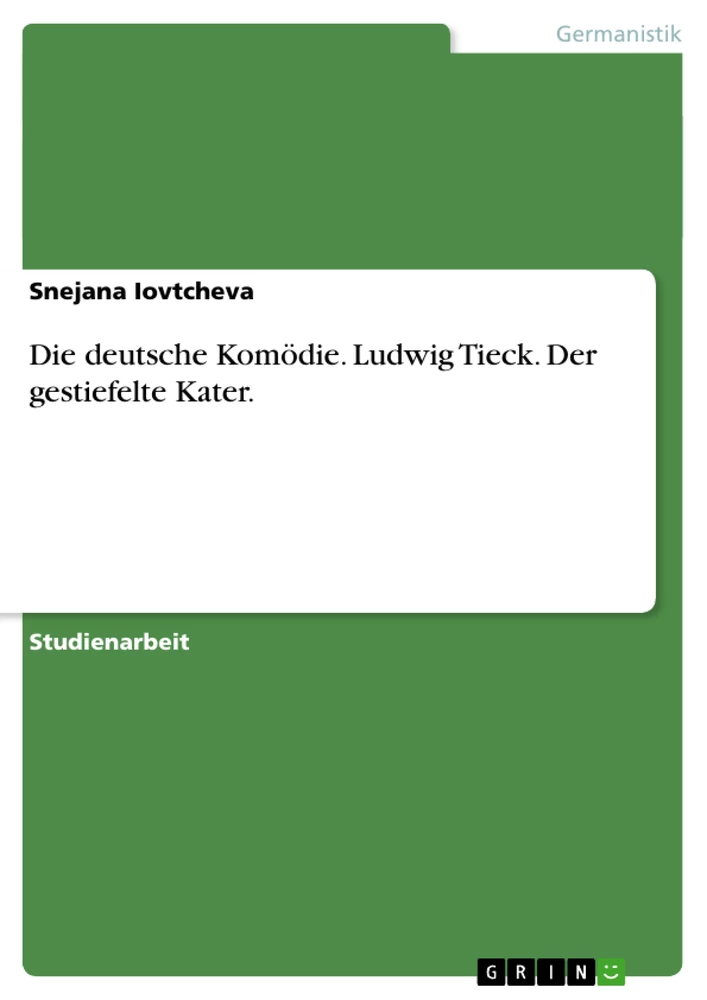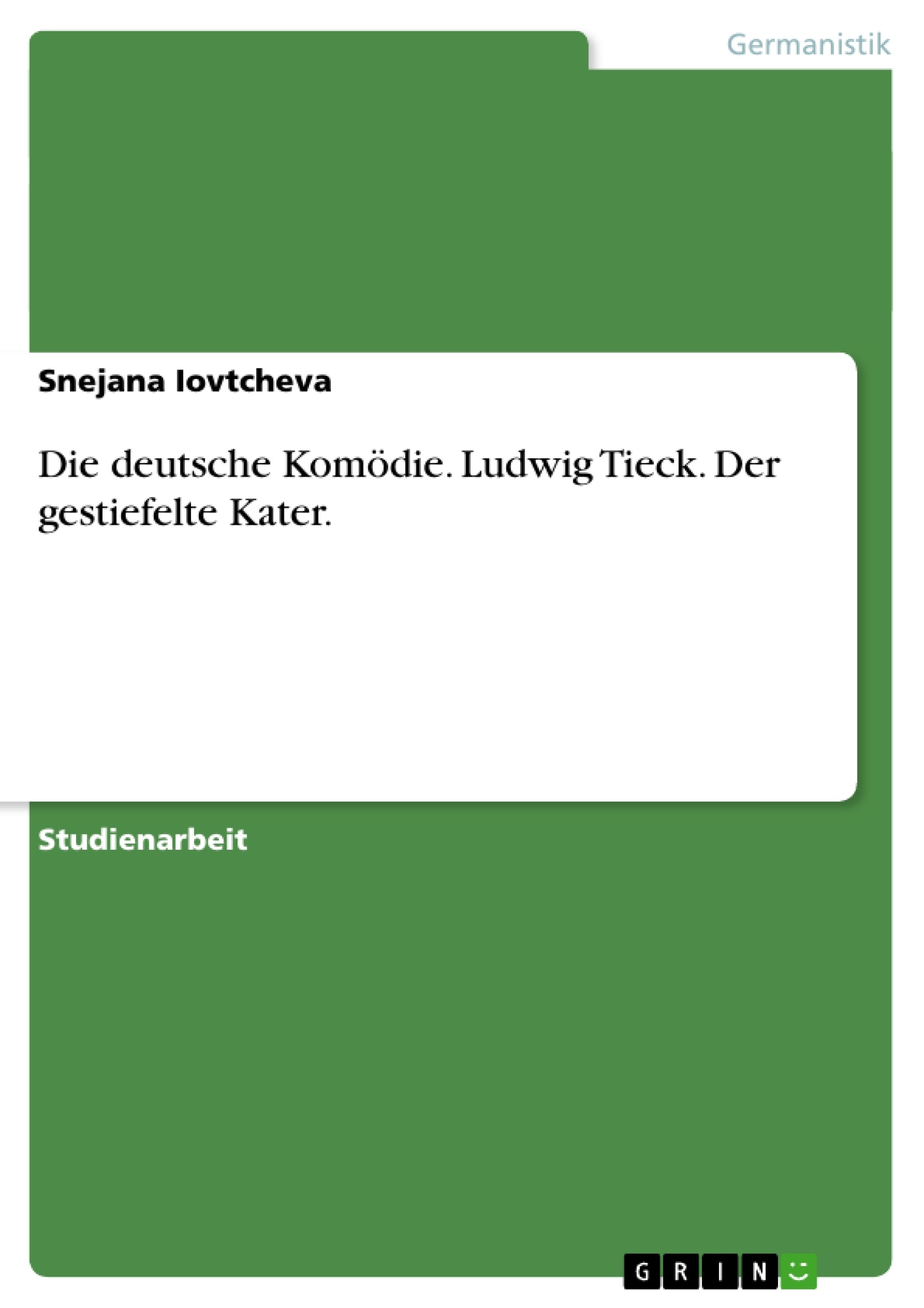Johann Ludwig Tieck (31. Mai 1773- 28. April 1853) war einer der vielseitigsten und produktivsten Dichterpersönlichkeiten seiner Epoche und ist einer der bedeutendsten Repräsentanten der deutschen literarischen Romantik. Schon in seiner Jugend zeigte Tieck großes Interesse für die Werke William Shakespeares, die er später übersetzte, und trat schon früh mit eigenen Dichtungen hervor. Auch seine Übersetzung des Don Quijote von Miguel de Cervantes blieb bis heute verbreitet. Heute ist der Autor einem größeren Publikum vornehmlich durch seine Leistungen als Übersetzer und einige besonders populäre Erzählungen präsent, allen voran die Satire "Der gestiefelte Kater" (1797). „Der gestiefelte Kater“ fehlt in keiner Darstellung der deutschen Romantik, und erst recht ist er im Zusammenhang solcher Themen wie der romantischen Ironie, der romantischen Komödie, des Beginns der Romantik und sogar des epischen Theaters und seine Vorformen immer wieder behandelt worden. Zu einer aber auch nur im wesentlichen einheitlichen Deutung ist man trotzdem nicht gelangt.
Die folgende Arbeit vermittelt eine Einführung in den Enstehungshintergründen des Stückes, behandelt die Rolle der Illusionsdurchbrechung und rekonstruirt die Spielebenen. Anschließend werden einige Interpretationen des Stückes vorgestellt und behandelt. Ziel der Arbeit ist eine Rekonstruktion der bisherigen Auffassungen, um die Gattung des Stückes und sein Platz in der deutschen Komödie festzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund und Bestimmung des Objektes der Satire
- Illusion und Illusionsdurchbrechung
- Gattungsbestimmung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Ludwig Tiecks „Der gestiefelte Kater“ (1797) und untersucht die Gattung des Stückes sowie seine Rolle in der deutschen Komödie. Die Analyse konzentriert sich auf die Interpretationen des Gestiefelten Katers und die Rekonstruktion der bisherigen Auffassungen.
- Die Hintergründe zur Entstehung des Stückes
- Die Rolle der Illusionsdurchbrechung im Stück
- Die Rekonstruktion der Spielebenen im Stück
- Die Interpretationen des Stückes
- Die Gattung des Stückes und sein Platz in der deutschen Komödie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Ludwig Tieck und sein Werk „Der gestiefelte Kater“ vor. Es wird auf die Bedeutung des Stückes in der deutschen Romantik und auf die Schwierigkeit einer einheitlichen Interpretation hingewiesen.
Hintergrund und Bestimmung des Objektes der Satire
Kapitel 2 erläutert die historischen und literarischen Hintergründe zur Entstehung des Stückes. Es wird auf die Tradition dramatisierter Märchen und auf Tiecks Kritik am Theater seiner Zeit eingegangen.
Illusion und Illusionsdurchbrechung
Kapitel 3 analysiert die Rolle der Illusionsdurchbrechung im Stück. Es wird gezeigt, wie Tieck die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verwischt und das Theater zu einem Kontinuum macht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete der Arbeit sind: Ludwig Tieck, „Der gestiefelte Kater“, deutsche Romantik, Komödie, Satire, Illusionsdurchbrechung, Theaterkritik, Gattungsbestimmung, Interpretation, Spielebenen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Tiecks 'Der gestiefelte Kater'?
Das Stück ist ein Paradebeispiel für romantische Ironie, da es die Illusion des Theaters ständig durch Kommentare des Publikums oder der Schauspieler auf der Bühne bricht.
Was versteht man unter Illusionsdurchbrechung bei Tieck?
Tieck verwischt die Grenzen zwischen Bühne und Realität, indem er die Zuschauer als Teil des Stücks agieren lässt und die Künstlichkeit der Aufführung thematisiert.
Welche Rolle spielt die Satire in diesem Werk?
Tieck nutzt das Märchen als Satire auf den faden Publikumsgeschmack und die einfallslosen Theaterkonventionen seiner Zeit (Aufklärung).
Inwiefern ist das Stück ein Vorläufer des epischen Theaters?
Durch die Distanzierung des Zuschauers vom Geschehen (Verfremdung) nimmt Tieck Techniken vorweg, die später von Bertolt Brecht perfektioniert wurden.
Wie sind die verschiedenen Spielebenen im Stück aufgebaut?
Es gibt drei Ebenen: das eigentliche Märchen, das fiktive Publikum, das die Aufführung kommentiert, und die Ebene der Schauspieler, die aus ihren Rollen fallen.
- Quote paper
- Snejana Iovtcheva (Author), 2002, Die deutsche Komödie. Ludwig Tieck. Der gestiefelte Kater., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26353