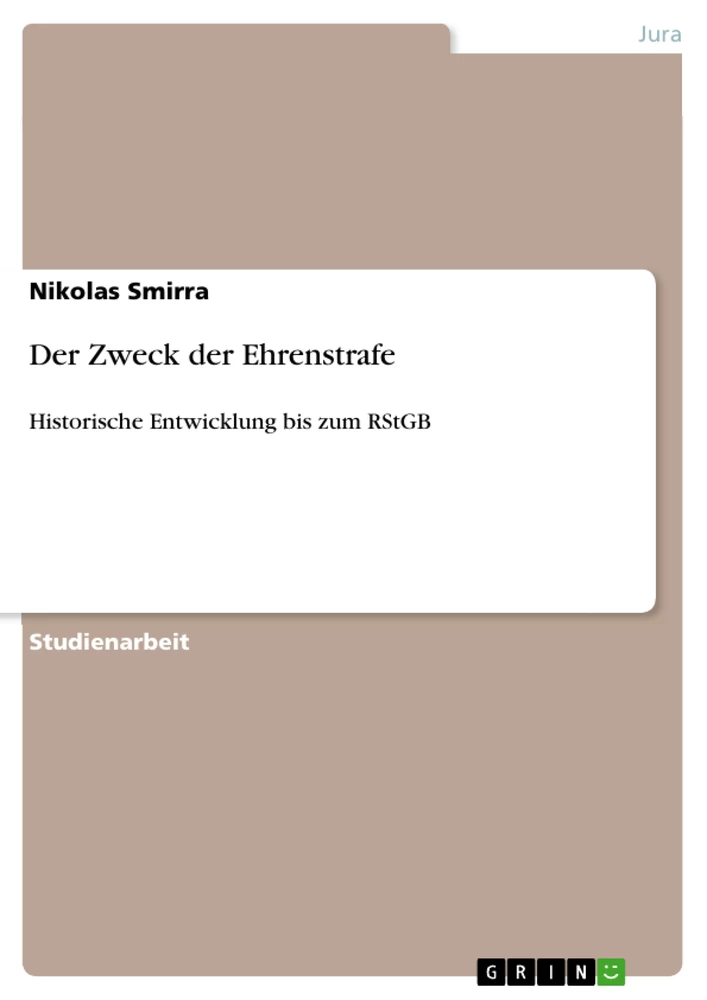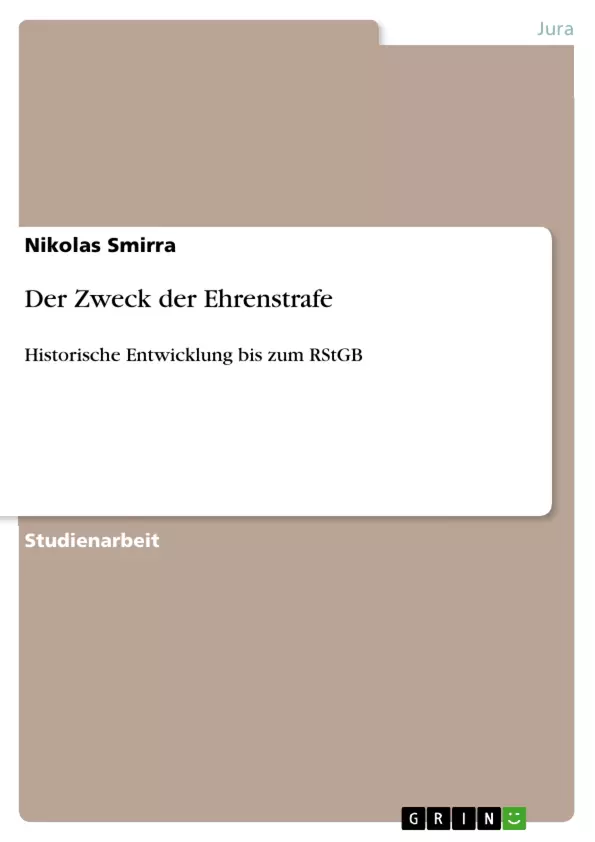Die Auseinandersetzung mit der Thematik des Zwecks der Ehrenstrafe in ihrem geschichtlichen Wandel steht im Ausgangspunkt vor einem definitorischen Problem: Beide Elemente des Untersuchungsgegenstandes – Ehre und Strafe – sind nicht eindeutig und begrifflich unbeständig. Sie lassen sich für den relevanten Betrachtungszeitraum nicht einheitlich bestimmen. Erst recht gilt dies für die Vermengung beider Bestandteile. Terminologisch werden in der juristischen und historischen Literatur teilweise weite Spektren anwendbarer Sanktionen mit umfangreichen Arsenalen an (Rechts-) Folgen unter den Begriff der „Ehrenstrafen“ subsumiert. Andererseits werden nur sehr limitierte Maßnahmen mit detaillierten Voraussetzungen und Folgen unter diesen Begriff gefasst. Vor allem die historische Dynamik der Begrifflichkeiten macht es erforderlich, vorab den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit festzulegen. Dies geschieht im ersten Abschnitt (I.1.).
Sodann werden als theoretische Basis der Darstellung die unterschiedlichen Strafzwecktheorien dargestellt(I.2.).
Auch wenn die Ehrenstrafen des antiken Roms, früher germanischer Gesellschaften und des deutschen Mittelalters nicht den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden sollen, so können diese dennoch nicht vollständig ausgeklammert werden. Denn um die mit der Aufklärung einsetzende Entwicklung nachvollziehen zu können, sollten auch die Ursprünge der Ehrenstrafe bekannt sein. Metaphorisch gesprochen ist es nämlich schwer einen Weg zu beschreiben ohne den Ausgangspunkt zu kennen. Folglich finden diese Epochen quasi als „historischer Teil“ eines insgesamt historischen Werkes Berücksichtigung (II.).
Erst im Anschluss daran werden die Auswirkungen der Aufklärungsphilosophie (III.) und die Entwicklung der Ehrenstrafe im 19. Jahrhundert (IV.) dargestellt. Hierbei werden unterschiedlichste Aspekte berücksichtigt. Denn es existieren keine verbindlichen Quellen, anhand welcher die alleinige Gültigkeit und das Vorherrschen bestimmter Strafzwecke festgelegt werden könnten. Vielmehr müssen aus den Werken einflussreicher Rechtstheoretiker und Philosophen, der Rechtspraxis sowie geltenden Gesetzeswerken Rückschlüsse gezogen werden. Nur dann kann ein einheitliches Bild der geltenden Strafzwecklehre gewonnen werden. Dabei kann schon einmal vorweg genommen werden, dass zwischen den theoretischen Überlegungen und ihren kontemporären Gesetzen meist keine Kongruenz herrschte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Untersuchungsgegenstand
- a. Subsumtion des Strafbegriffs
- b. Ehre als Anknüpfungspunkt der Strafe
- 2. Strafzwecke – generelle Vereinbarkeit mit der Ehrenstrafe?
- a. Absolute Theorien
- b. Relative Theorien
- (i) Generalprävention
- (ii) Spezialprävention
- 1. Untersuchungsgegenstand
- 1. Römisches Recht
- 2. Germanisches Recht
- 3. Mittelalterliche Ehrenstrafen
- 4. Naturrechtliche Theorien
- 1. Gewandelte Vorstellung der Ehre
- 2. Straftheorie der Aufklärung
- 3. Ehrenstrafe in der Praxis
- a. Codex Iuris Bavarici Criminalis und Theresiana
- b. Josephina
- c. ALR
- 1. Entwicklung der Straftheorie
- 2. Ehrenstrafen in der Praxis
- a. Bayerisches Strafgesetzbuch
- b. RStGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Wandel des Zwecks der Ehrenstrafe im Laufe der Geschichte. Sie analysiert, wie sich die Definition von Ehre und Strafe sowie ihre Verknüpfung im Laufe der Zeit verändert haben, insbesondere im Kontext der Aufklärung. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung und dem Übergang von traditionellen Ehrenstrafen zu modernen Strafkonzepten.
- Entwicklung des Begriffs der Ehrenstrafe
- Bedeutung der Ehre als Strafgrundlage
- Einfluss der Aufklärungsphilosophie auf die Straftheorie
- Veränderung der Strafzwecke im Laufe der Geschichte
- Verhältnis zwischen Theorie und Praxis im Bereich der Ehrenstrafen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition des Untersuchungsgegenstandes „Ehrenstrafe“ und stellt die verschiedenen Strafzwecktheorien vor. Im zweiten Kapitel werden die Ehrenstrafen im antiken Rom, in frühen germanischen Gesellschaften und im deutschen Mittelalter beleuchtet. Die Auswirkungen der Aufklärungsphilosophie auf die Ehre und die Straftheorie sowie die Entwicklung der Ehrenstrafe im 19. Jahrhundert werden in den Kapiteln III. und IV. behandelt. Dabei werden die verschiedenen Aspekte der Ehrenstrafe in Theorie und Praxis betrachtet.
Schlüsselwörter
Ehrenstrafe, Straftheorie, Strafzweck, Ehre, Aufklärung, Römisches Recht, Germanisches Recht, Mittelalter, Naturrecht, Strafgesetzbuch, RStGB, Generalprävention, Spezialprävention
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer „Ehrenstrafe“?
Ehrenstrafen sind Sanktionen, die direkt auf die soziale Geltung und den Rechtsstatus einer Person abzielen, wie etwa der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
Wie unterschieden sich Ehrenstrafen im Mittelalter von der Aufklärung?
Im Mittelalter waren sie oft mit öffentlicher Schande (Pranger) verbunden, während die Aufklärung begann, Ehre als inneres Gut zu definieren und Strafen rationaler zu begründen.
Was ist der Unterschied zwischen absoluten und relativen Strafzwecktheorien?
Absolute Theorien fordern Vergeltung für begangenes Unrecht, während relative Theorien (General- und Spezialprävention) die Verhinderung zukünftiger Straftaten bezwecken.
Welche Rolle spielte das Römische Recht für die Ehrenstrafe?
Das Römische Recht kannte Konzepte wie die „Infamie“, die den rechtlichen Status einer Person minderten und als Vorläufer moderner Ehrenstrafen gelten.
Was änderte sich im 19. Jahrhundert bei den Ehrenstrafen?
Im 19. Jahrhundert wurden Ehrenstrafen zunehmend kodifiziert (z. B. im RStGB) und systematisch als Nebenstrafen in das moderne Strafrecht integriert.
- Quote paper
- Nikolas Smirra (Author), 2011, Der Zweck der Ehrenstrafe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263554